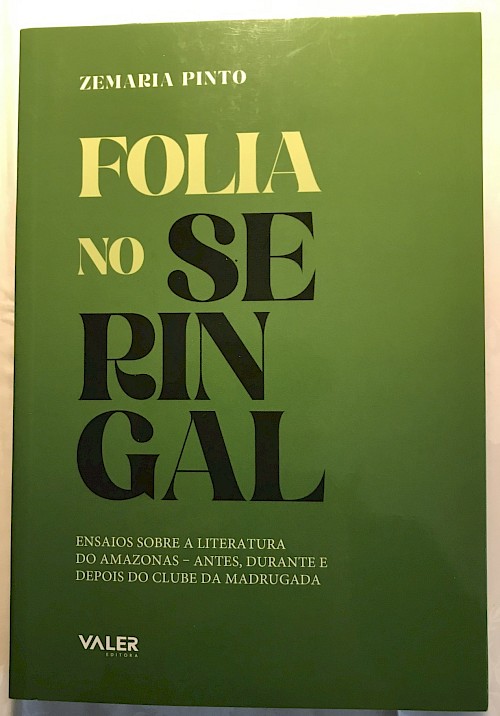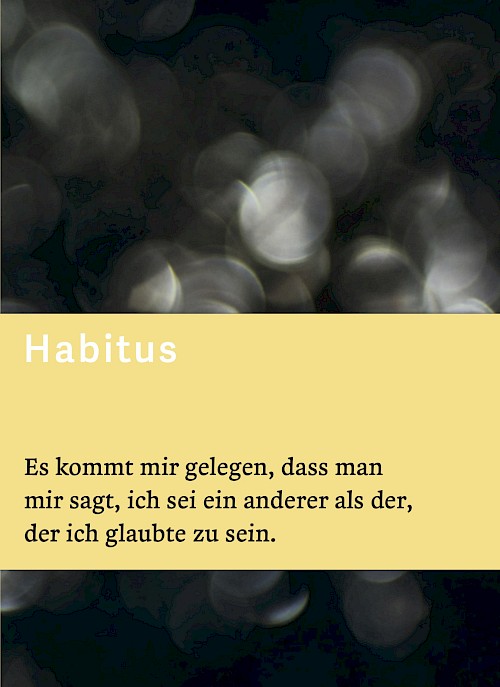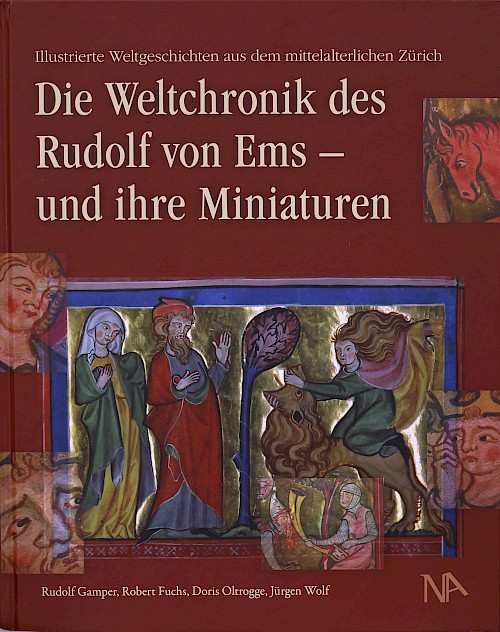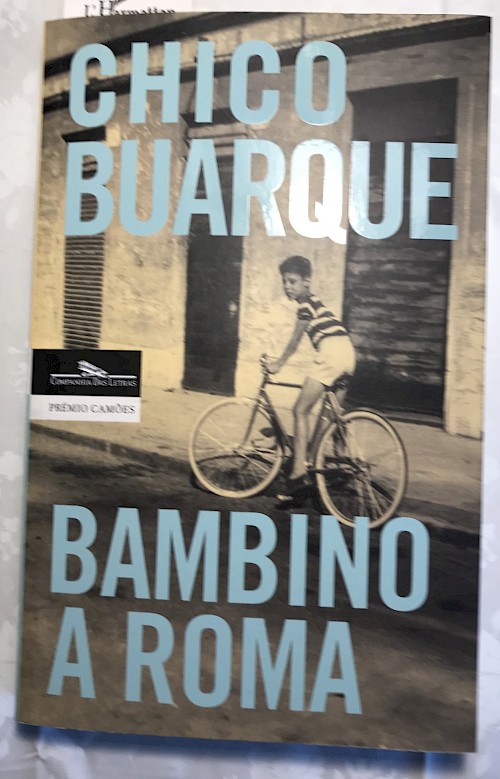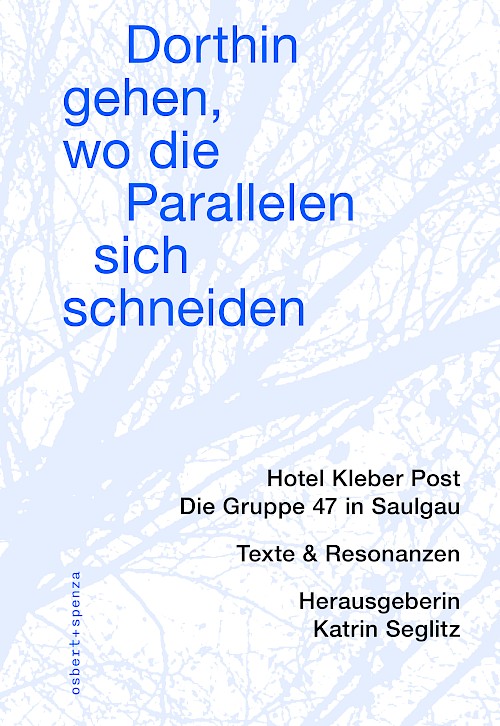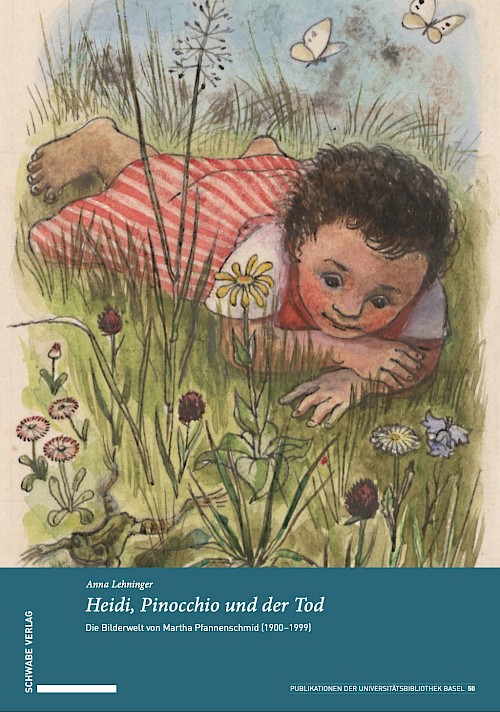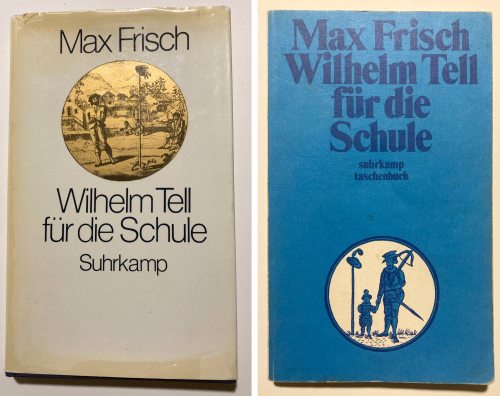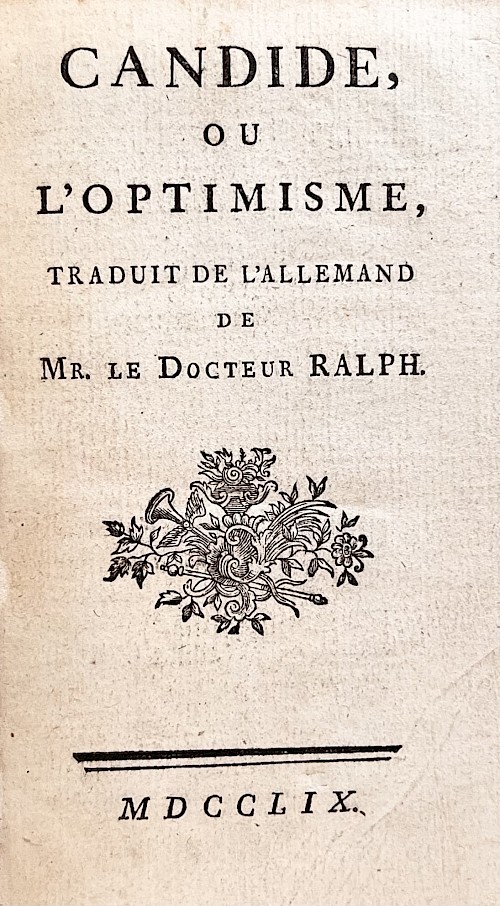Buch des Monats
Von Francisco de Orellana zum Liebhaber der Amazonen - ein literarisches Panorama des grössten Regenwaldes auf Erden
Das irdische Paradies ist der in der Genesis beschriebene Garten Eden. Obwohl es auf der Erde lokalisiert ist, verspricht es neben sinnlichen Genüssen und Kostbarkeiten das ewige Leben, wobei hier die Einschränkung gilt, dass das ewige Leben auf den Aufenthalt im Garten beschränkt ist. Es gibt dort keine Kälte und keine Hitze, nur gemäßigtes Klima. In der Mitte entspringt eine Quelle und teilt sich in vier Flüsse. Das irdische Paradies wird in fast allen Quellen als nicht zugänglich beschrieben. Dennoch war die Suche danach ein beliebtes Thema, wurde immer als strapaziös und gefährlich geschildert und nach der Entdeckung Amerikas in die Neue Welt verlegt.
Der Spanier Gaspar de Carvajal (1504-1584) war der erste Chronist, der sich für die Landschaft Amazoniens begeisterte und dort das irdische Paradies zu lokalisieren versuchte. Auf einer Reise mit Francisco de Orellana von den Anden bis zum Atlantik (1541-1542) beschrieb er die Bewohner der Region und schuf dabei den Mythos der Amazonen, kriegerischen Indianerinnen – weisse, grosse Frauen mit langen Haaren - die den spanischen Dominikaner an den griechischen Mythos von den männergleichen Kämpferinnen erinnerten. Ein europäischer Mythos wurde in die Neue Welt verpflanzt und verlieh dem grössten tropischen Regenwald auf der Erde seinen Namen.
Hundert Jahre später befuhr der spanische Jesuit Cristóbal de Acuña (1597-1675) ebenfalls den Amazonas auf der Route von Carvajal als Chronist der Expedition von Pedro Teixeira und widmete neben den Beschreibungen von Flora und Fauna auch ein Kapitel den Riten und Gottheiten seiner Bewohner, wenn auch aus einer eurozentrischen Perspektive (1).
Erst Euclides da Cunha (1866-1909), Begründer der modernen brasilianischen Literatur, und sein Freund Alberto Rangel (1871-1945) stellten unter dem Eindruck des Kautschukbooms und den sklavenähnlichen Arbeitsbedingungen der Gummi Zapfer das Bild des irdischen Paradieses auf den Kopf: Inferno verde (1908), eine Sammlung von 11 Erzählungen von Alberto Rangel schildern den Menschen Amazoniens als Opfer eines grausamen Schicksals.

Abb. 1.
Zemaria Pinto, Professor für brasilianische Literatur an der Universidade Federal do Amazonas (UFAM), rekonstruiert in seinem Buch das Bild Amazoniens in der europäischen Geistesgeschichte seit der Entdeckung Amerikas. Forscher, Reisende und Abenteurer formten das ambivalente Vexierbild einer Region, die als Experimentierfeld für Utopien aller Art ökonomisch und ideologisch umkämpft geblieben ist, so bei Jules Verne (2).
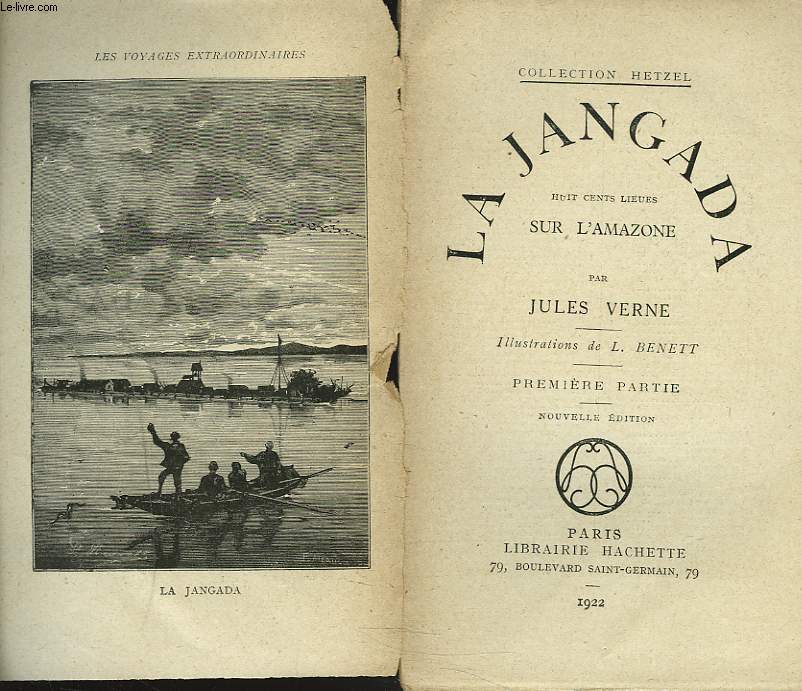
Abb. 2.
Doch wie reagierten die Schriftsteller und Intellektuellen Amazoniens selbst auf diese Stereotypen? Darauf gibt diese Monographie eine Antwort und zeichnet das Bild einer Region, die Opfer wirtschaftlicher Ausbeutung und zugleich Projektionsfläche europäischer Phantasien und exotischer Träume geblieben ist, wie sie im Roman Der Liebhaber der Amazonen (3) parodiert werden, einer Allegorie des Kautschukbooms.
Albert von Brunn (Zürich)
Zemaria Pinto. Folia no seringal: ensaios sobre a literatura do Amazonas. Manaus, 2024. (Paperback, ill. Acid-free paper)
(1) Gondim, Neide, A invenção da Amazônia. 3a ed. rev. Manaus: Valer, 2019.
(2) Verne, Jules, Die Jangada. Übs. Manfred Hoffmann. Berlin: Verlag Neues Leben, 1984.
(3) Samuel, Rogel, O amante das amazonas. Belo Horizonte: Itatiaia, 2005.
Anweisungen für Ehe und Erziehung in Text und Bild aus dem Jahr 1578
Johann Fischart (* ca. 1547; † 1591) hat ein umfangreiches, sprachgewaltiges, buntscheckiges literarisches Werk verfasst. Immer wieder greift er ältere Texte auf, übersetzt, überarbeitet und erweitert sie mit eigenen Worten und Gedanken. So setzt er «Dyl Ulenspiegel» um in eine versifizierte Fassung «Eulenspiegel Reimensweiß» (1572). Einen Text von Mathias Holtzwart gestaltet er aus zur «Flöh Hatz / Weiber Tratz» (1573) und erweitert das Büchlein vier Jahre später um das Doppelte. Fischart hat den «Gargantua» von Rabelais übersetzt und erweitert, auch seine eigene Fassung zwei Mal amplifizierend überarbeitet: «Geschichtklitterung» 1575 / 1582 / 1590.
Verschiedene Autoren übersetzt er und kumuliert sie mit weiteren Texten zum «Philosophisch Ehzuchtbüchlin», das, mit 71 Holzschnitten von Tobias Stimmer (1539–1584) illustriert, 1578 bei Fischarts Schwager Bernhard Jobin (†1593) erscheint (Duodezformat, 18 Lagen à 16 Seiten, unpaginiert). Neuauflagen: erweitert 1591; 1597; 1607; 1614.
Das Philosophisch Ehzuchtbüchlin. Oder/ Des Berümtesten vnd Hocherleuchtesten Griechischen Philosophi/ oder Natürlicher Weißheyt erkündigers vnd Lehrers Plutarchi Naturgescheide Eheliche Gesaz/ oder Vernunft gemäse Ehegebott/ durch anmutige lustige Gleichnussen ganz lieblich getractiret. Sammt desselbigen auch Gründlichem Bericht von gebürlicher Ehrngemäser KinderZucht. Darzu noch eyn schönes Gespräch/ von Klag des Ehestands/ oder wie man eyn Ruhig Ehe gehaben mag/ gethan worden. Alles aus den Griechischen vnd Latinischem nun das erstmal inn Teutsche Sprach verwendet. J.F.G.M., zu Straßburg, M.D.LXXVIII.
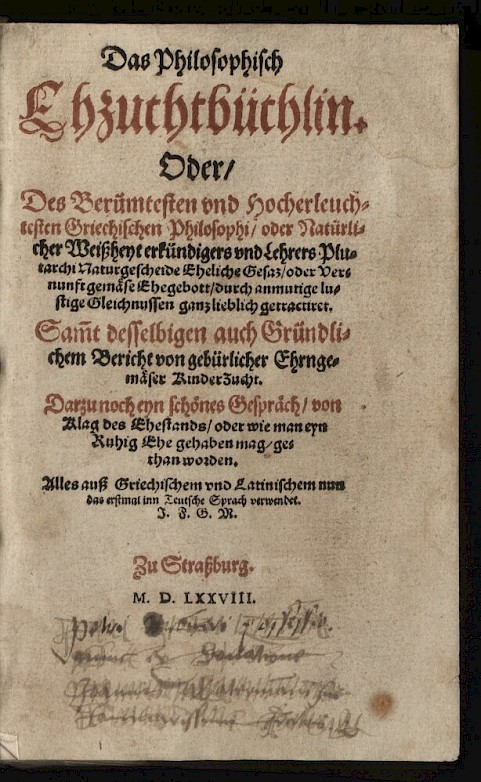
Digitalisat der Ausgabe 1578:
https://www.digitale-sammlungen.de/de/view/bsb00079908?page=13
Digitalisat der Ausgabe 1591:
https://viewer.onb.ac.at/1080B0D3/
Mit J.F.G.M. signiert Johann Fischart genannt Mentzer (der Vater stammte aus Mainz). Das Wort Eh-Zucht ist zu verstehen als sittliche Unterweisung zur Eheführung.
Das Büchlein ist folgendermaßen zusammengesetzt (man beachte, wie gut sich Fischart in der antiken Literatur auskennt, und seine Technik des Klitterns!):
• Der erste Teil Eheliche Ermahnungen basiert auf Plutarch, Ratschläge für die Ehe («Moralia», ed. Stephanus II,12), wozu Fischart eine zeitgenössische lateinische Übersetzung (Guilielmus Xylander 1572) mitverwendet; Fischart erweitert den Text beträchtlich und streut in Knittelversen gereimte Abschnitte ein.
• Der zweite Teil Von Ehgebürlichkeyten ist eine Kompilation von Anekdoten, Parabeln, Fabeln, Sprichwörtern und Sentenzen über Ehe, Frauen und Haushalt; Quellen sind u.a.: Joannes Stobaios in der deutschen Übersetzung «Scharpfsinnige Sprüche» von Georg Fröhlich, Basel 1551; Conrad Gesner, «Historia animalium» in den deutschen Übersetzungen des Tierbuchs; Christian Egenolff, «Sprichwörter / Schöne / Weise Kluogredenn», 1552 (u.ö.).
• Der dritte Teil Von der Kinderzucht wieder aus Plutarch («Moralia», ed. Stephanus I,1).
• Der vierte Teil Klag des Ehestands ist das Kapitel ‹Μεμψί-γαμος sive Coniugium› in den «Colloquia familiaria» von Erasmus (1518), einem damals sehr bekannten Text. Die Geprächspartnerinnen Eulalia (die Wohlsprechende) und Xantippe (die Frau von Sokrates, die sich über ihren üblen Gatten beklagt) heissen jetzt Rosemunda und Grimmhildin.
• In der Auflage 1591 ist hinzugefügt ein Traktat von Antonio de Guevara: Wie sich die Ehepersonen gegeneinander verhalten sollen.
Das Büchlein enthält (in der Fassung 1591) 70 Bilder; die Holzschnitte sind etwas breiter als 6 cm.
Das «Ehzuchtbüchlin» wird mit dem Beiwort philosophisch charakterisiert; weitere Begriffe im Titel (Natürliche Weißheyt, Vernunft gemäse Ehegebott) zeigen, dass hier nicht-religiöse Gesichtspunkte zur Geltung kommen. – In der Bibel gäbe es Aussagen wie: Mann und Frau werden ein Fleisch sein (Genesis 2,4); oder: Erzieht die Kinder in Zucht und Ermahnung des Herrn (Epheser 6,4); aber solche Gedanken fehlen. – Auch die Wahl der beigezogenen heidnisch-antiken und humanistisch gesinnten Autoren geht in diese Richtung: Von Erasmus zitiert er einen Text aus dessen Ironie-durchwalteten «Colloquia». Die interkonfessionelle Ausrichtung von Fischart wird bezeugt durch den Beizug des katholischen Autors Antonio de Guevara. – Einer der zentralen Gedanken ist: Die dem Affekt entgegenwirkende Vernunft macht die Tugend aus.
Zur Verwendung von Bildern äussert sich Fischart in der Dedikation zu der 1576 erschienenen von Tobias Stimmer illustrierten Bilderbibel mit dem Bemerkung zu des gemäls nuzbarkait – ein breit auf Quellen abgestütztes Plädoyer gegen die damals noch aktuelle Bildfeindlichkeit im religiösen Umfeld:
Neue Künstliche Figuren Biblischer Historien/ grüntlich von Tobias Stimmer gerissen: Vnd zu Gotsförchtiger ergetzung andächtiger hertzen / mit artigen Reimen begriffen/ durch J. F. G. M. Zu Basel bei Thoma Gwarin. Anno. M.D.LXXVI.
Daraus nur dieser Satz:
[…] je meh man nachsinnt vnd gründ/ Je meh sie [die Bilder] schärfen den verstand/ Vnd machen die sach bas bekannt.
Inhaltlich interessant ist die explizit wie auch allegorisch formulierte Darstellung der Geschlechter- und Kinder-Rollen in der Frühen Neuzeit. Im verfremdenden Spiegel der Geschichte erkennen wir unsere eigenen Logiken oft ein bisschen besser: ob sie abweichen oder konstant geblieben sind.
Es folgen einige auf die Verwendung der Bilder fokussierte Kostproben. (Man lasse sich nicht abschrecken durch die frühneuhochdeutsche Schreibung; die Texte sind auch so verständlich!)
Erstes Beispiel: Fresswanst im Gegensatz zum Jagdhund (aus der Kinderzucht 1591)
Lycurgus der Lacedemonische Gesatzstiffter/ nam auff ein zeit ein par Hündlin einer zucht/ zog die mit fleiß gar vngleicher weiß auff: daß ein ließ er zu allem fraß mutwill zartlichkeit vn geylheit vnartlich erwachsen: Daß ander hielt er streng zur Spur/ dem jagen vnd Weydenwerck an.
Den Bürgern von Sparta führt er die beiden Hunde vor: Er setzt ihnen eine Suppenschüssel und einen lebendigen Hasen vor. Der Fraßwanst rennt hierhin, und der weidliche Jagdhund dorthin. Die Moral von der Geschicht': Ebenso wirkt sich bei der Erziehung von Kindern vnterschidene zuchtpfleg dann in deren Erwachsenenleben aus.

Abb. 1.
Daher noch tägliches geschicht/
Das man thut/ nach dem man ein ziecht.
Welchen man zu dem Hafen ziecht
Der dencket nach dem Haſen nicht/
Welchen man nach dem Haſen gewenet
Derselb nicht nach dem Hafen rennet.
Welchen auffs Lotterbett man ziehet
Derselb darnach die Strew stats fliehet [...|.
(Zu beachten ist der typographische Witz: Haſen / Hafen – das lange s und das f sehen in der Frakturschrift ähnlich aus!)
Zweites Beispiel: Ausweichmanöver (aus den Ehelichen Ermahnungen sowie in Guevara, 5. Kap.)

Abb. 2.
Hier ermahnen zwei Allegorien zu moralischem Verhalten: im Bildhintergrund die Ziegen; auf dem Schoß das Zaumzeug der Temperantia.
Die Allegorien haben eine lange Tradition: das Verhalten der Ziegen bereits bei Plinius (Naturalis historiae VIII, lxxvi, 201); die Zähmung der Leidenschaften mit Gebiss und Kette bereits bei Horaz (Epist. I, ii, 60ff.).
Von den Böcken/ Widern vnd Geyssen [sagt man] wann zwey einander auf eim schmalen steg bekommen [entgegenkommen]/ vnd keins meh hindersich kan/ so leget sich das ein nider/ daß daß ander vber es hinaus springe. Dann allezeit muß eines daß best sein vnd weichen.
Wann man Milterung vnnd Mäsigung inn Ehelicher pflicht hat wöllen anzeigen/ hat man ein par Eheleut/ die einander halsen/ gemahlet/ deren der Man ein zaum vnd gebiß inn der einen faust halt/ anzuzeygen/ das er mit bescheydenheit sein Weib bändigen vnd regiren solle; das Weib aber helt den apfel der Holdselikeyt/ oder eine süsse Kütten inn der einen hand: anzudeuten/ das sie lieblich/ schertzlich/ vnd freundlich … sein solle. Vnnd doch greift der Mann zugleich an den Apfel/ vnd die Frau zugleich an den Zaum/ anzuweisen/ das es zu beyden theylen gutwillig soll zugehn.
Drittes Beispiel: Hercules an der Wegscheide (aus den Ehgebürlichkeyten)
Der Holzschnitt von Tobias Stimmer erscheint zuerst in Fischarts «Geschichtklitterung» (27. Kapitel im Druck 1575). An einer Wegscheide begegnen Hercules Frau tugend mit Buch unnd Rocken/ unnd Frau Wollust, mit Lauten und eim Weinkelch; jede der beiden möchte ihn auf ihren Weg locken. Der eine, steile Weg führt (im Hintergrund des Bilds links klein erkennbar) zu einem Engel; der andre zu einem Totengerippe. Die Tradition des Motivs ist lang.

Abb. 3.
Rechts im Bild die üppige Personifikation der Wollust mit Musikinstrument und Weinpokal; der Weg bergauf führt zum Tod – links die Tugend mit Spinnrocken in der Hand und einem Buch im Schoß; der Weg führt zu einem Engel. Dazu der Text (kleiner Ausschnitt):
Es gehet allen ledigen Manns vnd Weibspersonen/ wan sie zu etwas erwachssenem alter kommen/ wie dem Hercule/ welcher/ als er seine Mannliche Jar erreycht hatte/ auff eine Wegescheyd kame/ allda jne zwo Frawen antraffen/ deren eine gar prächtig vnd müßig/ Wollust genant: die andere erbares wandels/ Arbeyt geheyssen ware/ welcher jede jne auff jen weg zubereden gedachte. – Man kann sich leicht vorstellen, wozu Fischart dann rät ...
Viertes Beispiel: Der Knabe beschaut sich im Spiegel (aus der Kinderzucht 1591)
Das bei Fischart im Text nicht erläuterte Bild erscheint dann mit Texten versehen im ebenfalls von T. Stimmer illustrierten Emblembuch von Matthäus Holtzwart, Emblematum Tyrocinia, sive picta poesis Latinogermanica, das ist eingeblümete Zierwerck oder Gemälpoesy […], Straßburg: Jobin 1581; Emblema IX.

Abb. 4.
Der Text bei Holtzwart:
Bias einer auß Griechen landt
So man die weisen hatt genant
Gebott allweg den Knaben sein
Das sie sollten ein Spiegel rein
Nemmen sich selb darinn besehen
Wan dan jhr angsicht schön thett stehen
Solten sie darnach Richten auch
Jhre sitten vnd gantzen brauch
Damit ein schöner leib nit hab
An jhm ein heßlich wüste gab. [Fähigkeit, Talent]
Sey aber einer Vngestalt
So soll er aber trachten baldt
Das er sich üb jn Kunst vnd zucht
Vnd bring herfür ein solche frucht
Das man seiner heßIicheit nitt acht
Dan Kunst vnd gberd alleing macht
Das man viI auff ein Menschen halt
Wie heßlich der ja sey gestalt.
Der erwähnte Bias ist einer der antiken Sieben Weisen; in einer Anthologie vom Jahr 1551 wird seine Lehre – ohne Spiegelsymbolik – prägnant so gefasst: Bistu schön/ so thuo schöne werck. Bist du aber vngeschaffen/ so erstatte der natur mangel mit zierlichkait der sitten.
Fünftes Beispiel: Der Krake als misogyne Allegorie (aus den Ehgebürlichkeyten)

Abb. 5.
Es hat ein Poet in seim schreiben geschertzet/ es seien nicht allein Spinnen zu Land/ sondern auch inn Wassern/ welche man Mörspinnen nennet: ja es seien auch Spinnen vnter dem Menschlichen Geschlecht/ die er Zöpfspinnen heisset: vnd verstehet dardurch die arglistige Frawenbild/ welche er sonderlich diser Mörspinnenart vergleichet/ die man Pollkuttel nennet/ welche sich an die Felsen und Stein anhangen/ vnnnd eins jeden Steins farb annemmen/ damit sie die Mörkrebs/ denen sie sonderlich gehaß seind/ vnd sonst andere Fisch betrüglich auffangen und fressen.
Also können sich auch die Schalckhaffte Weibsbilder zum schein vor den Leuten/ wie man nur will/ stellen/ allerley Leut art an sich nemmen/ jhnen nach jrem gefallen reden/ recht geben/ willfaren/ liebkosen/ daß jederman meynt/ es seien die bescheideneste Weiber/ vnnd seint doch im grund rechte Zöpfspinnen/ welche die Mannsbilder betrügen/ fangen/ ihnen auffsetzig seind/ sie hinder gehen/ jhnen heimlich abtragen/ sie hin und wider außtragen/ außrichten/ schmähen und schelten.
Die Bezeichnungen Polkuttel für den Polyp verwendet Conrad Forer in der deutschen Übersetzung von Gesners Fischbuch 1563 (S. 109 r); dort wird auch das Verhalten beschrieben: Er häfftet sich an die Felsen/ verwandelt sein farb in die farb derselbigen Felsen/ also/ daß sie für stein geachtet werden/ dann so die Fisch herzu schwimmen/ so erfassen sie dieselbigen mit jren Armen/ als mit einem Garn/ vnnd fressen sie.
Sechstes Beispiel: Harmonie von Arbeit und Ruhe (aus der Kinderzucht 1591)
Dann gleicher massen/ wie die Kräuter vnd pflantzen mit zimlichem wasser ernehret/ mit vberflüssigem aber erstöcket werden: Ebener gestalt / wird daß gemüt mit mäsiger arbeit gemehret/ mit vberbürdlicher erseuffet. Jst derwegen gäntzlich den Jungen von den steht obligenden arbeiten eine fristung/ vund also erlaubter weiß zureden/ eine lufftschöpffung zu gonnen: Jn bedenckung/ daß vnser gantzes leben inn Arbeit vnd rhu getheilet stehet. Darumb dann auch nicht allein das Wachen/ sonder auch der Schlaff/ nicht nur der krieg/ sonder auch der frid/ daß vngewitter gleich so wol als daß schön Wetter/ vnd neben den Werck- auch die Feirtag sind geschaffen vnd erfunden.
Ja daß wir es inn einer summ begreiffen/ die Rhu ist daß Gewürtz der Arbeit/ vund eine versüssung/ die sie schmackhafft und angenem machet. Wie solches nit allein an den lebhafften Thieren/ sondern auch den vnseelhafften vnd vnempfindtlichen dingen bescheinlich. Seiteinmal [≈ denn] wir je die Corden vund Seyten an den Bogen/ oder an Lauten vnd Geigen ablassen/ sie darnach deß füglicher widerumb zuspannen/ zurichten und auffzuziehen. Vnd inn gemeyn zuschliessen/ setz ich für gewiß/ der Leib werd durch erfüllung vund entlärung/ daß Gemüth aber durch arbeit und ruh erhalten.
Das Bild thematisiert das Ent- und wieder Spannen des Instruments.

Abb. 6.
Siebentes Beispiel: Der ungebührliche Blick ins Schlafzimmer (aus den Ehgebürlichkeyten)
Kandaules, König von Lydien, lässt seinen Leibwächter Gyges die Reize seiner Gemahlin im Schlafgemach bewundern. Er wird aber von der Frau dabei ertappt. Erzürnt über solche Schmach, lässt die Frau Gyges zu sich kommen und stellte ihm die Wahl, entweder den König zu morden, oder augenblicklich erdrosselt zu werden. Gyges tötet darauf den Kandaules. (Antike Quellen: Herodot, Historien I, 8–13; Justinus, Epitoma Historiarum Philippicarum I, vii) – Die Geschichte wurde kolportiert von der Antike bis ins 18. Jahrhundert.
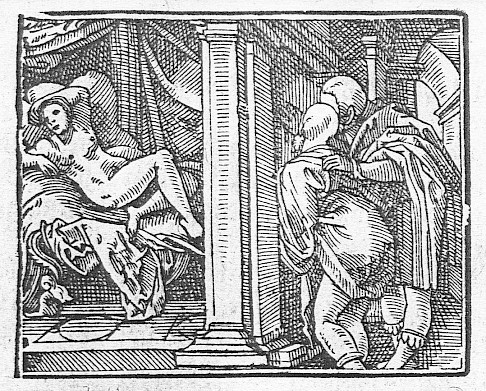
Abb. 7.
Man lißt von Candaule dem König inn Lydien/ das demnach er ein schön liebes Gemahl hette/ rümt ers täglich seiner schönen gestalt halben bey männiglich/ vnbenügt der geheymnus seiner besonderen fräud vnd Wollust/ als ob die verschwigenheyt der Schöne einen abbruch brächte. Entlich auf das er solchem rümen mehr glauben schaffet zeygt er sie auf ein zeit seinem wolvertrauten freund Gyge ganz nackend. Mit welcher that er/ beydes seinen freund zu dem Ehbruch ermant vnd zu eim feind gemacht/ vnd auch solchs failtragens halben/ seins Weibs lieb gar von jm hat entfremdet. Dermasen das sie mit dem Candaule [*] der sachen eins worden/ jren Man zu erschlagen/ vnd sich zu sampt dem Reich jm zu vbergeben. Sehet hie/ wie gefärlich es sei/ die heymlichkeiten der Eh zu offenbaren vnd böse geselschaft inn ein Haus zu füren.
[*] Hier hat sich Fischart vertan, es ist natürlich Gyges gemeint!
Achtes Beispiel: Das Kleid der Scham (aus den Ehelichen Ermahnungen)
Dieser Text lässt sich bildlich nur zum Teil repräsentieren, und zwar gerade zum unwesentlichen Teil:
Ein fromm Fraw laßt wol jhr Gewand
Vor der Badstuben an der Wand/
Aber sie zieht ein bessres an/
Welchs kein Wasser abwäschen kann
Von Schamlot/ das ist zucht vnd scham/
Das trägt sie hinein Tugendsam.
Dann eins Weibs Leib deckt nit der Sammet/
Sonder vielmehr ein Kleid von Schamet.
Das Wortspiel scham / Schamlot beruht auf dem französischen Wort chamelot ≈ Stoff aus Kamelhaaren); Sammet / Schamet ist etwas forciert.

Abb. 8.
Wir dürfen diese badende Frau mithin bedenkenlos betrachten, sie ist ja gut bekleidet.
Anhang:
Das Büchlein wurde unkritisch wiederabgedruckt in: Das Kloster, weltlich und geistlich. Meist aus der ältern deutschen Volks-, Wunder-, Curiositäten- und vorzugsweise komischen Literatur. Herausgegeben von J. Scheible, Zehnter Band, Stuttgart 1848, S. 403–641. [nach der Ausgabe 1587, ohne Bilder]
Adolf Hauffen (1863–1930) hat fundiert dazu gearbeitet:
~ Fischarts Ehezuchtbüchlein, Plutarch und Erasmus Rotterodamus. in: Symbolae Pragenses. Wien / Prag / Leipzig 1893, S. 24–41.
~ Johann Fischarts Werke III: Das Podagrammatisch Trostbüchlin; Das Philosophisch Ehzuchtbüchlin, hrsg. von Adolf Hauffen, Stuttgart 1893 (Deutsche National-Litteratur Band 18/III/3) [Vorwort Seiten L – LXX; S. 117ff.: mit Worterklärungen annotierte Ausgabe 1587]
~ Die Quellen von Fischarts Ehzuchtbüchlein, in: Zeitschrift für deutsche Philologie 27 (1895), S. 308–305.
~ Johann Fischart. Ein Literaturbild aus der Zeit der Gegenreformation, Band I, Berlin / Leipzig 1921, S. 275–290.
Pia Holenstein, Der Ehediskurs der Renaissance in Fischarts Geschichtklitterung. Kritische Lektüre des fünften Kapitels, Bern: Lang 1990 (Deutsche Literatur von den Anfängen bis 1700, Band 10).
Paul Michel, Zürich
Kritik mythologischer Symbole
Der in Amsterdam gebürtige Romeyn de Hooghe (1645–1708) hat ein umfangreiches und vielgestaltiges graphisches Werk geschaffen: Schlachtendarstellungen, Allegorien, Triumphzüge und Festbeschreibungen, Portraits, Landkarten, Bilder von Prachts-Gebäuden, Frontispizien von Büchern, Karikaturen u.a.m. – Wir fokussieren auf zwei Werke: Bibelillustrationen und «Denkbilder der alten Völker».
Bibel-Illustrationen
Von seinen Bibelillustrationen (142 Radierungen 19 x 15 cm) sei nur ein Beispiel herausgegriffen.
Die meisten der Bilder sind so arrangiert: in der Mitte die zentrale Szene; aussen vier Szenen, die den Ablauf der Geschichte darstellen. Hier Susanna im Bade (aus dem nicht kanonischen Buch Daniel, Kap. 13):

Abb. 1: Susanna im Bade. Oben links: Susanna wird von den beiden Alten ausspioniert, die ihr auflauern (Dan. 13,16); das zentrale Bild: Sie gerät im Bad in Bedrängnis (Dan. 13.22), Leute, die ihr Schreien hören, kommen herbei (Dan. 13,26); oben rechts: Sie flieht (Dan. 13,23f.); unten links: Anklage Susannas durch die beiden Alten, Daniel interveniert (Dan. 13,45); unten rechts: Die beiden Alten werden durch Steinigung hingerichtet (Dan 13,62).
Die Bibelstelle > https://www.uibk.ac.at/theol/leseraum/bibel/dan13.html
Quelle: Alle de voornaamste historien des ouden en nieuwen testaments/ verbeeld in uytsteekende konst-platen door den wyd-beroemden heer, en Mr. Romeyn de Hooghe; met omstandige verklaring der stoffen, en seer beknopte punt-digten, van den eerw. godsgel. heer Henricus Vos; waar by ook gevoegt zyn nieuwe kaarten, tot opheldring der zaaken nodig. Tot Amsterdam by Jacob Lundenberg 1703.
Digitalisat > https://hdl.handle.net/2027/gri.ark:/13960/t9t16fs7d
Faksimile mit einem Aufsatz von Wilco C. Poortman, Amsterdaem: Buijten & Schipperheijn [1980].
Hieroglyphica, oder Denkbilder der alten Völker
Hieroglyphica of Merkbeelden Der Oude Volkeren: Namentlyk Egyptenaren, Chaldeeuwen, Feniciers, Joden, Grieken, Romeynen, enz. Nevens een omstandig Bericht van het Verval en voortkruypende Verbastering Der Godsdiensten Door verscheyde Eeuwen; en eyndelyk de Hervorming, Tot op deze Tyden toe vervolgt. In LXIII. Hoofdstukken, en zoo veele Kopere Printbladen, Beschreven en Verbeeld door Mr. Romeyn De Hooghe, Rechtsgeleerde, en Commissaris van zyne Koninglyke Majesteyt, William De Derde. Overzien en Beschaaft Door Arn. Henr. Westerhovius, V.D.M. Gymn. Goud. Rector. Te Amsteldam, By Joris van der Woude 1735. [455 Seiten plus Register; 63 Kupfer + Titelblatt]
Digitalisate:
> https://archive.org/details/hieroglyphicaofm00hoog_2
> https://gdz.sub.uni-goettingen.de/id/PPN667759808
Der Herausgeber der niederländischen Erstausgabe, Arnold Heinrich Westerhov / Westerhoff (1677–1738), berichtet (im Vorwort 1735), dass ihm Freunde eine Handschrift von R. de Hooghe übergaben mit der Bitte, sie zum Druck zu befördern. Westerhov war von der Belesenheit des Verfassers begeistert, legte noch letzte Hand an den Text und die Bilder an und brachte das Werk zum Druck. (Die Kupfertafeln sind mithin nach dem Tod von de Hooghe 1708 verfertigt worden.) Und so entstand dieses Buch.
Bald erschien eine deutsche Übersetzung (danach ist hier zitiert):
Hieroglyphica, oder Denkbilder der alten Völker, namentlich der Aegyptier, Chaldäer, Phönizier, Jüden, Griechen, Römer, u.s.w. Nebst einem umständlichen Berichte von dem Verfalle und der eingeschlichenen Verderbniß in den Gottesdiensten, durch verschiedene Jahrhunderte, und endlich die Glaubensverbesserung, bis auf diese Zeit fortgesetzt, in LXIII Capiteln, und so viel Kupfertafeln beschrieben und vorgestellet durch Romeyn de Hooghe, Rechtsgelehrten. Uebersehen und besorgt von Arnold Heinrich Westerhovius, V.D.M. Gymnas. Goud. Rector. Ihrer Schönheit wegen ins Hochdeutsche übersetzt, und mit einer Vorrede des Herrn D. Siegmund Jacob Baumgartens, Professors der Gottesgelahrheit zu Halle, begleitet. Amsterdam, Arkstee und Merkus 1744. [Großoktav, 396 Seiten plus Register; 63 Kupfer + Titelblatt]
Digitalisat: > http://resolver.sub.uni-goettingen.de/purl?PPN497825848
R. de Hooghe schreibt im Vorwort:
Weil nun jedermann gern viel Sachen durch Bilder, oder Merkzeichen, vorgestellt sehen will, und solches den Künstlern öfters sehr schwer fällt, geschickt auszuführen; weil sie meistentheils, so wohl Maler, als Kupferstecher und Bildhauer, von geringen Aeltern gebohren sind, und zu der Untersuchung der Gründe nicht durchdringen können, aus welchen dieselben in dem Alterthume hergeholt worden, so habe ich meine Gedanken darauf gerichtet, denselben, so viel an mir ist, dabey die Hand biethen zu helfen. Man muß die Bilder des Alterthums zu verstehen, sprachkundig seyn, Belesenheit in den alten Schriftstellern haben, Münzen, Bücher und Zeichnungen sammlen, und, wenn man dieses besitzt, erfindungsreich, auch fruchtbar an Einfällen und Gedanken auf jeden Gegenstand seyn. Man muß die Gedanken auf die allzuweit gesuchten fremden Bilder und Zeichen der alten babylonischen, indianischen und ägyptischen Bilder bringen können. Andre kann man nach unsrer und andrer Landsart erdenken; griechische, römische und andere europäische Bilder nach ihrer Landesart, um die nun erkannte Wahrheit und Zustand vorzustellen; oder man vergeht sich, sie mit unverständiger Weisheit aufzutragen. (Text der deutschen Übersetzung 1744, S. 4)
R. de Hooghe wendet sich sodann gegen eine naive Verwendung der damals beliebten ikonographischen Musterbücher. Er zitiert namentlich Cesare Ripa (erste illustrierte Ausgabe der «Iconologia» 1603) und Valeriano Pierio («Hieroglyphica» 1575). Es geht de Hooghe nicht nur um die Vermittlung von ikonographischem Wissen. Er schreibt im Vorwort, er sei gleichsam gezwungen worden, den Uebergang der einen Religion zu der andern mit einzumengen und er habe es auch für gut gehalten, in diesem Werke der Denkbilder, die Geschichte der verfallenen oder emporgekommenen Religionen mit ihren Jahren anzumerken, und den Leser bis auf unsere Zeit zu führen.
Deshalb beschreibt er Vorstellungen der Religionen in der Antike, im Judentum, im Islam und in exotischen Religionen des Fernen Ostens und Amerikas in Bild und Text genauer und zeigt Ähnlichkeiten zwischen den verschiedenen mythischen Konzepten und den verschiedenen historischen Epochen auf. Insofern betreibt de Hooghe bereits ‹Vergleichende Religionsgeschichte›. Ein eher verstecktes Anliegen ist das Herausstellen des Kerns der christlichen Religion, den er unter den abergläubischen Fabeln, dogmatischen Spitzfindigkeiten und dem priesterlichen Geschwafel sucht (vgl. S. 261 zu A).
Der geistesgeschichtliche Hintergrund des Buchs, das sogenannte ‹Goldene Zeitalter› der Niederlande in der zweiten Hälfte des 17.Jahrhunderts, ist geprägt durch bedeutende Künstler sowie eine humanistische und eine naturwissenschaftliche Kultur und hat insbesondere eine religiöse Toleranz entwickelt, die sich gegen jedweden Dogmatismus wandte. Spinozas «Tractatus Theologico-Politicus» erscheint 1670, Pierre Bayle (1647–1706) begibt sich 1681 nach Rotterdam. Bedeutend ist sodann das Buch von Balthasar Bekker (1634–1698), «De betoverde weereld«, 1692–93 («Die Bezauberte Welt: Oder Eine gründliche Untersuchung des Allgemeinen Aberglaubens»).
Die Wendung Verval en voortkruypende Verbastering Der Godsdiensten Door verscheyde Eeuwen ≈ von dem Verfalle und der eingeschlichenen Verderbniß im Buchtitel meint die im Lauf der Geschichte sich ereignende Veräusserlichung und Dogmatisierung der ursprünglichen Religiosität, wie sie zeitgleich Gottfried Arnold (1666–1714) in seiner «Unparteyischen Kirchen- und Ketzer-Historie» (1600/1700) aufzeigen wollte.
R. de Hooghe kannte dieses Buch, das er mit 11 ganzseitigen ganzfigurigen Portraits illustriert hatte, vgl. Historie der kerken en ketteren van den beginne des Nieuwen Testaments tot aan het jaar onses Heeren 1500 tot 1688 […] vercierd met verscheyde Koopre Plaaten door Romeyn de Hooghe, t'Amsterdam: By Sebastiaan Petzold 1701.
> https://archive.org/details/historiederkerke02arno/page/n6/mode/1up
Die Darstellungstechnik in den Hieroglyphica sind sog. ‹Wimmelbilder›, wie wir sie kennen von seinen Landsleuten Hieronymus Bosch, ‹Garten der Lüste› (1490/1500) und Pieter Bruegel d. Ä.: (einundneunzig!) ‹Kinderspiele› (ca. 1560) und (achtzig!) ‹Sprichwörter›. Francis Cleyn hat solche Bilder gestaltet für die Ausgabe: «Ovid’s Metamorphosis, Englished, Mythologiz’d, And Represented in Figures. Imprinted at Oxford By Iohn Lichfield 1632».
Das Nebeneinanderstellen verschiedener symbolischer Vorstellungen hat in den Hieroglyphica indessen eine tiefere Bedeutung.
Zur Darstellungstechnik: Die einzelnen Bild-Elemente sind mit Buchstaben gekennzeichnet und werden in den Kommentaren mit Begriffen benannt und gedeutet. (Hier sind nur Auszüge zitiert.)
Erstes Beispiel: Das XXXIX Capitel. Von dem Verfall in die Ketzerey [S. 265ff.].

Abb. 2: Wenn die großen Köpfe Gewalt brauchen können, so lassen sie […] viele schwache Gemüther ächzen und seufzen, zweifeln und sich fürchten […].
Vorne links: B. [Die] Zweifelmüthigkeit oder Zweifelsucht, welche aus einem Scheinlichte entsprossen ist, hat durch denken, lesen oder hören bey den Menschen sich feste gesetzet. Dieses Gebrechen wird durch einen jungen Mann vorgebildet, dessen wildes Haar durch allerley Wind nach allen Seiten gewehet wird. Der Wetterhahn stehet auf seinem Kopfe, der bald nach der guten Seite mit einem Taubenfittige an der rechten Seite seines Haupts, bald mit einem Fledermausflügel an der linken Seite, itzt zur geistlichen Erklärung, dann zur finstern Blindheit und Unverstande getrieben wird. Er runzelt seine Augen zusammen, um sein Nachdenken dadurch merken zu lassen. […] Er hält einen Chamäleon auf seiner Hand, dem er allzusehr nachfolget, indem er einen solchen Eindruck von Farben annimmt, die ihm rund herum angeschmieret werden. […]
Mitte: C. Diese ungewisse Zweifelsucht wird von der großen Neugierigkeit fortgepflanzt, die durch eine junge Braut vorgebildet wird, deren Haare auch wilde um ihren Kopf herum hangen. Sie träget eine Unruhe auf ihrer Hirnschale, und fühlt die Geweihe eines Hirsches, eines von den neugierigsten Thieren, aus ihrem Wirbel wachsen. Die Fittige, worauf sie forttreibet, sind Flügel der Schmetterlinge von allerhand Farben, Pünktchen und Fleckgen. Diese blutlose Thierchen fliegen auf allerley Blumen und flattern von einer auf die andere. Ihr Schooß war so voller Bücher und Schriften, daß der größte Theil heraus fällt. […] Sie reichet und recket mit ihren schwachen Händen so hoch als ihr möglich ist, und trachtet die Ewigkeit [vgl. die Ouroboros-Schlange] und was mit derselben verbunden ist, zu ergreifen und zu begreifen. So emsig von verkehrtem Fleiße und Triebe steiget sie mit ihrem einen Fuße einen Berg hinauf um zu zeigen, daß sie allezeit höher steigen will. […]
Nochmals zum theoretischen Hintergrund:
Ob nun gleich durch die Zeit mehr Klarheit in den Wahrheiten, und größere Lust zu erwarten seyn sollten, um Ehrentitel in den Gottesdiensten zu verdienen, […], so hat man doch meistentheils das Gegentheil, und, nach dem gemeinen Sprichworte, die Töpfe schwarzer befunden, je länger sie zum Feuer gegangen waren. Die höchste Ehre, welche bey den Heiden bis zum Göttlichen erhoben ward, bestund darinnen, daß man ihre vornehmsten Priester beständig durch Lobeserhebungen und Unterwerfungen zu vergrößern suchte, welches das Werk der Geringern gewesen ist; und so hat ein jeder Kleinerer [...], dem Ansehen nach, nur zu dem Wachsthume seines größern Hauptes gearbeitet, um, wenn er durch Zeit, oder Kunst, sich auch so hoch empor gebracht hätte, die ausgewirkten Vorrechte, Gewinnste und Macht selbst zu genießen. (S. 369)
Die Korrumpierung betrifft alle Religionen: die katholischen Kirche (vgl. Kapitel XLIII: Von der Eindringung des römischen Stuhls zur obersten Gewalt) – den Islam (vgl. Kapitel XLVI: Von den mahometischen Anfängen) – das Judentum und andere. Er möchte die autoritäre Macht eines elitären Priestertums wie die vermeintliche Vorherrschaft einer bestimmten Religion sowie die überall aufkommende Idolatrie aufzeigen.
Bei allem ist er indessen bei seinen Urteilen ambivalent; man bekommt den Eindruck, er betreibe absichtlich ein Verwirrspiel, um das Denken der Betrachter/Leser zum Vergleichen anzuregen. Das ist möglicherweise der Hintergrund für die Wimmelbilder.
Zweites Beispiel: Das XXVIII Capitel. Von den guten und bösen Göttern
Interessant ist hier unter anderem, dass de Hooghe die Existenz des christlichen Teufels zurückweist, indem er ihn mit falschen Vorstellungen heidnischer Götter und Fabelwesen parallelisiert. Es sind 18 Figuren dargesellt.

Abb. 3: A. Herimis, der böse, wird meist als Geschmeiße mit vielen Armen, Hörnern und Schwänzen […], rund herumb mit Feuerstrahlen vorgestellt.
B. Joosje Tideaic, war bey den Japanern und Coreanern […] der böse Gott, den sie anbeten mußten; bei den Mexicanern erbenderselbe […].
P. Das Erdbeben wurde in einer Höhle bey Bajä geehret, ist eine grobe Mißgebur mit rothen straubichten Haaren, die Schwefeldämpfe aus seinem Munde ausstößt. Es hanen welke Flügel an seinen Schulern. Er bricht die Weltkugel zwischen seinen verwüstenden Fäusten entzwey; und unten it eine Schlange gewtaltet, um aus den tiefen Hölen der Erden aufzusteigen.
S. Syrtes ist eine lybische schöne Jungfer, vom Haupte, Hals und Busen reizend und anlockend, aber mit Klauen und Nägeln bereit, den fahrenden Schiffsmann zu vertilgen. […]

Abb. 4 (Ausschnitt von Abb. 3): D. Abbadon, mit einem Schlangenkopfe, Flügeln und Schlangenschwänzen statt der Füße und Asmodi, sind bey den Jüden selbst gefürchtet und angebethet worden, um kein Böses von ihnen zu leiden.
I. Hinter diesen sieht man einen Sabot der Hexen, mit einem Zusammenfluße von alten, geringen, dummen und boshaftigen Weibern, welche mit Schweimelsalbe beschmirte als todt liegen, mittlerweile sie meynen, daß sie Wunderdinge verrichten, […].
Drittes Beispiel: Das LXII Cap. Von verschiedenen vermeyntlichen und dem wahren Himmel.
Die Vorstellung eines Himmels ist für de Hooghe eine Folge der Aufgeblasenheit der Menschen, die sich als Lohn für ihre Guttaten eine solche Stätte einbilden. Er stellt einige solcher Pseudo-Himmel zusammen.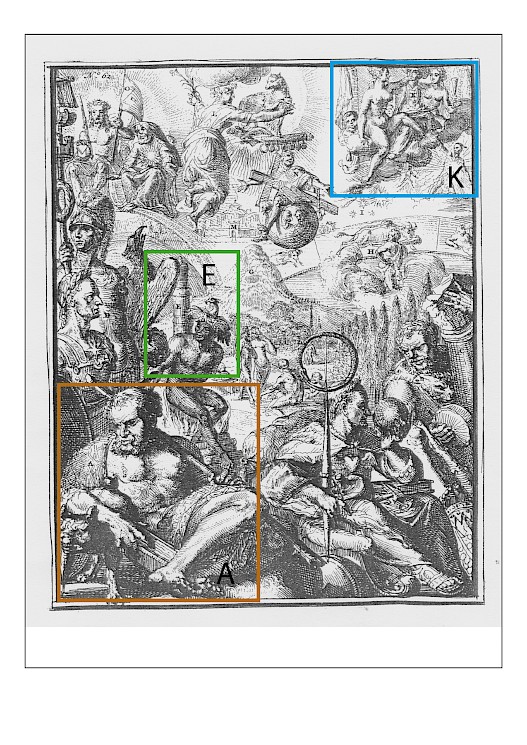
Abb. 5: A. Man siehet hier eine hündische, verächtliche Unflätherey, laß und faul, vor des Diogenes Fasse lauren. [… Er hat] aus Verachtung gegen alles, was Mode ist, ein altes Netz, aus Hochmuth, um seine Haut. Dieß Netz stinket vor Unflathe. […]. Dieß ist dieser ihre größte Glückseligkeit, […].
E. Einer der allerstaatskundigesten Himmel ist der Tapuyers, Canibalen, und mehr Westindianer ihrer, welche ihren Himmel in das Leiden durch ihre Feinde setzen; je grimmiger sie von ihren Feinden zerhackt und zerkerbet werden, mit desto mehr Ehre und Pracht stehen sie in de andern Welt auf, welches ihr Himmel ist. […]
K. Der türkische und persianische Himmel ist, nach Mahomets Alcoran, ein Zusammenfluß von allen Ergötzlichkeiten und Wollüsten, schönen Frauen, Kindern, Pferden, Speisen und Betten, Pracht und Prangen der Juwelen, und allem, was vortrefflich, ausnehmend und angenehm ist, […].
Hier wurden nur drei der 64 anspruchsvollen Kapitel kurz skizziert; eine eingehendere Beschäftigung mit diesem immer wieder ambivalent zwischen Skepsis und Glaubensverbesserung (in Kap. LIX) pendelnden und somit zu eigenem Nachdenken anregenden Buch lohnt sich.
Forschungsliteratur
John Landwehr: Romeyn de Hooghe the etcher. Contemporary portrayal of Europe, 1662–1707, Leiden [etc.]: A.W. Sijthoff [etc.] 1973.
Trudelien van ’t Hof: Romeyn de Hooghe’s Hieroglyphica. An Ambivalent Lexicographical History of Religion, in: Joke Spaans / Jetze Touber (Eds.), Enlightened Religion. From Confessional Churches to Polite Piety in the Dutch Republic (Brill's Studies in Intellectual History, Band 297), Brill 2019, S.233–269. > https://doi.org/10.1163/9789004389397_010
Mittels Bildsuche unter seinem Namen findet man online eine Revue seiner Kupferstiche.
Paul Michel, Zürich
Ein Plädoyer für Lateinamerika
«Ein umfassendes Werk, das in vielen Ländern des Kontinents entstand, schuf Johann Moritz Rugendas (1802-1858). Er betätigte sich sowohl als Landschafts- wie später als Porträtmaler. Schon als Neunzehnjähriger konnte er mit der Expedition von Baron von Langsdorff nach Brasilien reisen. Er war als Zeichner engagiert» (1). Der aus der Reichsstadt Augsburg stammende Rugendas bereiste nacheinander Haiti, Brasilien, Chile und Argentinien. Bei der Überquerung der Anden passierte ihm ein folgenschwerer Unfall: Das Pferd scheute, vom Blitz getroffen, der Reiter stürzte zu Boden und verletzte sich so schwer, dass er bis zu seinem Lebensende ein Gezeichneter blieb. Der argentinische Schriftsteller César Aira (2) schildert diesen Schicksalsschlag in seinem Roman Eine Episode im Leben des Reisemalers: «Tatsächlich, das Pferd kam hoch, struppig und monumental, das Gewebe der Blitze halb verdeckend und seine Giraffenbeine knicksten in störrischem Trippeln […]. Rugendas aber ging mit. Er konnte und wollte das nicht begreifen, es war zu monströs».

Abb. 1: "Praÿa Rodriguez" aus: Johann Moritz Rugendas Malerische Reise in Brasilien (Paris, 1835).
Die Geschichte des Reisemalers steht exemplarisch für die wechselvollen Beziehungen zwischen Deutschland und Südamerika, die Michi Strausfeld in ihrem neuesten Buch nachzeichnet, beginnend mit dem Büchsenschützen Hans Staden (1525-1576), der beinahe von den Tupinambá-Indios verzehrt worden wäre, über den Giganten Alexander von Humboldt (1769-1859) und dessen fünfjährige Reise durch Lateinamerika (1799-1804) bis zu den Emigranten des 20. Jahrhunderts, die vor Hunger, Krieg oder der Verfolgung durch die Nationalsozialisten nach Argentinien, Brasilien, Kolumbien, Bolivien oder Kuba flohen. Auch die Schattenseiten dieser Wechselbeziehung werden nicht verschwiegen – die Rattenlinie der Nazi-Schergen, die jahrelang in Argentinien, Bolivien oder Brasilien untertauchen konnten. Zur kuriosen Spezies der Abenteurerinnen gehört Margret Wittmer (1904-2000), die auf der Insel Floreana lebte und als «Kaiserin von Galapagos» in die Skandalchronik einging.
Ein besonderes Augenmerk gilt den Autoren des sogenannten «Boom» und seiner Rezeption in Deutschland, die mit Hundert Jahre Einsamkeit (1970) von Gabriel García Márquez (3) einsetzte, in den achtziger und neunziger Jahren des letzten Jahrhunderts ihren Höhepunkt erreichte und nach dem Mauerfall unaufhaltsam zurückging. Symptomatisch für die Wahrnehmung der Autoren aus Lateinamerika sind die Daten der Nobelpreise: Gabriel García Márquez (1982), Octavio Paz (1990), Mario Vargas Llosa (2010). Dass die Beziehungen zwischen Deutschland und Südamerika in letzter Zeit etwas gelitten haben, betrübt Michi Strausfeld. «Dann wollte ich einfach wissen, war das immer so, gab es mal in der Geschichte Momente, wo wirklich Deutsche und Lateinamerikaner ein enges Verhältnis hatten, wer war drüben, was haben sie gemacht. Das war der Ausgangspunkt» (4). Entstanden ist ein lebhaftes Plädoyer für Lateinamerika.
Albert von Brunn (Zürich)
Michi Strausfeld. Die Kaiserin von Galapagos. Deutsche Abenteuer in Lateinamerika. Berlin: Berenberg, 2025.
(1) Strausfeld, Michi. Die Kaiserin von Galapagos. Deutsche Abenteuer in Lateinamerika. Berlin: Berenberg, 2025, S. 62-64.
(2) Aira, César. Eine Episode im Leben des Reisemalers: Roman. Aus dem Spanischen von Christian Hansen. Berlin: Matthes & Seitz, 2016, S. 53.
(3) García Márquez, Gabriel. Hundert Jahre Einsamkeit: Roman. Aus dem Spanischen neu übersetzt von Dagmar Ploetz. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch, 2019.
(4) SWR Kultur 25. 5. 2025 17:04. https://www.swr.de/swrkultur/literatur/michi-strausfeld-die-kaiserin-von-galapagos-100.html (Zugriff 20.08.2025)
Topografien des Selbst
«Habitus» ist ein Kunstobjekt, das sich mit Bedacht dem schnellen Zugriff entzieht – ein Werk, das zum langsamen Lesen, genauen Sehen und wiederholten Aufschlagen einlädt. Seine Gestalt spricht Bibliophile an, noch bevor der erste Satz gelesen ist.
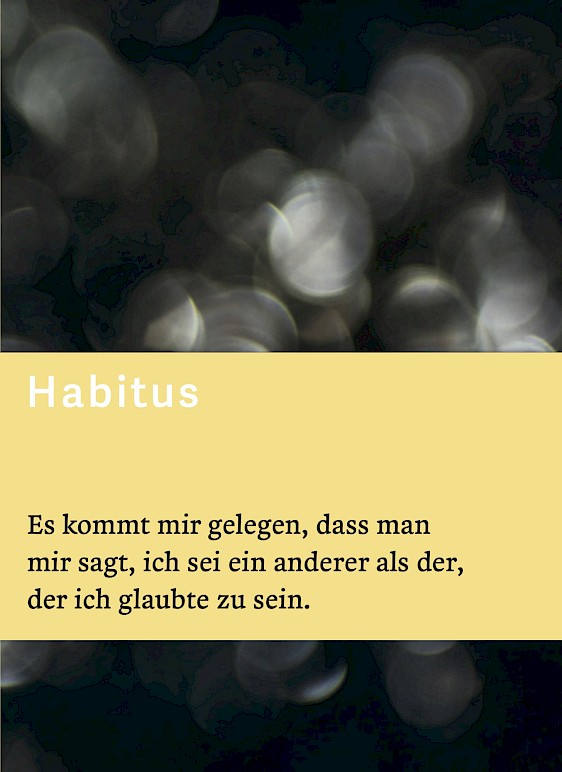
Abb. 1: Cover.
Der Text stammt von Waseem Hussain. Er begleitet den Protagonisten Khemji auf einer Reise ins Land seiner vermeintlichen Herkunft – eine Reise, die zwischen Traum und Imagination, Erinnerung und gegenwärtiger Erfahrung oszilliert. Die biografische Suche wird zur Reflexion über Herkunft und Identität in einem Indien, das Zugehörigkeit ebenso willkürlich zuspricht wie entzieht. Gesellschaftliche Kategorien wie Hautfarbe, Religion, Geschlecht oder soziale Herkunft bestimmen, wer dazugehört – oder eben nicht.

Abb. 2: Seite 32/33.
Parallel dazu entfaltet sich ein zweiter Erzählstrang in den Bildern: Sascha Reichsteins Fotografien zeigen Mineralien in extremer Nahsicht, aufgenommen im Naturhistorischen Museum Wien. Ihre kristallinen Strukturen wirken wie geologische Landschaften, fremde Planeten oder mikroskopische Fantasmen. Diese Bildwelt eröffnet ein visuelles Echo auf die Fragen nach Herkunft, Fremdheit und innerer Verfasstheit, ohne sie zu bebildern.

Abb. 3: Seite 52/53.
Der Band wurde in Bogenoffset auf zwei verschiedenen Papiersorten gedruckt, in Fadenheftung gebunden und mit einem auf den Buchblock zugeschnittenen Hardcover versehen. Die Gestaltung von Hanna Williamson zeichnet sich durch typografische Präzision und visuelle Ruhe aus. Die durchgängigen Bildstrecken, der reduzierte Einband, die Namen der Beteiligten lediglich auf dem Buchrücken: All dies verweist auf eine buchgestalterische Haltung, die nichts erklären, sondern Resonanzräume öffnen will. Ein Essay der Kulturwissenschaftlerin Silvia Henke ergänzt das Werk, ohne es zu deuten – als feinsinniger Kommentar zum Zusammenspiel von Wort und Bild.
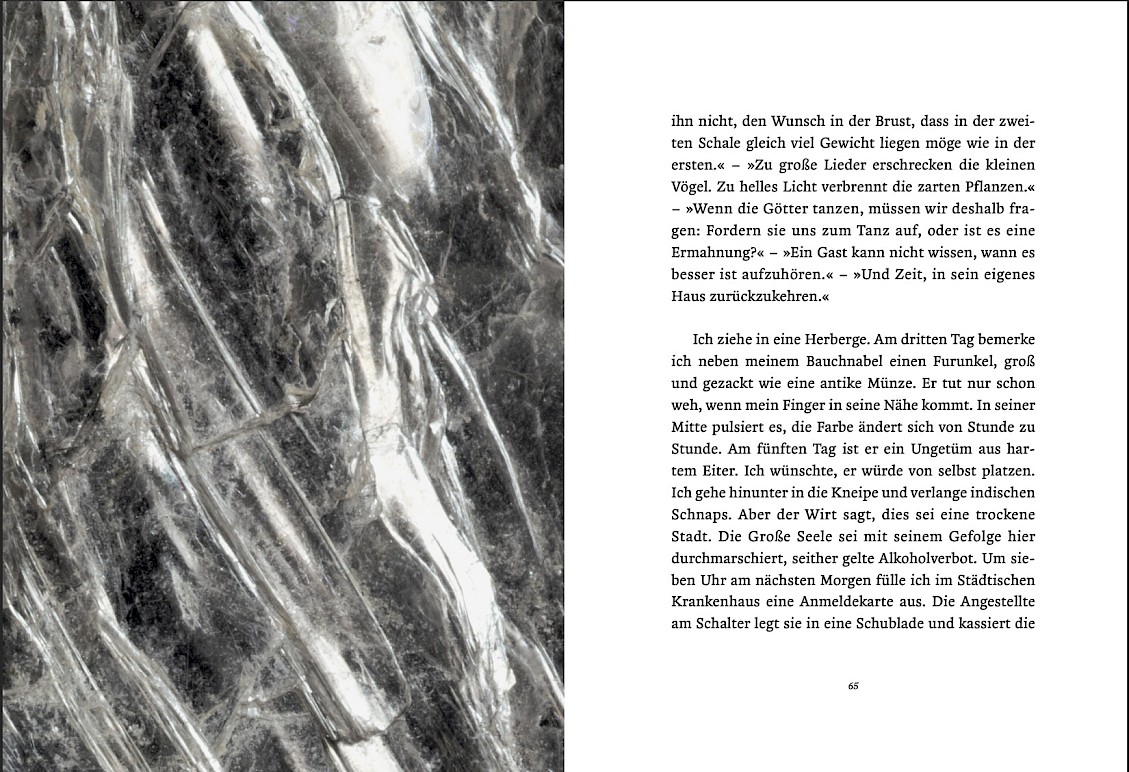
Abb. 4: Seite 64/65.
«Habitus» ist ein rares Beispiel für gelungene Buchkunst: ein literarisch-visuelles Werk, das die Form nicht ziert, sondern trägt. Es fordert zur Auseinandersetzung auf – mit sich selbst, mit dem Medium Buch und mit der Frage, was Herkunft heute bedeuten kann.
Waseem Hussain (Text) / Sascha Reichstein (Illustrationen): HABITUS, Ennetbaden: Verlag ars remata | editionR 2025.

Abb. 5: Sascha Reichstein und Waseem Hussain (Foto links: privat, rechts: Franziska Willimann).
Waseem Hussain ist Schriftsteller, Essayist und Songwriter. Er wurde 1966 in der pakistanischen Hafenstadt Karachi geboren und wuchs in Kilchberg am Zürichsee auf. In jungen Jahren kuratierte er Kunstausstellungen, organisierte Kulturveranstaltungen und war Mitglied der Independent Regional Experts Group der Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia. Als Journalist berichtete er für die Schweizer Presse aus Südasien und wurde für seine investigativen Recherchen mit dem Prix Mass-Médias der Fondation Christophe Eckenstein ausgezeichnet. Er lebt in der Nähe von Zürich.
Sascha Reichstein ist Künstlerin, Gestalterin und Dozentin. Sie wurde 1971 in Zürich geboren und lebt und arbeitet in Wien. Im Zentrum ihrer künstlerischen Arbeit stehen die Auseinandersetzung mit kulturellen Verschiebungen sowie das Spannungsfeld zwischen Tradition und Erneuerung. Reichsteins Werke gehen von regionalen westlichen Kontexten aus, die sich durch Übertragungen, Übersetzungen oder Verflechtungen in den Rest der Welt ausdehnen. Ihre künstlerischen Medien umfassen Fotografie, Video und Installation und werden international in diversen Kontexten und Institutionen gezeigt.
Fine Book #6
Diese Publikation ist der Jahreskatalog 2025 des Antiquariats Peter Bichsel Fine Books in Zürich.
Der Katalog bietet einen Blick auf fünfhundert Jahre Geschichte, Geographie und Kultur der älteren und modernen schweizerischen Eidgenossenschaft anhand von historischen Druckzeugnissen. Die gut zwei Dutzend, teils wohlbekannten Werke haben – wie oft im Antiquariat – mehr oder weniger zufällig zusammengefunden. Sie nehmen aber für sich in Anspruch, für eine Epoche, eine Region oder ein Thema repräsentativ zu sein. Jedes der angebotenen Werke war bereits bei Erscheinen wichtig, sei es in politischer, wissenschaftlicher, gesellschaftlicher, drucktechnischer oder künstlerischer Hinsicht, und ragte damit aus der Menge der typographischen Tagesproduktion heraus.
Der Katalog nimmt den Titel von Fritz René Allemanns «25mal die Schweiz» aus dem Jahr 1965 (2. Aufl. 1985 «26mal die Schweiz») auf.
Präsentation dreier Werke des Katalogs
3 Simler, Josias. Regiment gemeiner loblicher Eydgnoschafft: Beschriben und in zwei Bücher gestellet durch J. S. von Zürych; Jetzt aber von newem übersehen und an vielen orten gemehret und verbesseret. Mit 13 doppelblattgrossen Ortsansichten in Holzschnitt. 260 Bll. 12mo. Blindgepr. Schweinsldr. d. Zt. über Holzdeckeln und 3 Bünden. Mit 2 Messingschliessen. Zürich, (Froschauer), 1576.
 Zweite, um das Nachwort «Zu dem Christenlichen Läser» vermehrte deutsche Ausgabe im Jahr der Erstausgabe, zudem die erste illustrierte Ausgabe, postum nach dem am 2. Juli 1576 erfolgten Tod des Verfassers erschienen. Exemplar aus früherem Besitz des 1802/03 aufgehobenen Klosters St. Mang in Füssen mit hs. Besitzeintrag «S(ancti) Magni Fiessen» auf dem Titelblatt, später im Bestand der Bayerischen Bibliothek Oettingen-Wallerstein mit deren Stempel auf dem Titel. Simler (geb. 1530) liefert einen auf Tschudi und Stumpf basierenden, leicht verständlichen Abriss der Geschichte der dreizehnörtigen Eidgenossenschaft, der bis ins 18. Jahrhundert immer wieder neu aufgelegt wurde. Die Ortsansichten in Holzschnitt zeigen die Hauptorte Zürich, Bern, Luzern, Altdorf, Schwyz, Stans, Zug, Glarus, Basel, Freiburg, Solothurn, Schaffhausen und Appenzell. – VD16 S 6512; Vischer C 911; Lonchamp 2712; vgl. Haller IV, 409. – Alter Besitzeintrag auf Titelblatt. Die am Ende eingebundene Folge der 13 Ortsansichten mit bundseitigem Wurmgang. Schönes, sauberes Exemplar.
Zweite, um das Nachwort «Zu dem Christenlichen Läser» vermehrte deutsche Ausgabe im Jahr der Erstausgabe, zudem die erste illustrierte Ausgabe, postum nach dem am 2. Juli 1576 erfolgten Tod des Verfassers erschienen. Exemplar aus früherem Besitz des 1802/03 aufgehobenen Klosters St. Mang in Füssen mit hs. Besitzeintrag «S(ancti) Magni Fiessen» auf dem Titelblatt, später im Bestand der Bayerischen Bibliothek Oettingen-Wallerstein mit deren Stempel auf dem Titel. Simler (geb. 1530) liefert einen auf Tschudi und Stumpf basierenden, leicht verständlichen Abriss der Geschichte der dreizehnörtigen Eidgenossenschaft, der bis ins 18. Jahrhundert immer wieder neu aufgelegt wurde. Die Ortsansichten in Holzschnitt zeigen die Hauptorte Zürich, Bern, Luzern, Altdorf, Schwyz, Stans, Zug, Glarus, Basel, Freiburg, Solothurn, Schaffhausen und Appenzell. – VD16 S 6512; Vischer C 911; Lonchamp 2712; vgl. Haller IV, 409. – Alter Besitzeintrag auf Titelblatt. Die am Ende eingebundene Folge der 13 Ortsansichten mit bundseitigem Wurmgang. Schönes, sauberes Exemplar.
14 (Herrliberger, David). Zürcherische Kleider-Trachten oder eigentliche Vorstellung der dieser Zeit in der Statt und Landschaft Zürich üblicher vornemster Kleidungen welche allhier in LII sauber in Kupfer gestochenen abbildungen mit ihren Teutschen u. Französischen benennungen vorgestellte werden. Text und Figuren zur Gänze in Kupfer gestochen, die Figuren koloriert. 18 Bll. Quer-8vo. Einfacher Ppbd. d. Zt. Zürich, David Herrliberger, 1749.

 Erste Ausgabe. Gleichzeitig mit der Bekanntmachung der zweiten Folge der Zürcher Ausruf-Bilder setzt Herrliberger am 22. Mai 1749 die Öffentlichkeit in Kenntnis, dass eine ebenfalls 52 Figuren umfassende Folge von Zürcher Amts- und Arbeitskostümen erscheine. Die Art sich zu kleiden, war in Zürich im 18. Jahrhundert nicht eine Entscheidung des persönlichen Geschmacks, sondern war weitgehend obrigkeitlicher Verfügung unterworfen. «Kleider-Mandate schrieben genau vor, wie sich der einzelne Bürger [bzw. die Bürgerin] bei bestimmten Anlässen zu kleiden hatte» (Spiess-Schaad). Während die Ausruf-Bilder mit jeweils zwei deutschen Verszeilen erschienen, sind die «Kleider-Trachten» von je zwei deutschen und französischen Verszeilen begleitet. Zudem weist die Folge neben dem deutschen auch einen französischen Titel auf. – Spiess-Schaad S. 71 und Kat. 1.4.5; Lonchamp 1458. – Die Blätter etwas gebräunt und stellenweise fleckig, der untere Rand mit Griffspuren. Bll. 1 bis 10 rechts unten perforiert. Bl. 11 auf kleinerem Bogen gedruckt. Das Vorsatzblatt mit alt hinterlegten Randeinrissen.
Erste Ausgabe. Gleichzeitig mit der Bekanntmachung der zweiten Folge der Zürcher Ausruf-Bilder setzt Herrliberger am 22. Mai 1749 die Öffentlichkeit in Kenntnis, dass eine ebenfalls 52 Figuren umfassende Folge von Zürcher Amts- und Arbeitskostümen erscheine. Die Art sich zu kleiden, war in Zürich im 18. Jahrhundert nicht eine Entscheidung des persönlichen Geschmacks, sondern war weitgehend obrigkeitlicher Verfügung unterworfen. «Kleider-Mandate schrieben genau vor, wie sich der einzelne Bürger [bzw. die Bürgerin] bei bestimmten Anlässen zu kleiden hatte» (Spiess-Schaad). Während die Ausruf-Bilder mit jeweils zwei deutschen Verszeilen erschienen, sind die «Kleider-Trachten» von je zwei deutschen und französischen Verszeilen begleitet. Zudem weist die Folge neben dem deutschen auch einen französischen Titel auf. – Spiess-Schaad S. 71 und Kat. 1.4.5; Lonchamp 1458. – Die Blätter etwas gebräunt und stellenweise fleckig, der untere Rand mit Griffspuren. Bll. 1 bis 10 rechts unten perforiert. Bl. 11 auf kleinerem Bogen gedruckt. Das Vorsatzblatt mit alt hinterlegten Randeinrissen.
26 Segantini, Gottardo. Engadina. Folge von sechs Orig.-Radierungen, jede vom Künstler und vom Drucker signiert. Quer-folio. Lose Blätter wie erschienen in blauer Orig.-Maroquin-Flügelmappe mit goldgepr. Deckeltitel und Verlagssignet (sign. L. Sieke, Leipzig). Leipzig, Kurt Wolff, 1914.

Nr. 3 von 12 Exemplaren der Vorzugsausgabe mit den von Gottardo Segantini und Hans Felsing signierten und nummerierten Abzügen aus einer Gesamtauflage von 250. Gottardo Segantini (1882–1974) war der älteste Sohn des 1899 verstorbenen Giovanni Segantini. Er studierte Ingenieurswissenschaft an der ETH Zürich und wandte sich, nachdem er bei Hermann Gattiker das Radieren gelernt hatte, ganz der Kunst zu. Zeit seines Lebens arbeitete er in Maloja im Atelier seines Vaters. – Ohne das gedruckte Titelblatt mit dem Druckvermerk verso. Die Mappe an den Ecken und Kanten berieben.
Tiefdruck, Hochdruck, Flachdruck und Durchdruck
So vielfältig Originalgraphik ist, so vielfältig sind die verwendeten Drucktechniken. Sie gut zu kennen und zu unterscheiden ist für eine umfassende Beurteilung von Originalgraphiken unerlässlich. Nebst der Fachliteratur ermöglichen Referenzsammlungen mit Originalen eine praktische Auseinandersetzung und Vertiefung. Leider sind diese meist nicht mehr greifbar und enthalten eine Auswahl durchmischter und daher nur bedingt vergleichbarer Blätter. Das ist eine unbefriedigende Situation für Kunsthistoriker*innen, Sammler*innen, Konservator*innen und alle, die sich mit Drucktechniken, ihrer Unterscheidung und exakten Bestimmung tiefer befassen wollen und müssen.

Mit der Einführung in die künstlerischen Drucktechniken liegen zwei hochwertige Kassetten mit Originalgraphiken und erklärenden Texten vor. Sie bilden anschauliche Grundlagen für das Studium und die Bestimmung der wichtigsten Drucktechniken. Der Künstler Marcel Gähler hat mit einem durchgehend gleichen Motiv, einem liegenden Hund, Originalgraphiken in 19 verschiedenenen Techniken geschaffen. Auf die Originale Bezug nehmend verfasste die Graphikspezialistin Hildegard Homburger Texte zur Charakteristik und den wesentlichen Erkennungsmerkmalen der verwendeten Druckverfahren.

Abb. links: Zweifarbiger Linolschnitt (gelb und dunkelgrau); rechts: Dreifarbiger Siebdruck (gelb, orange und rot).
Kassette I: Weichgrundradierung, Kreidelithographie, Umdruck-Lithographie, Siebdruck, Mezzotinto, Heliogravüre/Staubkorn, Heliogravüre/Screen, Aquatinta/Staubkorn, Aquatinta/Weingeist (insgesamt 21 Originalgraphiken bzw. Zustandsdruck und 6 begleitende Textblätter)
Kassette II: Hartgrundradierung, Kupferstich, Kaltnadel, Punzen- oder Punktstich, Monotypie, Farbholzschnitt, Linolschnitt, Holzstich, Federlithographie, Pinsellithographie (insgesamt 24 Originalgraphiken bzw. Zustandsdruck und 9 begleitende Textblätter)
Die Auflage ist auf 21 Exemplare limitiert.
Bezugsquelle:
Verlag Rothe Drucke
Wolfackerstrasse 19
CH-3210 Kerzers
Illustrierte Weltgeschichten aus dem mittelalterlichen Zürich
In Zürich wird um 1300 eines der schönsten deutschsprachigen Bücher des Mittelalters angefertigt. Der noch 291 (von ursprünglich 322) Pergamentblätter umfassende Codex befindet sich heute in der Vadianischen Sammlung der Kantonsbibliothek St. Gallen (VadSlg Ms. 302, 1r-214ra).
Er enthält die Weltchronik des Rudolf von Ems (* um 1200 in Hohenems/Vorarlberg); † 1254 ?) und das Karlsepos des "Strickers". Dieses prachtvolle Buch ist nicht nur geschriebene Weltgeschichte, sondern auch ein Beleg für Größe und Macht der Stadt Zürich: Hier kann man sich das Kostbarste leisten, was die Buchkunst der Zeit hervorbringt!

Die Handschrift gibt Einblick in das Wirken am staufischen Hof in Zürich. Nicht nur ein Künstler ist dort beschäftigt, sondern viele Künstler im Team sind an der Herstellung des Buches tätig. Die schauerlichen Geschichten des Alten Testamentes werden eindrücklich in einmaligen Bildern dargestellt – selbst die an der Handlung beteiligten Tiere sind einbezogen. So stehen sich die Pferde von verfeindeten Parteien mit blutunterlaufenen Augen gegenüber während die auf ihnen sitzenden Reiter sich diplomatisch die Hand reichen zum Frieden. Im Text erfährt jedoch der Leser, dass dieser nicht lange hält – die Reittiere haben das schon vorausgeahnt! Spannende Geschichten wie sie sonst nirgends so drastisch illuminiert zu finden sind.
 |
 |
|
 |
 |
|
 |
Im Buch "Die Weltchronik des Rudolf von Ems - und ihre Miniaturen" werden nicht nur Text und Darstellungen detailliert beschrieben und in über 500 Farbbildern dokumentiert, sondern es wird gleichsam durch die Bildoberflächen in den Aufbau der Bilder hineingeblickt. Unterzeichnungen, Übermalungen, aber auch ganz eigene Bildgestaltungen werden durch aufwendige technische Verfahren sichtbar gemacht. Der Blick durchs Mikroskop macht die unterschiedliche Maltechnik der verschiedenen Künstler für die Leserschaft greifbar. Gleichzeitig werden die engen Verflechtungen von Text, Bild sowie Kontext aufgedeckt und das Buch so als Teil einer historisch spezifischen, aus Zürcher Perspektive wohl einmaligen Situation 'entschlüsselt'.
Ein fabelhaftes Werk mit großartigen Abbildungen und einem Text, der dem Leser nicht nur alles Wichtige der Handschrift vermittelt, sondern darüber hinaus noch eine ganz konzise Nacherzählung und Interpretation der biblischen Texte liefert. Ein sehr 'bildendes' Buch.
Die Weltchronik des Rudolf von Ems - und ihre Miniaturen : illustrierte Weltgeschichten aus dem mittelalterlichen Zürich / Rudolf Gamper, Robert Fuchs, Doris Oltrogge, Jürgen Wolf, Oppenheim am Rhein 2022.
Robert Fuchs, Göttingen
«Die Wohnung Nr. 2 im Erdgeschoss eines gelben vierstöckigen Hauses war altmodisch, düster und eiskalt, denn jemand hatte vergessen, die Heizung einzuschalten. Meine Mutter erklärte mir, das Land sei im Zuge eines Krieges verarmt, der erst vor wenigen Jahren zu Ende gegangen war. Die Räume waren mit Tapeten ausgekleidet, das Telefon hing an der Wand, Möbel und Bilder waren nicht die unsrigen und aus den Fotorahmen blickten Mitglieder fremder Familien. Im Ausland ist alles fremd: dieser Spruch wurde zum Leitsatz der Familie» (1).

Abb. 1.
Francisco (Chico) Buarque de Hollanda wurde am 19. Juni 1944 in Rio de Janeiro als Sohn des Historikers Sérgio Buarque de Hollanda und der Pianistin Maria Amélia Alvim geboren. Er wuchs umgeben von Künstlern und Intellektuellen auf, während sein Kindermädchen ihm brasilianische Volksmärchen erzählte. 1953 zog die Familie nach Rom, in die Via San Marino 12, denn Vater Sérgio hatte einen Ruf an die Universität Rom angenommen. In der Ewigen Stadt lernte Chico Italienisch und Englisch und begeisterte sich für Fussball und die Poesie von Vinícius de Moraes. 1955 kehrte die Familie nach São Paulo zurück. Chico besuchte das Colégio Santa Cruz und begann, sich für die Bücher in Vaters Bibliothek zu interessieren. Doch die Musik blieb seine grosse Leidenschaft, besonders Elvis Presley. Die Sechziger Jahre brachten viele Neuerungen – Cinema Novo, Theater der Avantgarde und die Architektur von Oscar Niemeyer. Mit 19 Jahren begann Chico Architektur an der Universität von São Paulo zu studieren (FAU), doch sein Interesse am Studium liess bald nach und er schrieb seine ersten Songs: Canção dos olhos (Lied der Augen) brachte ihm den ersten Erfolg beim Fernsehsender TV Record (2).
Am 13. Dezember 1968 erliess General Arturo da Costa e Silva den AI-5, das Ermächtigungsgesetz der Diktatur. Chico Buarque kehrte nach Rom zurück: Er spazierte durch die Stadt, als er sich plötzlich in einer Art Nebel wiederfand, der ihn bis zum Hotel zurückbegleitete: «Schon sah ich mich wieder an der Rezeption des Hotels Raphael stehen und einen unerwarteten Telefonanruf aus Brasilien entgegennehmen: Was ist los? Ist der Liftboy noch nicht aufgetaucht? Ist die Tochter des Magiers noch immer krank? Die Verbindung war nicht mehr so schlecht wie früher, dafür waren die Gespräche ausweichend, denn es gab Begriffe und Namen, die besser nicht erwähnt wurden. Aber vielleicht kam das komische Gefühl auch daher, dass ich als Erwachsener nie die Orte meiner Kindheit aufgesucht hatte» (3).
Viele Jahre später kommt Chico Buarque nach Rom zurück, um Kindheitserinnerungen aufzufrischen. Aufs Geratewohl schlendert er durch dunkle Gassen und landet schliesslich vor dem Trevi-Brunnen: «Ich bin nicht abergläubisch und halte es für eine dumme Gewohnheit, Münzen in den Brunnen zu werfen, um sich die Rückkehr nach Rom zu sichern. Aber wie dem auch sei, stets habe ich Münzen in den Brunnen geworfen, und bis jetzt hat es ja auch geklappt. Nur diesmal klopfe ich erfolglos meine Taschen ab und finde nichts. Morgen oder übermorgen werde ich mit ein paar Euros zurückkommen und sie in den Brunnen werfen. Ich kann einfach nicht sterben, ohne Rom noch einmal wiedergesehen zu haben» (4).
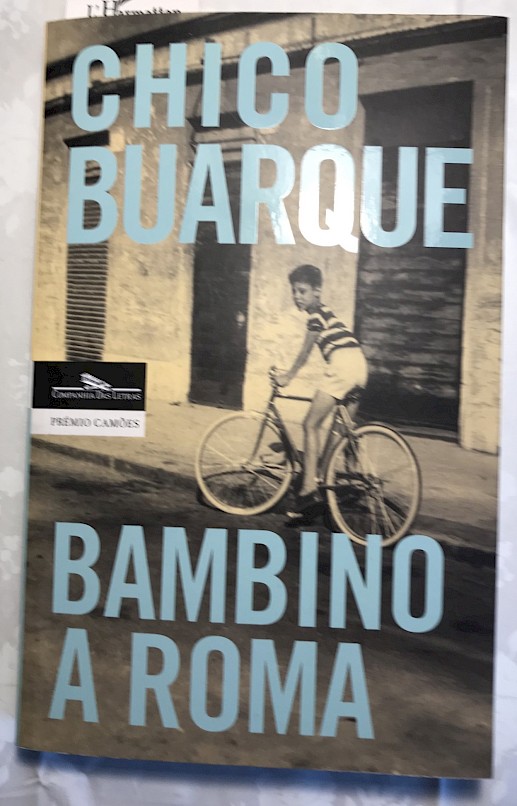
Abb. 2.
Bambino a Roma schildert aus der Perspektive des 80-jährigen Dichters und Musikers aus Rio de Janeiro die Erinnerungen an seine Jugend in Rom (1953-1955). Die Zeitgeschichte – Tod von Papst Pius XII., Selbstmord von Präsident Getúlio Vargas – spielen ebenso eine Rolle in diesen Memoiren wie ganz private Erinnerungen an die erste Fernsehübertragung eines Fussballspiels, den Alltag in einer amerikanischen katholischen Schule oder die Versuche, über das krächzende Telefon und Kinofilme den Anschluss an die ferne Heimat Brasilien nicht zu verlieren. Das Titelbild zeigt den 10-jährigen Chico Buarque auf seinem vernickelten Fahrrad. Zahlreiche Schwarzweissbilder und ein Küchenrezept aus dem Familienalbum ergänzen diesen Band. Entstanden sind dabei ein zauberhaftes Erinnerungsbuch und eine Liebeserklärung an Rom.
Albert von Brunn (Zürich)
Chico Buarque. Bambino a Roma. Lisboa: Companhia das Letras, 2024.
(1) Ibidem, S. 12.
(2) Angela Braga Torres. Chico Buarque. São Paulo: Moderna, 2002.
(3) Chico Buarque. Bambino a Roma. Lisboa: Companhia das Letras, 2024, S. 118.
(4) Ibidem, S. 145.
Eine Sammlung in- und ausländischer Holzarten
Im Archiv der Forstverwaltung der Burgergemeinde Bern, das sich in der Burgerbibliothek Bern befindet, hat sich eine Sammlung mit Holzmustern zur Bestimmung der Holzarten in Buchform erhalten. Das Titelblatt weist sie als «Sammlung in- und ausländischer Holzarten zur technologischen Kenntniß, Charakteristik und Waarenkunde aller Kunst-, Farb- und Apothekerhölzer» aus, ausgegeben in «Gotha, in der Expedition der Handlungszeitung und in Kommission des F.G. privil. Industriekomtoirs zu Weimar». Öffnet man den Halblederband im Quartformat, finden sich darin zwölf mit Marmorpapier ausgelegte Papprahmen, die je zwölf quadratische Holzfurnierstücke der Grösse 4,8 x 4,8 cm enthalten. Die insgesamt 144, mit wissenschaftlichem, d.h. lateinischem und mit deutschem Namen beschrifteten Beispiele zeigen europäische und exotische Holzarten und sind alphabetisch geordnet. Die Sammlung beginnt mit Acer campestris/Wachholder und endet mit Viburnum opulus/Gemeine Schwalkenbeer (Gewöhnlicher Schneeball).

Abb. 1.
Einen Hinweis auf die Datierung und den Kontext der Sammlung gibt eine eingeklebte Notiz: «Eine Schrift, welche auf diese Holzsammlung Beziehung hat, und den Titel führet: Beschreibung in- und ausländischer Holzarten zur technologischen Kenntniß und Waarenkunde, Apothekerhölzer, wird in dem Verlage des Industriekomtoirs zu Weimar herauskommen, und zur Michaelimesse dieses Jahrs fertig werden. Im May 1797 J.A.H.». Der zur Sammlung gehörige Textband erschien tatsächlich ein Jahr später unter dem angekündigten Titel und weist den Autor aus: Johann Adolf Hildt (1734–1 805), Kaufmann, Ratsherr in Gotha und Verleger der Handlungszeitung, später der Neuen Zeitung für Kaufleute, Fabrikanten und Manufakturisten. Ausführlich erläutert der Autor einleitend seine Beweggründe für die Abfassung seines Werks: Die systematische Darstellung der «Mannigfaltigkeit» der Holzarten, insbesondere der wenig bekannten exotischen Hölzer, und ihre «technologischen» Verwendungsmöglichkeiten und ihre Behandlung. Mit dem Quartformat bewusst handlich gehalten und anschaulich gegliedert, soll seine Sammlung mehr bieten als die bisherigen rein beschreibenden oder illustrierten Holzkunden und die Xylotheken. Letztere bestanden aus hölzernen, Büchern nachgebildeten Kästen aus dem Holz der zu beschreibenden Bäumen. Die «Buchrücken» waren mit der Rinde der Bäume überzogen, im Kasteninnern fanden sich die passenden getrockneten Zweige, Blätter und Früchte, ja selbst präparierte Insekten. Zu Sammlungen zusammengestellt, bildeten die Holzbücher eigentliche Bibliotheken.

Abb. 2.
Xylotheken und Holzsammlungen im 18. Jahrhundert
Xylotheken und Holzsammlungen wie diejenige von Johann Adolf Hildt waren beide Teil der Agraraufklärung Ende des 18. Jahrhunderts. Während sich die Xylotheken noch stark an den barocken Wunderkammern und Naturalienkabinetten orientierten, indem sie mit ihren aufwändig hergestellten Buchschaukästen im eigentlichen Sinne das Buch der Natur nachbildeten und lesbar machen wollten, stellt das Werk von Hildt eine mehr nüchtern-aufgeklärte Weiterentwicklung dar. Die Buchform steht hier für das Wissensmedium der Zeit par excellence, die Sammlung ist zweckorientiert, systematisch geordnet und vor allem keine Einzelanfertigung, sondern eine verlagsmässig vertriebene «Massenware» für ein bestimmtes, handwerklich-industriell tätiges Publikum.
Johann Adolf Hildts Holzsammlung ist heute von einigem antiquarischem Wert. Wie und warum der erste Band – der zweite Band wurde nicht angeschafft oder ist verloren – mit der Hildtschen Holzsammlung nach Bern und in die Forstverwaltung kam, dafür gibt es keine Belege, aber plausible Vermutungen.
Stadtwälder und aufgeklärte Nutzungsmethoden
Die bernischen Stadtwaldungen dienten hauptsächlich zur Deckung des Brenn- und Bauholzbedarfs der Bevölkerung und Institutionen wie der Stadtspitäler oder als Waldweide. Ratsmitglieder und Stadtdienstleute wurden jährlich mit sogenanntem Pensionsholz entschädigt. Um dem kontinuierlich steigenden Holzbedarf nachzukommen und gleichzeitig die Übernutzung des Waldes zu verhindern, regelten Wald- und Holzordnungen schon seit dem Mittelalter die Nutzung der Wälder. Spätestens seit Mitte des 18. Jahrhunderts konnte Bern allein mit seinen Stadtwaldungen den ständig steigenden Bedarf an Holz nicht mehr decken und musste Holz einführen. Diese Verknappung der Ressourcen führte nicht zuletzt zur Entwicklung neuer aufgeklärter Nutzungsmethoden. Befördert durch die 1759 gegründete Oekonomische Gesellschaft Bern versuchte man die Stadtwaldungen im Sinne eines «Holzoekonomiesystems» zu bewirtschaften. Die 1786 erlassene Forstordnung prägte die Entwicklung des bernischen Forstwesens noch bis ins 19. Jahrhundert. Ein Jahrzehnt zuvor war mit der Einführung der Oberförsterstelle zudem die Forstorganisation neu aufgestellt worden.
Wissenschaftlich ausgebildete Oberförster
Zum ersten Oberförster gewählt wurde Franz Hieronymus Gaudard (1733–1812). Dieser hatte neben seiner Tätigkeit als Förster auch als Notar und Inspektor des Schallenhauses (Gefängnis) gewirkt, bevor er 1775 das Amt des Oberförsters übernahm. Gaudard, hochgeschätzt von seiner vorgesetzten Behörde, trat 1795 zurück, nicht ohne eine umfassende Bestandesaufnahme über den Zustand der betreuten Wälder und die unter seiner Leitung durchgeführten forstlichen Massnahmen vorzulegen. Seine Nachfolge trat Albrecht Franz Gruber (1767–1827) an. Während Gaudard seine forstwirtschaftlichen Kenntnisse noch bei seinem Vater, der als «Forstner» unter anderem für die Stadtwaldungen zuständig war, erworben hatte, war Gruber einer der ersten theoretisch ausgebildeten Schweizer Forstmeister. Nach einem Studium an der Forstakademie in Göttingen hatte er seine Kenntnisse durch weitere Studien und Praktika im Ausland vertieft. Zurück in Bern versuchte er seine Kenntnisse umzusetzen: Als Oberförster liess er erstmals die Waldungen vermessen und taxieren, um danach die Nutzung zu planen und die Massnahmen für eine nachhaltige Waldbewirtschaftung festzulegen. Mit dem Untergang des Ancien régime 1798 bot sich ihm die Chance, seine forstwirtschaftlichen Vorstellungen gegenüber weniger fortschrittlich ausgerichteten Forstverwaltern durchzusetzen. Im Juni 1798 reichte Gruber dem Finanzminister der Helvetischen Republik einen Organisationsplan für die Einrichtung einer Landesforstbehörde ein.
Das helvetische Direktorium zollte Grubers Plan zwar viel Lob, entschied sich aber für eine deutlich zentralistischere Verwaltung der Nationalwälder. Gruber bewarb sich um eine der Inspektorenstellen, die er aufgrund seiner praktischen Erfahrung, besonders aber aufgrund seiner eingehenden forstwissenschaftlichen Kenntnisse erhielt. Tatsächlich besass Albrecht Franz Gruber eine grosse private Fachbibliothek von rund 300 Bänden forstlicher Literatur. Während seines Studiums und beruflichen Tätigkeit hatte er sich die jeweils neusten Werke vor allem aus dem deutsch- und französischsprachigen Raum angekauft. Wie ältere Besitzeinträge in seinen Büchern zeigen, stammten einige seiner Bücher auch aus den Nachlässen verstorbener Mitglieder der Oekonomischen Gesellschaft Bern. Gruber galt als gefragter Experte in Sachen Borkenkäfer, Forstvermessung und Baumschulung. Viele seiner Werke behandeln den Exotenanbau, in dem Gruber einige forstbotanische Erfolge in seinem 1809 angelegten Arboretum nahe dem Bremgartenwald (Neufeld/Studerstein) erzielte. Das Wissen über die fremden Baumsorten scheint Gruber sich vor allem aus der Literatur angeeignet zu haben, unter anderem aus Reiseberichten, die wertvolle klimatische und botanische Informationen über die Herkunftsländer enthielten. Der vermögende Gruber vermachte seine Bibliothek einschliesslich einer grosszügigen Geldsumme testamentarisch der damaligen Stadtbibliothek.
Burgerliche Forstverwaltung
Warum die Holzsammlung von Johann Adolf Hildt nach Bern gekommen ist und warum sie sich in der burgerlichen Forstverwaltung erhalten hat, lässt sich mit der Entwicklung der Forstwirtschaft seit dem Ende des 18. Jahrhunderts gut erklären. Wer hingegen den Ankauf veranlasst hat, bleibt offen. Es ist jedoch sehr naheliegend, dass Albrecht Franz Gruber in seiner Funktion als Oberförster respektive später Forstmeister des Kantons Bern und der Stadtwälder das Werk angeschafft hat. Die Hildtsche Holzsammlung ging entsprechend nicht mit seiner privaten Sammlung an die Stadtbibliothek, sondern verblieb gewissermassen «im Amt» und ging in die burgerliche Forstverwaltung über, welche die Stadtwälder nach dem Untergang des Ancien régimes gemäss Dotationsurkunde von 1803 respektive gemäss Ausscheidungsvertrag von 1852 mit der Einwohnergemeinde zugesprochen erhielt.
Claudia Engler, Bern
Literatur
- Ronald Bill, Die Entwicklung der Wald- und Holznutzung in den Waldungen der Burgergmeinde Bern vom Mittelalter bis 1798. Diss ETH ZH Nr. 9626, 1992.
- Claudia Engler, Private Sammlungen in der Stadt- und Universitätsbibliothek Bern, in: Librarium 2/43, 2000, S. 66-83 (A. F. Gruber S. 72-73 mit weiterführenden Quellen- und Literaturangaben).
- [Johann Adolf Hildt], Sammlung von Mustern zur Bestimmung von Holzarten, 1797 (Burgerbibliothek Bern, VA FB 428)
- Johann Adolf Hildt, Beschreibung in- und ausländischer Holzarten, Weimar 1798.
- Georg Schwendt, Forstbotanik. Vom Baum zum Holz. Berlin 2021.
- Birgit Stalder, Martin Stuber, Sibylle Meyrat, Arlette Schnyder, Georg Kreis, Vom Burgerholz zur Bodenpolitik – der burgerliche Grundbesitz in der Entwicklung der Stadtregion, in: Von Bernern und Burgern. Tradition und Neuerfindung einer Burgergemeinde. Baden 2025, Bd. 1, S. 281-474.
Paris - Brasília: ein transatlantischer Briefwechsel zwischen Lúcio Costa und Le Corbusier
«Heute verabschiede ich mich von meinen brasilianischen Freunden – und zugleich von Brasilien selbst», schrieb Le Corbusier am 29. Dezember 1962 an Lúcio Costa (1). «Brasília ist entstanden, ich habe die soeben erbaute Stadt gesehen. Es ist eine prächtige Erfindung aus Mut und Optimismus und spricht zum Herzen. Sie ist das Werk meiner zwei grossartigen Freunde – Lúcio Costa und Oscar Niemeyer. Brasília ist einzigartig in der modernen Welt».

Abb. 1: Le Corbusier.
Lúcio Costa (1902-1998), brasilianischer Architekt und Städteplaner, wurde in Toulon geboren, studierte in Rio de Janeiro Architektur und Kunstgeschichte. Zusammen mit Oscar Niemeyer gestaltete er den Brasilien-Pavillon für die New Yorker Weltausstellung von 1939. Am bekanntesten wurde er als Städteplaner für Brasília, der neuen Hauptstadt, 1960 von Präsident Juscelino Kubitschek (1902-1976) eingeweiht. Le Corbusier (1887-1965) fungierte beim Bau der neuen Hauptstadt als Berater und stand mit Lúcio Costa in einem regen Briefwechsel, der nun zum ersten Mal im Original und in portugiesischer Übersetzung vorliegt.
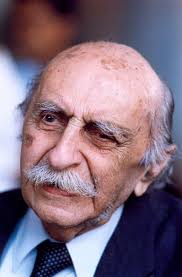
Abb. 2: Lúcio Costa.
Der Austausch in französischer Sprache beginnt im Jahr 1936 mit einer Einladung Lúcio Costas an Le Corbusier, sich am Projekt für das neue Erziehungsministerium in Rio de Janeiro zu beteiligen und wird mit kurzen Unterbrechungen bis einen Monat vor Le Corbusiers Tod am 27. August 1965 fortgesetzt, als sich in Brasilien bereits die Militärs an die Macht geputscht hatten. Der reich illustrierte Band ist das Ergebnis minuziöser Recherchen in der Casa de Lúcio Costa und der Fondation Le Corbusier (Paris). Die anastatische Reproduktion der französischen Originale und die portugiesischen Übersetzungen erlauben eine genaue Rekonstruktion des Briefwechsels, ergänzt durch Skizzen, Zeichnungen, Postkarten und Entwürfe. Der Vorderdeckel ist nicht mit dem Buchblock verleimt – die Bünde sind sichtbar, aber dafür mit dem Rückdeckel verbunden, was beim Aufklappen einen speziellen Effekt ergibt.
Die Idee, die Hauptstadt von der Küste ins Landesinnere zu verlegen, wurde in der republikanischen Verfassung von 1891 festgeschrieben, jedoch erst im 20. Jahrhundert realisiert. Zu den Visionären dieses neuen Zentrums gehört Johannes Bosco, der Begründer des Salesianer-Ordens: in einem Traum erschien ihm am 30. August 1883 ein Himmelsbote bei der Überquerung des zentralen Hochlands: An dieser Stelle werde eine Stadt entstehen. Doch diese unvollendete Utopie der Moderne endete jäh mit dem Putsch vom 1. April 1964 (2).
«Seit der Umgestaltung von Tenochtitlán, unmittelbar nach seiner Zerstörung durch Hernán Cortés (1521) bis zur Einweihung (1960) des märchenhaftesten Architektur-Traums der Moderne, dessen Amerika fähig war – Brasília von Lúcio Costa und Oscar Niemeyer – war die lateinamerikanische Stadt vor allem ein Produkt des Intellekts, in dem Urbanisation gleichbedeutend war mit der Vorstellung einer neuen Ordnung, die in der Neuen Welt den einzigen Ort fand, wo sie sich verwirklichen konnte» (3). Mit diesen Worten beginnt Ángel Rama sein berühmtes Essay über The Lettered City, das in der Beschreibung von Brasília gipfelt. Die Korrespondenz zwischen Lúcio Costa und Le Corbusier erlaubt es, die Entstehung dieser Retortenstadt nachzuvollziehen, eines Traums der Moderne aus Europa, der auf der anderen Seite des Atlantiks verwirklicht wurde.
Lucio Costa - Le Corbusier : correspondência / Julieta Sobral e Claudia Pinheiro (orgs.). Rio de Janeiro: Bem-Te-Vi, 2024.
(1) Le Corbusier: «À mes amis du Brésil » in : Lucio Costa - Le Corbusier : correspondência / Julieta Sobral e Claudia Pinheiro (orgs.). Rio de Janeiro : Bem-Te-Vi, 2024, S. 151.
(2) Holston, James. The modernist city: an anthropological critique of Brasília. Chicago: University of Chicago Press, 1989, S. 16.
(3) Rama, Ángel. La ciudad letrada. Santiago de Chile: Tajamar, 2004, S. 35. Cf. Rama, Ángel. The lettered city. transl. John Clarke Chasten. Durham (NH): Duke University Press, 1996.
Albert von Brunn (Zürich)
Wenn ein Autorname auch nur – nein: ein Glück, wo er immerhin – auf dem Buchrücken steht, so hat man eine gute Spur. Es handelt sich hier um ein Werklein in Duodez, Rückenhöhe 11 cm. Ein undatierter Besitzeintrag lautet auf Anna Katharina Sulzer. Das maßgefertigte Rückenschild ist trotz nutzungsbedingter Strapazen in wesentlichen Teilen auf uns gekommen. Ins leicht konvexe Schriftfeld gedrängt, steht quer zweizeilig: «Gregors A.B.C», goldgeprägt, der dankbar kurze Name in eng spatiierter Kursive, der dito Titel in Antiqua-Versalien.

Abb. 1.
Unterstützt durch das zwar äußerst dissimulativ bedruckte, dafür hübsch à la Boucher geschmückte Titelblatt (o. O., o. J., o. Dr., Verf. «C. G.») und eine entsprechende Google-Suche landet man, dem Schildchen sei Dank, unschwer beim Herrnhuter Bruder, Komponisten und Schriftsteller Christian Gregor – a very Christian Gregor, indeed –, geboren am 1. Januar 1723 in Dirsdorf [Przerzeczyn-Zdrój] bei Nimptsch [Niemcza], gestorben am 6. November 1801 in Berthelsdorf bei Herrnhut in der Oberlausitz (Wikipedia). Er zog halberwachsen nach Herrnhut, d. i. in die 1727 durch Graf Nikolaus Ludwig von Zinzendorf befestigte Sekten-Gemeine, und begann 1742 dort als Organist und Liturg zu wirken.

Abb. 2.

Abb. 3.
Am ehesten wohl in der Vignette lieblich – ansonsten vor allem ‹erbaulich› –, ist Gregors A. B. C. wirklich ebendies, nicht etwa Alphabet ‹von A bis Z›. Seine Vierzeiler laufen über 181 quasi-quadratisch beschnittene Seiten von «A. B. C.», «A. und O.», «abändern», «Abba» über «abgethan», «abgeneigt», «abgewöhnen» und «abhangen» bis «Crone», «Cur» und hin zuallerletzt zu einem «Cypressen-Zweiglein». Die abecedarisch zählenden Wörter sind um ein Geringes größer und gesperrt gesetzt, dadurch dezent hervorgehoben aus dem Vers-Kontext.
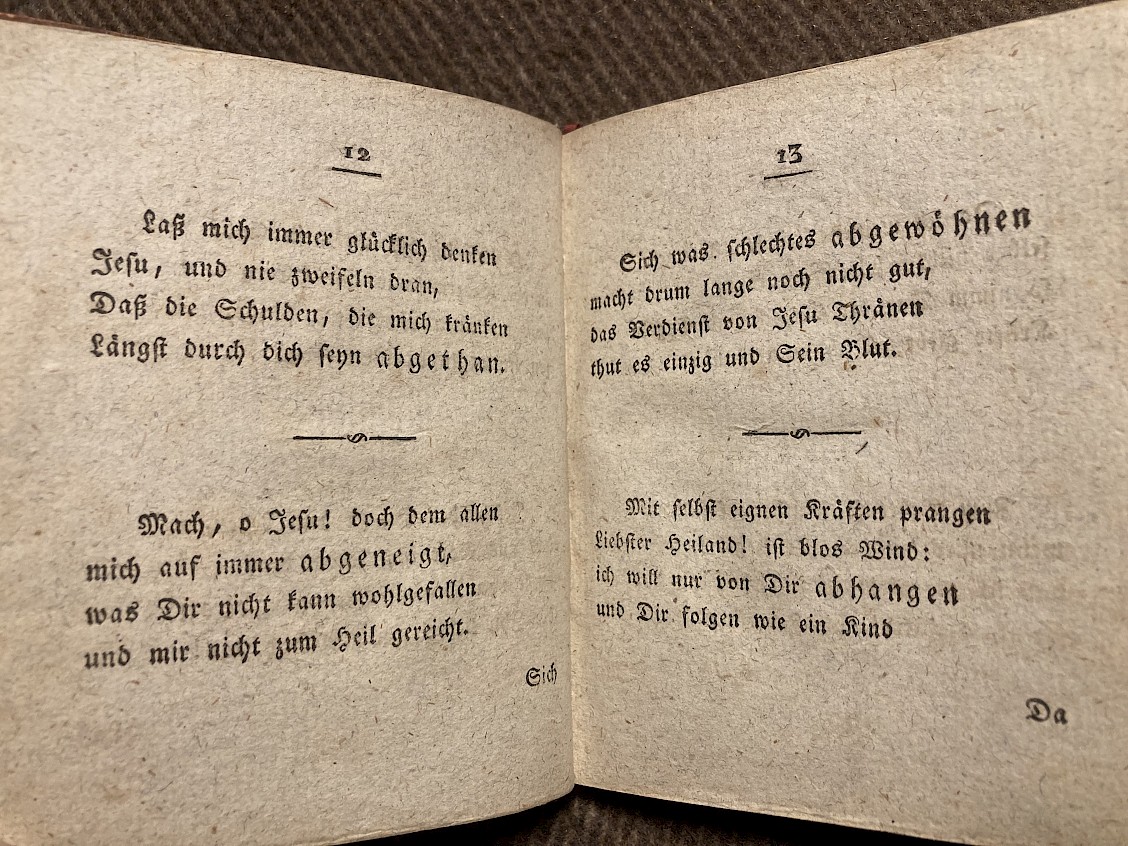
Abb. 4.
Die griffige Vierhebigkeit, die schon im Titel anklingt – ein lieblich A. B. C. in Versen –, zieht sich, konsequent kreuzgereimt, durch den ganzen «A»-Abschnitt. Ab der 106. Seite im Kapitel «B» schreitet Gregor etwas holpriger auf fünf Füßen und in Paarreimen weiter («Wenn jemand mich auf einen Backen schlägt, / um Jesu will’n, aus Feindschaft, die er hegt, / so soll ich ihm den andern auch herhalten; / o daß der Sinn stets in mir möge walten»), um im ungleich kürzeren Schlussteil «C» ab Seite 170 seinen ABC-Helden-Gesang vollends variabel ausklingen zu lassen, gleichsam unter der Kreuzeslast stolpernd, in regellos vier- oder fünfhebigen Metren rund um einen kadenzierenden Zweifüßer als vorletztem Vers jeder Strophe, weiterhin paargereimt (mitunter identisch, wenn etwa zwei sukzedierende Zeilenenden in «Cymbeln» ausbimbeln). Indes leidet auch die Textphysiognomie unter gehäuften Doppelsenkungen («Wer sich krank fühlt, und doch wünscht zu leben») oder sonstwie satzspiegelsprengendem Letternreichtum («Wer mir, wenn das Grab mich wird umschanzen»), kurz: sie krankt an öfter nun umbrochenen Versen bei notgedrungen verringerter Interlineardistanz, – vom Wasserrand gar nicht zu sprechen.
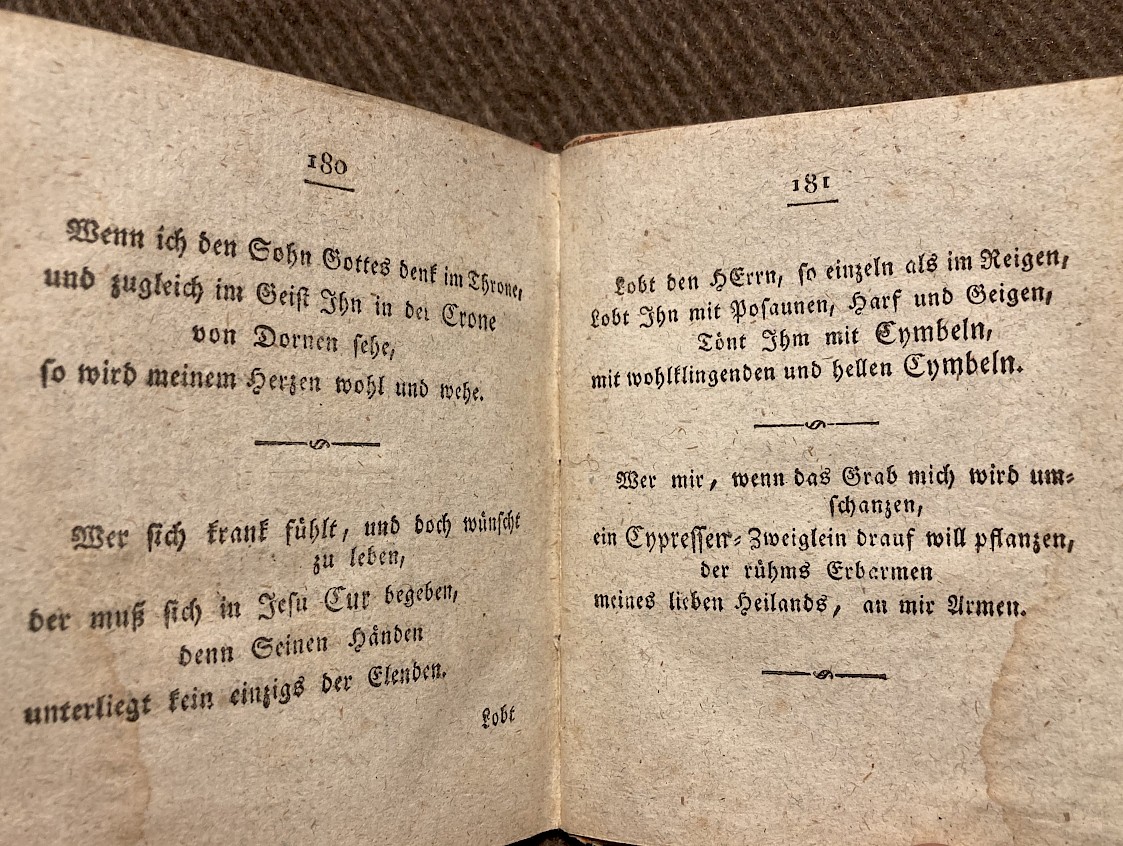
Abb. 5.
Das o. O., o. J., o. Dr. ließe sich, nach dem «C. G.», vielleicht auch noch auflösen. Aber genug aus Herrnhut für diesmal – oder, mit den Kreuzzügen des Philologen zu schließen: «Für Kinder, denen man den Brey fertiger Bissen in den Mund schieben muß, gehören Schriftsteller, die gründlichere Lehrmeister sind, als ein Notenschreiber seyn darf. Kennern und Liebhabern, die selbst Anmerkungen zu machen wissen, fehlt es nicht an der Gabe anderer ihre anzuwenden, und an der Behändigkeit die Ellipses [...] aufzulösen.»
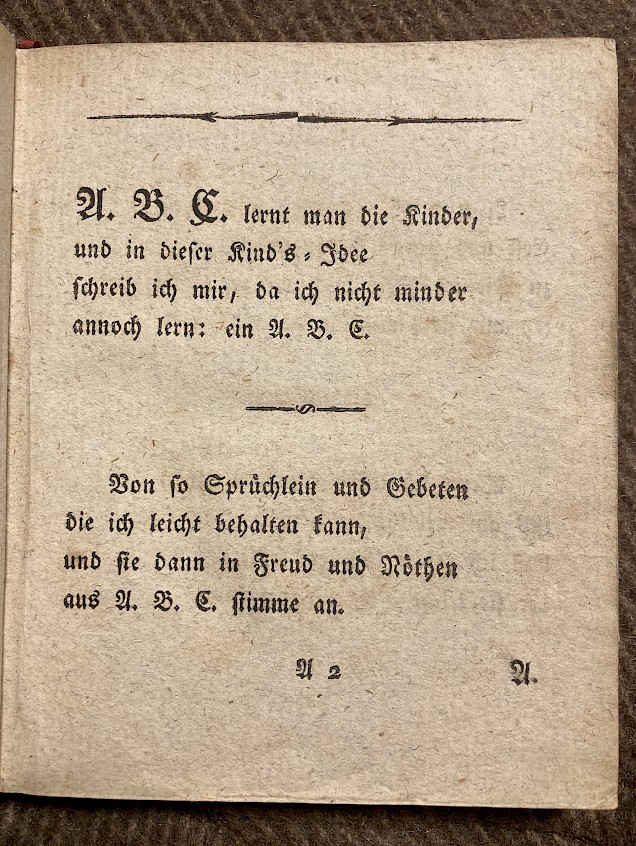
Abb. 6.
Mit bestem Dank an Daniel Thierstein,
A. M. aus B.,
M. A., o. Dr.
Hotel Kleber Post - Die Gruppe 47 in Saulgau - Texte & Resonanzen
Der Titel des Buches ist aus einem Gedicht von Günter Eich: „Dorthin gehen, wo die Parallelen sich schneiden.“ Ein Paradox, denn Parallelen schneiden sich nicht. Erst in der Unendlichkeit und die ist weit weg. Oder ganz nah. In den geistigen Räumen in uns. Hier können wir Menschen begegnen, die zu einer anderen Zeit und an einem anderen Ort gelebt haben. Ein Wort berührt uns, ein Satz lässt uns nicht los, nistet sich ein, wird zur Zikade, wie Osip Mandelstam in seinem Gespräch über Dante schreibt: „Ein Zitat ist keine Abschrift. Ein Zitat ist eine Zikade. Es läßt sich nicht zum Schweigen bringen. Hat es sich erst eingestimmt, hört es nicht mehr auf.“
Die Literatur ist ein riesiger Resonanzraum, hier können wir Menschen begegnen, die in einer anderen Zeit und an einem anderen Ort gelebt haben. Weil wir, wie es Hölderlin formuliert, nicht nur Gespräche führen, sondern ein Gespräch sind. Katrin Seglitz hat 14 Schriftstellerinnen und Schriftsteller gebeten, auf einen Text aus der Gruppe 47 mit einem eigenen Text zu antworten. Ein reichhaltiges, sehr schön gestaltetes Buch ist entstanden. Die Lektüre ist ein Abenteuer. Sie ermöglicht die Wiederentdeckung von Texten der Gruppe 47, aber auch Einsichten in die unterschiedliche Art und Weise, zu ihnen in Resonanz zu gehen: kurz und knapp, ausführlich und verschachtelt, experimentell oder essayistisch.
Katrin Seglitz: "In seinem Buch Abschied von den Eltern nennt Peter Weiss seine Eltern die Portalfiguren seines Lebens, deren Bedeutung er nur schwer fassen könne. Zu den Portalfiguren meines Lebens als Leserin und Schriftstellerin gehören viele, die regelmäßig an den Treffen der Gruppe 47 teilgenommen haben. Ihre Texte haben mich berührt. Ich wollte antworten. Das scheint mir einen guten Text auszuzeichnen: dass wir lesend in einen inneren Dialog treten mit dem Autor, der Autorin.
Als ich erfuhr, dass die Inhaber des Hotels Kleber Post ein Buch zur Gruppe 47 in Saulgau planten, dachte ich an den dialogischen Charakter des Lesens. Ich schlug vor, Kolleginnen und Kollegen zu bitten, auf einen Text aus der Gruppe 47 mit einem eigenen Text zu antworten. Vierzehn Autorinnen und Autoren sind auf meinen Vorschlag eingegangen, ihre Texte sind in diesem Buch versammelt."
Es sind dies folgende Paarungen:
- Günter Eich - Walle Sayer
- Ilse Aichinger - Beate Rothmaier
- Helmut Heißenbüttel - Zsuzsanna Gahse
- Gisela Elsner - Hermann Kinder
- Peter Weiss - Wolfgang Hermann
- Hubert Fichte - Peter Braun
- Konrad Bayer - Bernadette Ott
- Alexander Kluge - Felicitas Andresen
- Johannes Bobrowski - Reiner Niehoff
- Günter Grass - Nora Gomringer
- Ingeborg Bachmann - Heribert Kuhn
- Martin Walser - Peter Blickle
- Otl Aicher - Thommie Bayer
- Günter Eich - Volker Demuth
"Die Autoren und Autorinnen der Gruppe 47 haben einen blauen Hintergrund bekommen, die Resonanz-Autoren einen schwarzen, die einen Texte sind blau gesetzt, die anderen schwarz. Ich habe eine Zeile, einen Satz oder ein Wort als Überschrift für diese geistigen Paarungen gewählt."


Die legendäre 25. Tagung der Gruppe 47 hat 1963 in der Kleber Post stattgefunden. Auf Seite 12 finden Sie die Gästeliste von Hans Werner Richter, aufgeführt sind über hundert Gäste. Wenn Texte gelesen werden, sitzt man(n) dicht an dicht. Tatsächlich sind viel mehr Männer da als Frauen, wie man in der Dokumentation von Sebastian Haffner sehen kann. Er hat 1963 einen Film über die Tagung gedreht, Schriftsteller*innen interviewt und Hans Werner Richter. Sie können sich das auf YouTube anschauen.

Gästeliste von Hans Werner Richter zu der Tagung 1963.
Die Vorgeschichte der Gruppe 47 beginnt im Krieg. Alfred Andersch und Hans Werner Richter sind Gefangene auf Rhode Island und arbeiten am Ruf mit, einer Zeitung für deutsche Kriegsgefangene in den USA. Als sie zurück in Deutschland sind, planen sie eine Fortsetzung. In der Nähe von München entsteht die erste Nummer des neuen Rufs, Untertitel: Blätter der jungen Generation.
Der Schriftsteller Walter Kolbenhoff erinnert sich: „Wenn ich es mir so überlege, bin ich, gleich nach der Gefangenschaft mit Hans Werner Richter, ungezählte Kilometer durch die Stadt München gewandert, und zwar meist nachts. Das war so: der eine brachte den anderen nach Hause. Und weil wir so tief in der Diskussion über die Zukunft Deutschlands waren und damit nicht aufhören konnten, brachte der eine den anderen wiederum nach Hause.“
Im Hungerwinter 1946/47 sitzt Richter frierend am Küchentisch und schreibt Leitartikel, Glossen und Reportagen. Der Ruf verkauft sich gut. Die Auflage der vierten Nummer liegt bei hunderttausend Exemplaren. Dann kommt die erste Kritik an der Ausrichtung der Zeitung, der amerikanischen Besatzung ist der Ruf zu links. Die 17. Ausgabe kann nicht mehr erscheinen, Richter und Andersch wird die Lizenz entzogen. Große Enttäuschung bei den Herausgebern. Die Höhe der Auflage hat deutlich gezeigt, wie groß das Bedürfnis nach Auseinandersetzung und Orientierung ist. Richter beginnt, Beiträge für eine literarische Zeitschrift zu sammeln, Skorpion soll sie heißen. Anfang September 1947 lädt er ein nach Bannwaldsee bei Füssen, um über die Texte zu diskutieren. Auf die Einladungskarten schreibt er: „Wir können baden, vorlesen, uns unterhalten und einmal ausspannen.“
Sechzehn Schriftstellerinnen und Schriftsteller treffen sich im Haus von Ilse Schneider-Lengyel. Sie hocken im Kreis, die meisten auf dem Boden, und hören gespannt zu, wenn jemand auf dem Stuhl neben Richter Platz nimmt. Der Erste ist Wolfdietrich Schnurre. Er liest eine Erzählung, die vom Begräbnis Gottes handelt. Nach der Lesung sagt Richter: „Ja, bitte zur Kritik. Was habt ihr dazu zu sagen?“ Schnurre muss die Kritik ohne Kommentar über sich ergehen lassen, im Mittelpunkt steht der Text. Der Vorgang wird zum Ritual und der Stuhl neben Hans Werner Richter zum elektrischen Stuhl, wenn der Text verrissen wird. Richter schreibt: „Ich habe diese Radikalität gefördert als Reaktion auf die kritiklose Zeit der Diktatur.“
Die Lizenz für den Skorpion wird nicht erteilt. Trotzdem treffen sich die Schriftstellerinnen und Schriftsteller schon sechs Wochen später wieder, diesmal in Herrlingen bei Ulm. Der Schriftsteller Georg Brenner schlägt vor, die Gruppe nach dem Jahr ihres ersten Treffens zu benennen, Richter spricht seitdem von der Gruppe 47. Was die Teilnehmer verbindet, ist die Suche nach einer neuen Sprache. Man will nichts mehr zu tun haben mit den pathetischen Wendungen der Nazis, mit Floskeln und Worthülsen. Man hat aber auch genug von der bürgerlichen Kunstsprache, dem schönen Satz, der gepflegten Sprache, der stilisierten Schönschreibekunst, wie Richter schreibt.
Er unterbindet politische Diskussionen, sie finden nur in den Pausen statt. Er ist davon überzeugt, dass sie die Gruppe zerstört hätten. „Zu viele verschiedene Temperamente, Anschauungen, Überzeugungen mußten unter einem Hut zusammengehalten werden, und gerade hier, in der Zusammenfassung dieser Vielzahl – ein Kollektiv von Individualisten – lag die Ausstrahlungskraft der Gruppe 47.“
Schon bald wird aus einem Freundeskreis mit kollegialen Auseinandersetzungen über Texte eine Veranstaltung, zu der ab 1952 auch Verleger und Literaturkritiker kommen. Die Gruppe 47 wird als Geburtshelferin für eine zeitgemäße und demokratische Kultur empfunden. Zur medialen Aufmerksamkeit trägt auch der Preis der Gruppe 47 bei. Günter Eich erhält ihn 1950 als erster. Unter den Preisträgern sind Heinrich Böll, Ilse Aichinger, Ingeborg Bachmann, Martin Walser und Günter Grass. 1962 wird er Johannes Bobrowski zugesprochen, während der Tagung der G47 am Wannsee in Berlin. Dass Richter nach Berlin eingeladen hat, war auch eine politische Entscheidung nach dem Mauerbau im August 1961. Der SPIEGEL widmete dem Treffen eine umfangreiche Titelgeschichte. Und hat, obwohl das den internen Riten zuwiderlief, öffentlich gemacht, wann und wo die Tagung stattfinden würde.
Hans Werner Richter sah sich mit Einladungswünschen überrannt. Und formulierte ärgerlich: „Ich bin keine Einladungsmaschine, die G47 keine Institution und kein Schriftstellerverband, sondern eine höchst private Angelegenheit. Das soll sie bleiben und muß sie bleiben, sonst gibt es sie morgen nicht mehr.“
Während der Tagung wird der SPIEGEL-Herausgeber Rudolf Augstein verhaftet. Er hatte über ein NATO-Manöver berichtet und angeblich militärische Geheimnisse ausgeplaudert. Ihm wurde Landesverrat vorgeworfen. Einige Autoren schickten ein Solidaritätstelegramm an ihn. Die Verhaftung wurde als Eingriff in die Pressefreiheit verstanden, eine Protestresolution verfasst und der Rücktritt von Franz Josef Strauß gefordert, der Verteidigungsminister war und die Verhaftung angeordnet hatte.
Nach dem turbulenten Treffen in Berlin lädt Hans Werner Richter ein Jahr später nach Saulgau ein. Er wünscht sich eine Tagung, wie sie früher war: ohne so viele Zaungäste, ohne so viele Journalisten und Verleger, und er versucht auch halbherzig, die Rolle der Kritiker einzuschränken. Was aber nicht gelingt, die Dynamik der Treffen hat sich längst verselbständigt. Auch in Saulgau werfen sich Walter Höllerer und Walter Jens die Bälle zu, Joachim Kaiser und Fritz J. Raddatz, Marcel Reich-Ranicki und Hans Mayer. Nur vereinzelt meldet sich ein Autor zu Wort.
Vier Jahre später im Oktober 1967 werden die Teilnehmer der G47 in der Pulvermühle als Papiertiger beschimpft, die Gruppe 47 sei Teil des kulturellen Establishments. Richter lädt zehn Jahre nicht mehr ein. Erst 1977 wieder. Und dann erneut in die Kleber Post, zum offiziell letzten Treffen. Die Gruppe 47 wird zu Grabe getragen, aber die Freundschaften bestehen weiter.
Schon ein Jahr später feiert Richter seinen 70. Geburtstag in Saulgau. Die Eingeladenen schenken Texte, Günter Grass Das Treffen in Telgte, in dem er ein Schriftstellertreffen im Jahr 1647 beschreibt. Das Buch beginnt mit den Worten: „Gestern wird sein, was morgen gewesen ist. Unsere Geschichten von heute müssen sich nicht jetzt zugetragen haben. Meine beginnen viel früher.“ Hans Werner Richter hat auch 1979, 1983 und 1988 anlässlich seiner Geburtstage nach Saulgau eingeladen, insgesamt sechs Mal. Freunde kommen, viele haben regelmäßig an den Tagungen der G47 teilgenommen. Die Treffen sind gut dokumentiert, Eva Hocke hat Fotostreifen in das Buch eingebaut. Seitdem verbindet sich der Name des Hotels Kleber Post auch mit der Gruppe 47.
Kathrin Seglitz, Ravensburg
Dorthin gehen, wo die Parallelen sich schneiden. Die Gruppe 47 in Saulgau
Texte & Resonanzen. Hg. von Katrin Seglitz. Hardcover, Lesebändchen, mit farbigen Illustrationen, 287 Seiten (Verlag osbert+spenza Peter Albrecht, Immenstaad)
ISBN 978-3-947941-03-2
Im Herbst der rosaroten Ipê-Bäume
Die einarmige Harfenistin von São Paulo
«Seit vierhundert Jahren kocht und gärt es in der ungeheuren Retorte dieses Landes, immer wieder umgeschüttelt und mit neuem Zusatz versehen, die menschliche Masse. Ist dieser Prozess nun endgültig beendet, ist diese Millionenmasse schon Eigenform, Eigenstoff geworden, eine neue Substanz?», fragt sich Stefan Zweig in seinem Buch Brasilien: ein Land der Zukunft (1). Martin Stieglitz, Hauptperson und Alter Ego des Autors im Roman von Luis Krausz, meint dazu: «Stefan Zweig sagt, Brasilien sei ein grosser Schmelztiegel, wo sich die Rassen mischen und sich das Rassenproblem von selbst löst (…) Stefan Zweig ist ein Optimist» (2).
In diesem neuen Roman von Luis Krausz begleiten wir Martin Stieglitz, den Erben einer europäischen Familie aus der ehemaligen Donaumonarchie, die vor den Nazis nach Brasilien geflohen ist, auf seinen Wegen durch die Megacity São Paulo. Martin Stieglitz liebt es, durch die Straßen des Jardim Europa zu spazieren, die Gartenstadt, wo er in der Rua Suíça wohnt. Der Roman gliedert sich in zwei Teile – eine Gegenwart voller Gefahren und eine verklärte Vergangenheit unter dem Doppeladler, die mit der Zeit immer mehr verblasst.
Das Viertel Jardim Europa spielt im Leben des Protagonisten eine dominante Rolle. Beim Durchstreifen dieser Straßen bewahrt er sich seine Erinnerung an Europa und seine Kultur, bestehend aus klassischer Musik, der Kunst der Avantgarde und der Literatur aus der Zeit der Habsburger, die ledergebunden in seiner Bibliothek, genannt Stübchen, auf ihn wartet, sobald der Herbst naht. Martin Stieglitz ist eine Art Streetwalker auf den Spuren von Charles Baudelaire, der aber nicht durch die Passagen von Paris schlendert, sondern durch das Gartenviertel einer chaotischen, bedrohlichen Megalopolis in Südamerika: „Martin Stieglitz ist ein Stadtwanderer, ein flâneur, der durch die Straßen seines idyllischen Viertels Jardim Europa spaziert, mitten in der pulsierenden und chaotischen Megacity São Paulo. Gleichzeitig spaziert er durch die Mäander seiner Erinnerung, teils selbst erlebt, teil ererbt von seinen Vorfahren, jüdischen Einwanderern aus Deutschland, Österreich und Ungarn, Ländern, in denen sie glaubten, für immer zuhause zu sein“, sagt Luis Krausz in einem Interview (3): „In Brasilien angekommen, versuchten diese Immigranten, so viel wie möglich von ihrem Erbe zu bewahren, was sich als unmöglich erwies. Nicht von ungefähr erbauten sich die Vorfahren von Martin Stieglitz ihr Haus in der Rua Suíça, im Jardim Europa. Der Roman thematisiert die Illusion der Zugehörigkeit und des Exils und zugleich den Schmerz und die Angst vor dem Niedergang einer Kultur, die heute völlig unzeitgemäß ist.“ Verkörpert wird dieses europäische Erbe durch das sogenannte Stübchen, ein Zimmer voller Erinnerungsstücke: eine silberne Zigarettendose, ein gerahmtes Bild von Kaiser Joseph II., eine Meerschaumpfeife sowie ein durch vielen Gebrauch abgenutzter Wiener Straßenbahn-Ausweis von 1909. Während Martin Stieglitz den Jardim Europa durchstreift, eine Zwischenwelt, die zwar Europa heißt, aber in Brasilien liegt, sinniert er über ein Buchprojekt nach, genannt Das heimliche Museum, in dem alle Erinnerungsstücke ihren Platz finden sollen.
„Europa war Herrscher über eine Welt, die mittlerweile verschwunden ist“, schreibt der portugiesische Historiker Pedro Jordão (4). „Zusammen mit Nordamerika dominierte es das 20. Jahrhundert. Das Gravitationszentrum der Weltmacht war der Nordatlantik, Jetzt verlagert sich dieses Gravitationszentrum in den Pazifik, weg von Europa.“
Während der erste Teil des Romans, Die unsichtbare Stadt, der Introspektion des Protagonisten gewidmet ist, steht im zweiten Teil, Die sichtbare Stadt, eine Party im Haus des steinreichen Marchand de Tableaux Martin Fuchs im Vordergrund. Das Erbe der europäischen Kultur wird zur Ware, die Sicherheit einer Gated Community beherrscht die Szene. Bei diesem Empfang wird deutlich, wie sehr Martin Stieglitz eine Rara avis ist, mit seiner Vorliebe für die Musik, die Literatur und die Erinnerung. Nicht von ungefähr spielt der Roman im Herbst, einer Jahreszeit, auf die in Europa der Winter folgt, wenn auch nicht in Brasilien.
Die Spaziergänge durch die Gartenstadt im Herzen von São Paulo enden im Jardim Paulistano vor einer seltsamen Skulptur: es ist eine einarmige Harfenistin: die Linke hält das Instrument, die Rechte greift ins Leere – ein abgründiges Symbol für den Niedergang der europäischen Kultur.
„Ich weiß, dass ich viele Dinge verloren habe, dass ich nicht in der Lage wäre, sie alle aufzuzählen, dass diese Verluste alles sind, was mir geblieben ist“, schreibt Jorge Luis Borges in Los conjurados (5). „Es gibt keine anderen Paradiese als die verlorenen Paradiese.“ Nun eröffnet in diesen Tagen das Zentrum Paul Klee seine große Ausstellung Brasil! Brasil! Aufbruch in die Moderne – der richtige Zeitpunkt, um auch diesen ausgezeichneten Roman von Luis Krausz ins Deutsche zu übersetzen.
Albert von Brunn, Zürich
Luis Krausz, O outono dos ipês-rosas, Recife: Cepe Editora, 2024.
(1) Zweig, Stefan. Brasilien: ein Land der Zukunft. Stockholm: Bermann-Fischer Verlag, 1941, S. 142.
(2) Krausz, Luis. O outono dos ipês-rosas, Recife: Cepe Editora, 2024, S. 139.
(3) Augusto, Eduardo. “Memórias preservadas no ato de caminhar por SP” in: A União/João Pessoa 18. Juni 2024, S. 11.
(4) Jordão, Pedro. “Kontinent im Niedergang” in: Neue Zürcher Zeitung 6. August 2024, S. 18.
(5) Borges, Jorge Luis. « Possession de l’hier » in : Œuvres complètes, ed. Jean Pierre Bernès. Paris : Gallimard, 2010, Vol. II, S. 945.
Generationen von Schweizer Kindern sind mit Martha Pfannenschmids Illustrationen zu Johanna Spyris Klassiker Heidi in den Sammelbänden des Silva-Verlags aufgewachsen. Auch ihre Version des Pinocchio im selben Verlag hat viele Kindheiten begleitet. Doch wer war Martha Pfannenschmid, die Illustratorin dieser Bilder? Zum 25. Todestag der Künstlerin spürt die Publikation anhand von Originalzeichnungen, Skizzen, Büchern und Dokumenten dem Phänomen «Heidi» ebenso nach wie den weiteren Arbeiten Pfannenschmids von den 1920er- bis 1980er-Jahren (Abb. 1). Sie ermöglicht ein Eintauchen in die gesamte Bilderwelt der Illustratorin, die auch malte oder als Zeichnerin bei der Basler Fasnacht die Schnitzelbanksänger in schnellen Strichen festhielt.
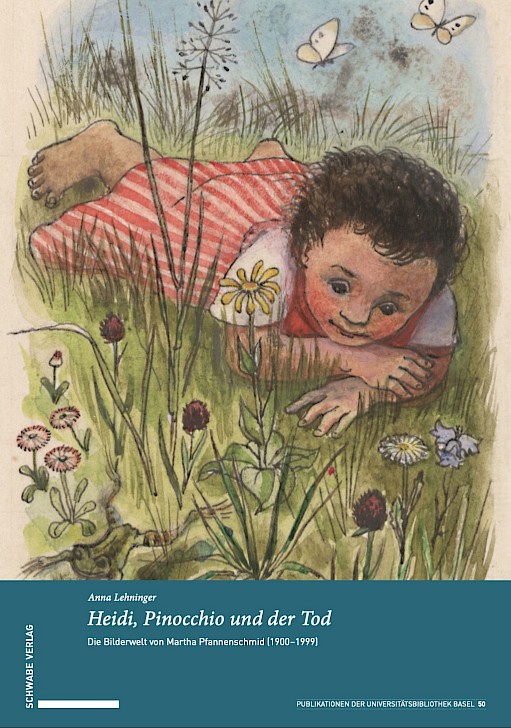
Abb. 1: Anna Lehninger, Heidi, Pinocchio und der Tod. Die Bilderwelt von Martha Pfannenschmid (1900–1999). Publikationen der Universitätsbibliothek Basel, Bd. 50, Basel-Berlin: Schwabe Verlag, 2024.
Heidi und Pinocchio zum Sammeln
Im Jahr 1944 erschien in der Schweiz eine besondere Ausgabe von Johanna Spyris Klassiker Heidi (Abb. 2): Mitten im Zweiten Weltkrieg hatte der Zürcher Silva-Verlag Martha Pfannenschmid beauftragt, 121 kleinformatige Aquarelle für ein Sammelalbum zu gestalten. 1946 folgte der zweite Band mit 120 weiteren Sammelbildern zum Einkleben. Entstanden ist einer der bemerkenswertesten kommerziellen und ästhetischen Kinderbucherfolge des 20. Jahrhunderts in der Schweiz. Ihr miniaturhafter Zeichenstil und die akribische Hintergrundrecherche zu den Illustrationen prägten nicht nur das Bild von Heidi in der Schweiz, sie waren auch eine wichtige Inspirationsquelle für die japanische Heidi-Fernsehserie von 1974.
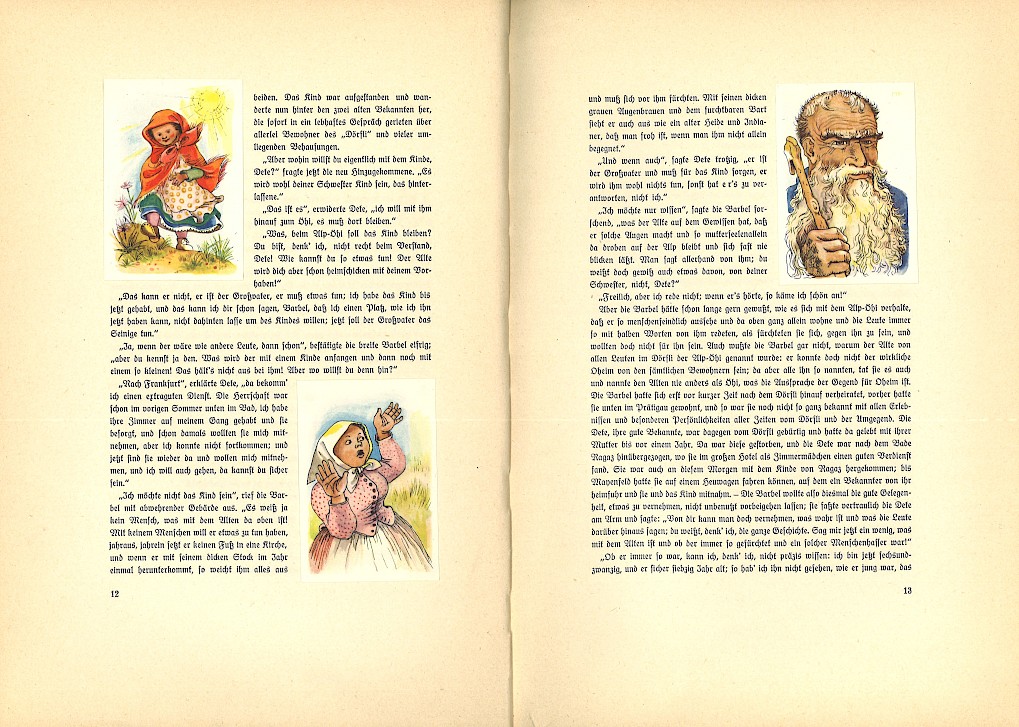 Abb. 2: Johanna Spyri, Heidis Lehr- und Wanderjahre. Eine Geschichte für Kinder und solche, die Kinder liebhaben, mit 121 Bildern von Martha Pfannenschmid, Zürich, Verlag Silva-Bilderdienst, 1944, Doppelseite.
Abb. 2: Johanna Spyri, Heidis Lehr- und Wanderjahre. Eine Geschichte für Kinder und solche, die Kinder liebhaben, mit 121 Bildern von Martha Pfannenschmid, Zürich, Verlag Silva-Bilderdienst, 1944, Doppelseite.
Über 20 Jahre nach dem Erfolg von Heidi gestaltete Martha Pfannenschmid ein weiteres Kinderbuch für den Silva-Verlag: Pinocchio (Abb. 3). Den 60 Illustrationen sind hunderte Entwurfszeichnungen vorausgegangen, welche die jahrzehntelange Auseinandersetzung Pfannenschmids mit kunsthistorischen Vorbildern von der Renaissance bis ins 19. Jahrhundert dokumentieren. In leuchtender Farbenpracht erzählt Pfannenschmid die Geschichte von der eigensinnigen Holzpuppe.
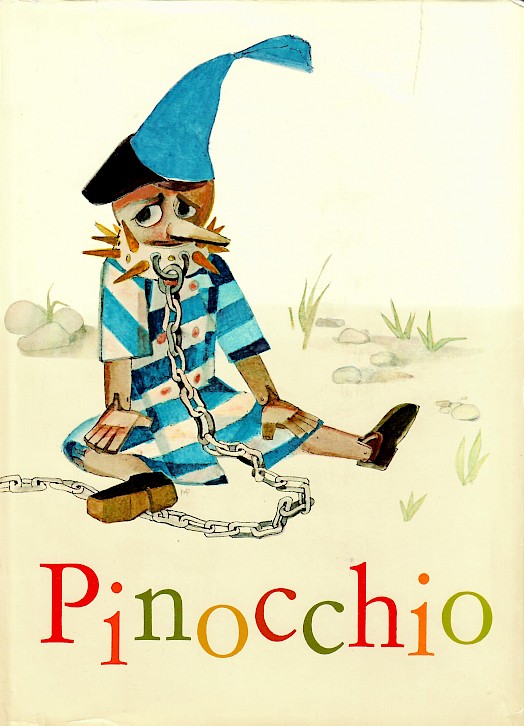
Abb. 3: Carlo Collodi, Pinocchios Abenteuer. Eine Geschichte, die vor mehr als hundert Jahren in Italien passierte, mit 60 Bildern von Martha Pfannenschmid, Zürich: Silva Verlag, 1968, Schutzumschlag.
Zwischen wissenschaftlicher Zeichnung und Kinderbuchillustration
Martha Pfannenschmid ist zwar in erster Linie als Illustratorin für Kinder bekannt, hauptberuflich war sie aber von 1925 bis 1960 am Rechtsmedizinischen Institut in Basel als wissenschaftliche Zeichnerin tätig. Vor allem schuf sie dort grossformatige Lehrtafeln über Todesursachen oder Verwesungsstadien für die Studierenden, ausserdem illustrierte sie Fachpublikationen der Professoren am Institut. Ihr Wissen zu Anatomie, Medizin und zur Darstellung verschiedener Todesarten nutzte sie wiederum in ihren Illustrationen für die Kinderseite der Basler National-Zeitung, für das Schweizerische Jugendschriftenwerk und ebenso für Heidi und Pinocchio und bebilderte so auch Aspekte wie Unfälle von Kindern (Abb. 4) oder Todesdarstellungen.
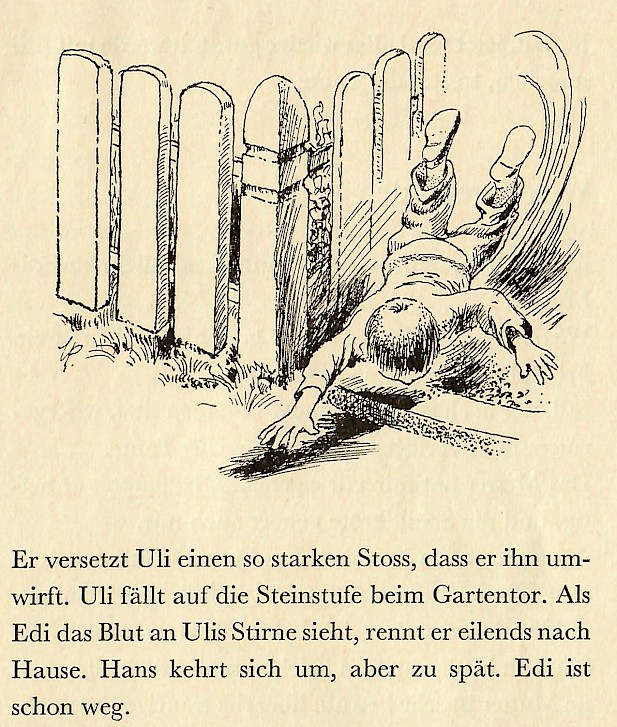
Abb. 4: Margrit Ryser, Ulis Ferien, Umschlagbild und Zeichnungen Martha Pfannenschmid, SJW für die Kleinen, Nr. 574, Zürich: Schweizerisches Jugendschriftenwerk, 1956, S. 137.
Alte Meister und neue Gestaltungswege
Für Ihre Illustrationen griff Pfannenschmid auch auf ihr Studium der alten Meister zurück und orientierte sich an Werken von Simone Martini bis Carl Spitzweg, die sie mit minutiöser Präzision in ihre Bilder einbrachte. Ihre Heidi-Illustrationen und Pflanzenbilder aus den 1950er-Jahren sind von leuchtender Farbenpracht und weisen die Künstlerin als geschickte Farbkomponistin zur Erzeugung von Stimmung wie auch als wissenschaftlich korrekte Beobachterin aus. Schliesslich hat Pfannenschmid auch die dreidimensionale Form erkundet, indem sie 1981 ein Osterei als Kartonverpackung für das Basler Läckerli-Huus mit einer Darstellung der Arche Noah gestaltete.

Abb. 5: Karton-Ei von Martha Pfannenschmid für das Läckerli-Huus, 1981, Werbepostkarte, Schweizerisches Institut für Kinder- und Jugendmedien, Zürich.
In der reich bebilderten Publikation, die in der Schriftenreihe der Universitätsbibliothek Basel erscheint, werden einzelne Schaffensperioden und Werkgruppen der Künstlerin vorgestellt und so Bekanntes und Unbekanntes in Beziehung gesetzt. Dabei werden chronologische und inhaltliche Überschneidungen im Schaffen der Künstlerin sichtbar gemacht, die zeitlebens im Spagat zwischen Brotberuf und freier künstlerischer Arbeit stand. Pfannenschmid war auch als Malerin aktiv und nahm an nationalen und internationalen Kunstausstellungen teil. Ihre Werke befinden sich neben dem Nachlass in der Universitätsbibliothek Basel in zahlreichen Schweizer Archiven, Bibliotheken und Museen und werden in der Publikation erstmals versammelt.
Anna Lehninger, Zürich
---
Anna Lehninger, Heidi, Pinocchio und der Tod. Die Bilderwelt von Martha Pfannenschmid (1900–1999) Publikationen der Universitätsbibliothek Basel, Bd. 50, Basel-Berlin: Schwabe Verlag, 2024. 160 Seiten, 185 Abbildungen. CHF 37.00. ISBN 978-3-7965-5169-7.
https://schwabe.ch/anna-lehninger-heidi-pinocchio-und-der-tod-978-3-7965-5169-7
Geschichten von unseren Großeltern
30 Autorinnen und Autoren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, Schriftstellerinnen und Schriftsteller, aber auch Menschen aus anderen Berufen, erzählen in diesem gerade erschienenen Buch vom Leben ihrer Großväter und Großmütter. Die Erinnerungen aus dem Blickwinkel der Enkel zeigen den emotionalen, manchmal auch traumatischen Nachhall der Großelterngeneration über die Generationsgrenzen hinweg. Facettenreich und berührend spiegelt sich in ihnen das bewegte 20. Jahrhundert mit all seinen Höhen und Tiefen. Entstanden ist eine Sammlung sehr persönlicher, unter die Haut gehender Geschichten, wie sie in keinem Geschichtsbuch zu finden sind.
Zur Entstehung und zum Inhalt des Buches
Am Anfang stand der Corona-Lockdown. In dieser Zeit des erzwungenen Stillstands begann der Herausgeber des Buches, die Geschichte seiner süddeutschen Großväter aufzuschreiben. Er wollte ihr bewegtes Leben, vor allem während des Nationalsozialismus, festhalten und das Erinnerte innerhalb der Familie weitergeben. Der Gedanke an eine Publikation lag ihm fern. Die niedergeschriebene Geschichte seines Großvaters mütterlicherseits hat er anschließend an einige Freunde und ihm nahestehende Bekannte geschickt.
Da geschah etwas völlig Unerwartetes. Der Text wirkte bei den Adressatinnen und Adressaten wie ein Auslöser, sich ihrerseits zu erinnern, und sie erzählten ihm, unaufgefordert und spontan, von ihren eigenen Großvätern und Großmüttern. Es war, als träfe seine Geschichte einen Nerv, als öffnete sie ein verschlossenes Ventil. Lange Verschüttetes kam zutage, Berührendes, historisch Interessantes, aber auch Schmerzhaftes. Innerhalb kurzer Zeit entstand die Idee, diese Geschichten über die »vorletzte Generation« zu sammeln und zu publizieren. Er fragte gezielt Schriftstellerinnen und Schriftsteller, aber auch Menschen aus anderen Berufen an, ob sie sich an diesem Projekt beteiligen wollten – und die meisten haben begeistert zugesagt. Der Stein, den er ins Wasser geworfen hatte, schlug Wellen. Selbst Menschen, die durch andere von dem Projekt erfuhren, fragten von sich aus an, ob sie ihre Geschichte beisteuern dürften. Auf diese Weise kamen die dreißig Geschichten zusammen, die in diesem Buch versammelt sind.
Die Großväter und Großmütter, die im Mittelpunkt der Erzählungen stehen, lebten im 20. Jahrhundert mit all seinen Höhen und Tiefen. Und es zeigt sich, dass kaum eine der Geschichten ausschließlich privat sein kann, sondern dass die gesellschaftlichen Bedingungen und politischen Umstände immer in das private Leben hineinwirkten.
Das Verhältnis der erzählenden Enkelkinder zu ihren Großeltern ist ganz unterschiedlich, es reicht von Zuneigung und Verbundenheit über Bewunderung bis hin zu Ablehnung und Hass. Selbst wenn ein Enkel erst nach dem Tod des Großvaters oder der Großmutter geboren wurde oder diese nur als kleines Kind erlebt hat, wirkt das Leben der Großeltern bewusst oder unbewusst in der Enkelgeneration weiter.
Viele Geschichten sind Ausdruck des Versuchs, sich in fortgeschrittenem Alter zu erinnern beziehungsweise die noch vorhandenen eigenen und fremden Erinnerungen zusammenzutragen, ein Versuch, der nicht selten in Ernüchterung endet, im Bedauern, die Großeltern nicht über ihr Leben, ihre Erfahrungen und Erlebnisse befragt zu haben, solange das noch möglich war. In einigen Erzählungen ist auch vom Schweigen in der Familie die Rede, welches durch das Niederschreiben der Geschichte durchbrochen wird.
Die Autorinnen und Autoren kommen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Da ihre Großeltern zum Teil aber in anderen Ländern lebten, finden sich im Buch auch Geschichten aus Italien, Frankreich, Polen, Tschechien, Ungarn, der Ukraine, Israel, Pakistan und der DDR. Und es zeigt sich, dass die Krisen des 20. Jahrhunderts, in erster Linie die beiden Weltkriege, der Holocaust, Flucht und Vertreibung, in den verschiedenen Ländern zu ganz unterschiedlichen Schicksalen führten.
Die Vielfalt des Buches ergibt sich auch aus den unterschiedlichen Berufen der Autorinnen und Autoren. Viele von ihnen sind Schriftstellerinnen und Schriftsteller. Daneben finden sich aber auch Schauspieler, Mediziner oder Menschen aus ganz anderen Kontexten. Die unterschiedlichen Herangehensweisen und Ausdrucksformen machen die Lektüre des Buchs abwechslungsreich und spannend.
Die Geschichten sind authentisch, persönlich und gehen unter die Haut. In einer Zeit der Geschichtsvergessenheit und tiefgreifender politischer Veränderungen tut Rückbesinnung not. Daher sind diese Erinnerungen, die in keinem Geschichtsbuch zu finden sind, wichtig und, wenn man so will, zeitlos aktuell.
Das Cover von Hannes Binder
Die Zeichnung auf dem Einband stammt von dem mehrfach ausgezeichneten Schweizer Comiczeichner, Illustrator und Maler Hannes Binder (*1947) und wurde extra für dieses Buch entworfen, und zwar in der für ihn typischen Schabkarton-Technik und dem für ihn charakteristischen surrealistischen Stil.
Die Autorinnen und Autoren
Fabio Andina (CH), Esther Banz (CH), Nelio Biedermann (CH), Sabine Bierich (D/CH), Zora del Buono (CH/D), Alex Capus (CH), Verena Dolovai (A), Daniela Engist (D), Oded Fluss (ISR/CH), Romana Ganzoni (CH), Roswitha Gassmann (CH), Alice Grünfelder (D/CH), Gottfried Hornberger (D), Waseem Hussain (PAK/CH), Markus Knapp (D), Andreas Kossert (D), Martin Kunz (CH), Hanspeter Müller-Drossaart (CH), Christa Prameshuber (A/CH), Helmut Puff (D/USA), Klemens Renoldner (A), Christian Ruch (D/CH), Ariela Sarbacher (CH), Thomas Sarbacher (D/CH), Herrad Schenk (D), Gerrit Schneider-Lastin (DDR/CH), Wolfram Schneider-Lastin (D/CH), André Seidenberg (CH), Ruth Werfel (CH), Anke Winter (D/CH)
Wolfram Schneider-Lastin (Hg.), Fragen hätte ich noch. Geschichten von unseren Großeltern, Zürich: Rotpunktverlag 2024. 256 Seiten, 21.5 × 14.5 cm, Gebunden. ISBN 978-3-03973-039-1, 1. Auflage.
mit Illustrationen von Hans Ticha
Bücher, überall liegen Bücher
Die Halde ist meterhoch, mehrere Meter hoch. Bücherberge liegen vor uns. Wir besteigen sie und wandern über die Bücherlandschaft. Die einzelnen Exemplare sind nicht verrottet, im Gegenteil, sie sind nagelneu, in Folie geschweißt oder von Packpapier umhüllt.
Ein Zeitungsartikel in der Osterländer Volkszeitung hat uns darauf aufmerksam gemacht, dass jede Menge Bücher auf die Müllhalde gefahren worden seien. S., der am Altenburger Landestheater Regieassistent ist, holt mich ab. Ich bin als Schauspielerin am Landestheater Altenburg unter Vertrag. Den Artikel in der Hand schwenkend sagt er: “Wir müssen Bücher retten.”
Mit dem Auto, einem blauen Trabant, fahren wir also im Jahr 1991 zur Müllhalde in Plottendorf, am Wasserschloss von Windischleuba vorbei über die von Schlaglöchern gezeichnete und von Obstbäumen gesäumte Landstraße Richtung der Landesgrenze Thüringen/Sachsen. (Google Maps sagt, die Fahrt von Altenburg nach Plottendorf dauerte 13 Minuten mit dem Auto.)
Fassungslos stehen wir auf den Bücherbergen. Wir reißen die Bücher aus ihren Verpackungen. Das Lied der Mittagsfee, mit Noten und wunderschönen Zeichnungen, auch das illustrierte Buch Bei der Feuerwehr wird der Kaffee kalt entdecke ich dort, meine Kinder haben es später geliebt. Stopfkuchen von Wilhelm Rabe vom Union Verlag Berlin, eine Biografie von Ingmar Bergmann vom Verlag Volk und Welt Berlin, ebenso Der Liebhaber von Marguerite Duras und viele mehr. Last but not least finden wir Der Krieg mit den Molchen von Karel Čapek vom Aufbau-Verlag Berlin und Weimar, eingeschlagen in einen Schutzumschlag aus bedrucktem Pauspapier, schön gebunden und mit vielen bunten Illustrationen versehen.

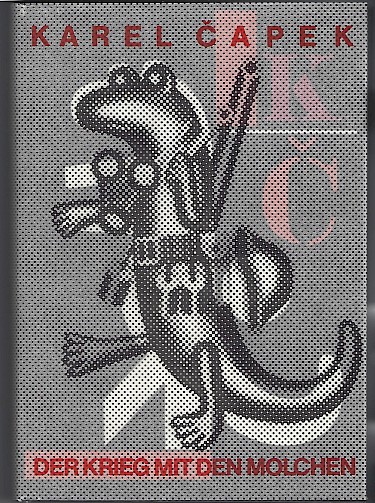

Der Roman besteht aus drei Büchern: Erstes Buch, Andrias Scheuchzeri, Zweites Buch, Stufe um Stufe zur Zivilisation und Drittes Buch, Der Krieg mit den Molchen.
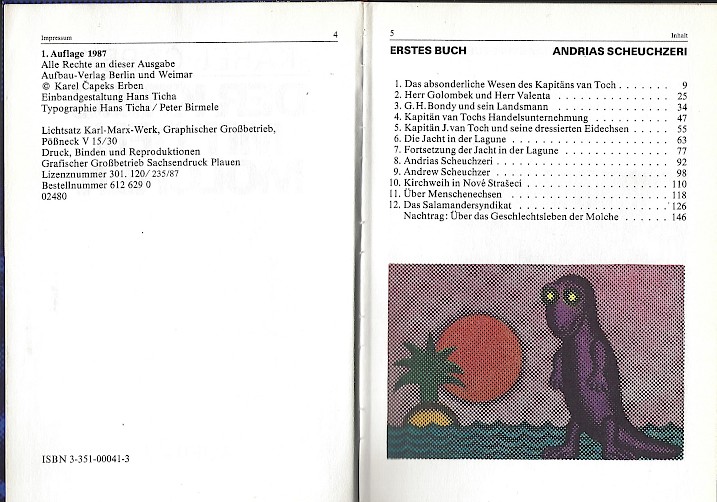
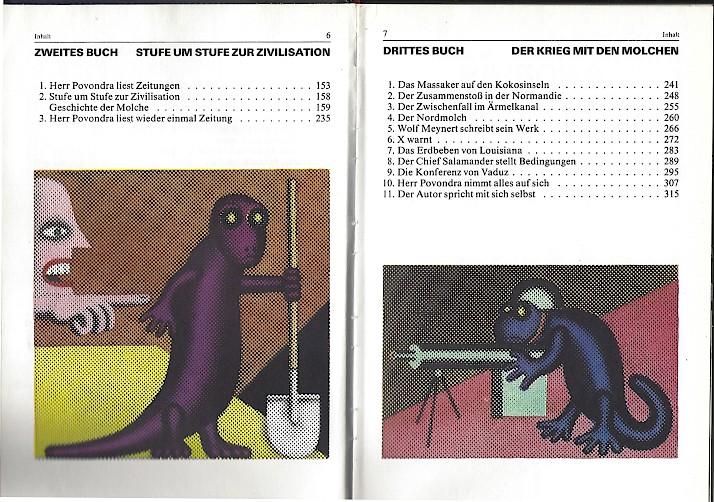
Die Illustrationen stammen von dem deutschen Maler und Grafiker Hans Ticha und korrespondieren atemberaubend mit dem Text. Kapitän van Toch, der Protagonist des ersten Buches fällt uns entgegen, kugelt in unserer Vorstellung aus dem Buch, lädt uns schnaufend und fluchend ein, einzusteigen in die Geschichte, zu lesen und zu schauen.

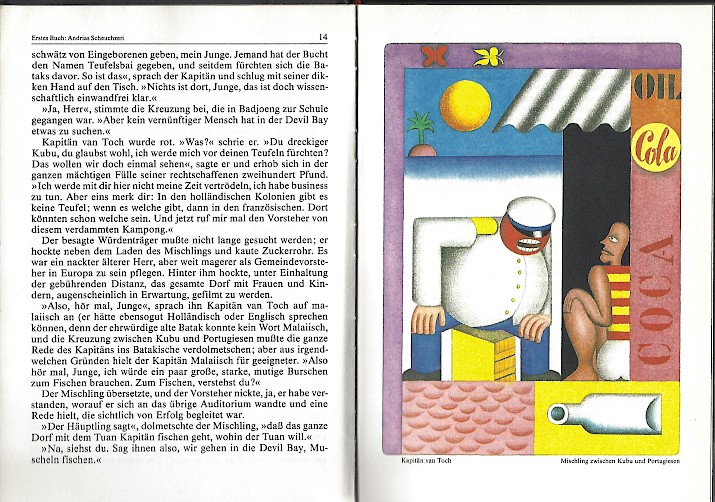
Seitdem ist Der Krieg mit den Molchen ein ganz besonderes Buch für mich.

Kapitän van Toch findet auf einer Südseeinsel Molche, die auf zwei Beinen gehen. Tatsächlich ließ Karel Čapek sich vom Abdruck eines Riesenmolchs, den der Zürcher Arzt und Naturforscher Johann Jakob Scheuchzer in den Steinbrüchen am Schiener Berg in Öhningen im Jahr 1725 fand und irrtümlich für einen vorsintflutlichen Menschen hielt, für seinen satirischen Science-Fiction inspirieren – Andrias Scheuchzeri.
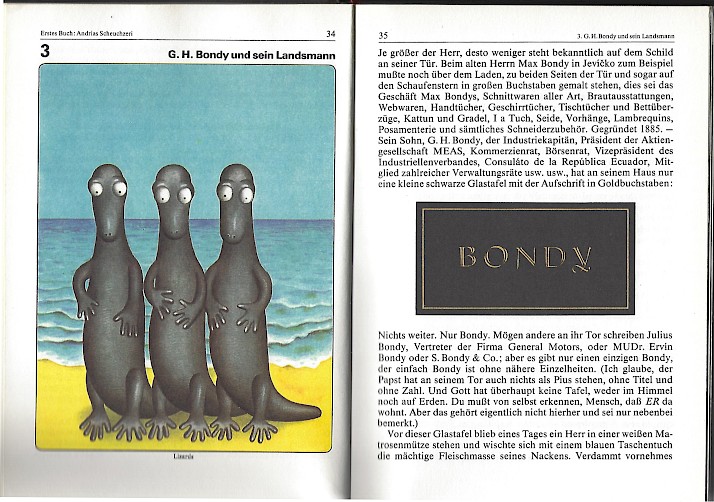
Im ersten Buch entdeckt Kapitän van Toch die Molche auf einer Insel in der Nähe von Sumatra und schließt ein Geschäft mit ihnen ab. Sie geben ihm Perlenmuscheln und bekommen dafür Messer, um sich gegen die Haie zu verteidigen, die ihre Fressfeinde sind.

Die Molche vermehren sich rasant. Mit der monetären Hilfe eines ehemaligen Schulfreunds beginnt der Kapitän ein Unternehmen aufzubauen. Da Molche nur im seichten Wasser leben und kein tiefes Wasser durchqueren können, beginnt er die Tiere per Schiff in der ganzen Welt anzusiedeln. Das Geschäft mit den Perlen floriert.
Es kommt zu weiteren Begegnungen von Menschen und Molchen.
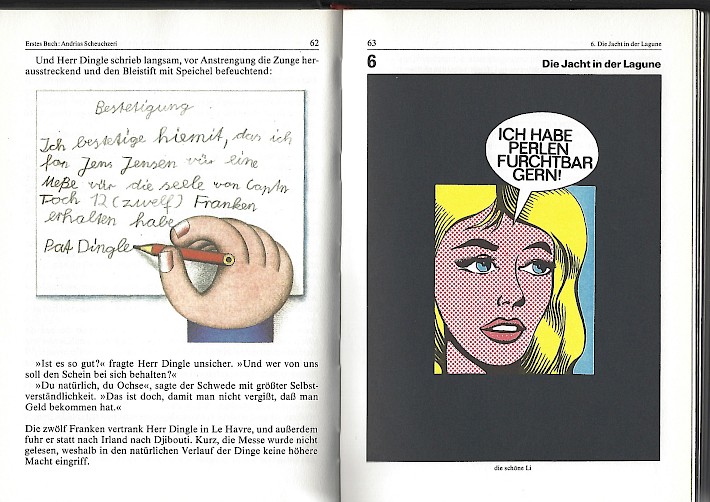


Die Molche sind intelligent und in Gefangenschaft erlernen sie an verschiedenen Orten der Welt die menschlichen Sprachen.
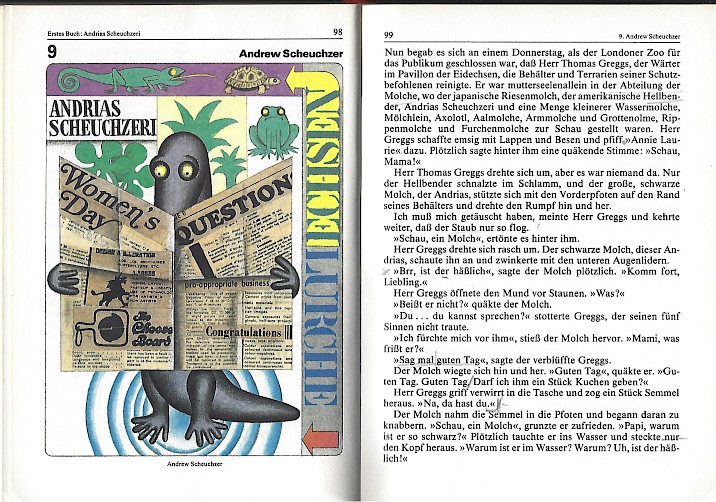
Čapeks Roman, entstanden 1936, fügt sich aus fiktiven Erzählungen, Zeitungsartikeln, wissenschaftlichen Berichten, Protokollen von Tagungen und Nachrichten, spielerisch zusammen, ist eine Parabel, eine Vorahnung und Warnung angesichts des sich abzeichnenden 2. Weltkriegs.
Hans Ticha, geboren 1940 in Bodenbach, vormals Böhmen, dann Tschechoslowakei, heute Tschechien, wuchs in der DDR auf und wirkte erfolgreich als freischaffender Maler in Leipzig und Ost-Berlin. 25 von ihm illustrierte Bücher wurden als Schönste Bücher der DDR ausgezeichnet. Heute lebt er in Hessen in Maintal. Die verschiedenen Stilrichtungen von Čapeks Texten stehen im Dialog mit seiner bildlichen Sprache und erweitern den Roman. Unter großem technischem Aufwand verfasste Ticha bereits 1974 Probeillustrationen sowie typografische Vorschläge für den Aufbau-Verlag. Bis 1980 entstanden über 100 Illustrationen. Das Buch ging allerdings erst 1987 in Druck und wurde im selben Jahr als eins der Schönsten Bücher der DDR prämiert.
Ein westdeutscher Verlag hätte sich ein solches Buch auf Grund des drucktechnischen Aufwands vermutlich nicht leisten können. Um so verstörender ist es, dass es 1991 kurz nach der deutschen Wiedervereinigung auf der Müllhalde landete. Aus Berichten von Deutschland Funk Kultur aus dem Jahr 2007 und 2009 erfahre ich, dass die Leipziger Kommission- und Großbuchhandelsgesellschaft im Jahr 1991 50.000 Tonnen druckfrischer Bände bei einer Deponie in der Nähe von Leipzig entsorgt hat. Das war wohl in Plottendorf, das vierzig Autominuten von Leipzig im Altenburger Land liegt. Von anderthalb bis drei Millionen Büchern ist die Rede, die da auf dem Müll landeten, weil man, was aus dem DDR-Druck kam, zur Wendezeit als unverkäuflich einschätzte und bestehendes Kulturgut negierte?
1990 gab die Büchergilde Gutenberg eine lizenzierte Ausgabe des von Ticha illustrierten Der Krieg mit den Molchen heraus und 2016 wurde das Buch mit seinen Illustrationen von der Büchergilde im Stil des Originals wieder aufgelegt.
Das zweite Buch berichtet von der kapitalistischen Ausbeutung der Molche als Arbeitskräfte. Die Molche befinden sich in einem rechtlosen Raum. Die Menschen fühlen sich berechtigt, medizinische Experimente an ihnen durchzuführen und maßen sich an, sie zu besitzen. Industrietrusts züchten Molche und handeln mit der Arbeitskraft Molch.
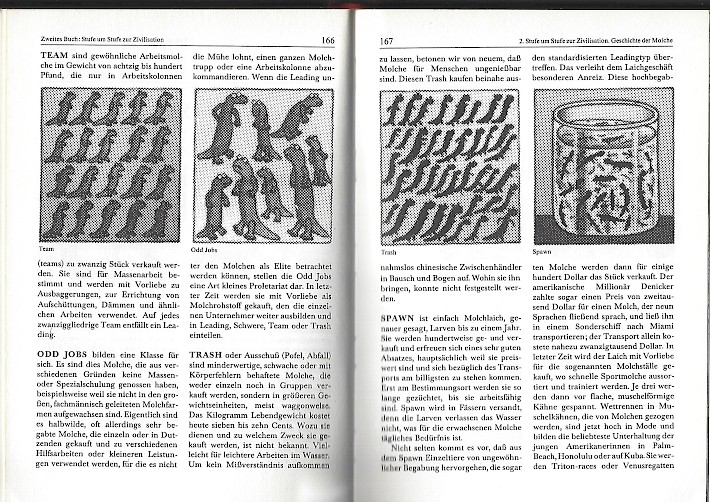

Da die Molche intelligente Wesen sind, beginnen sie sich zu emanzipieren. Einzelne gehen zur Schule, erlernen Musikinstrumente, werden Künstler. Es kommt hier und da zur Heirat zwischen Molch und Mensch. Die Molche kämpfen um Bildung und ihre Rechte und lernen von den Menschen, bis sie quasi die „besseren“ Menschen werden.
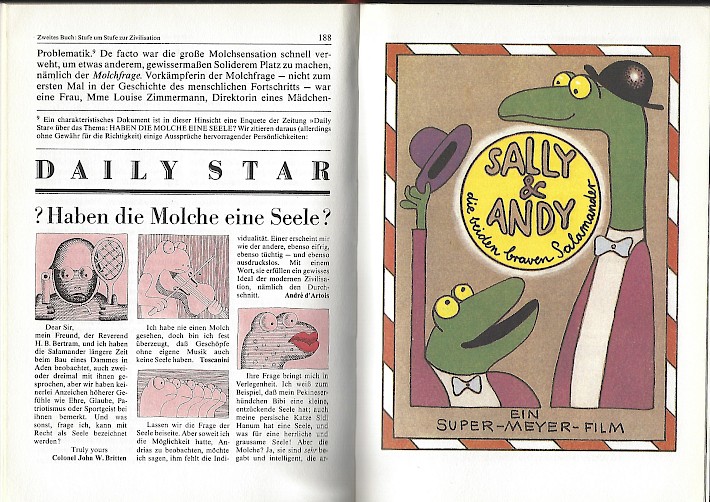


Im dritten Buch Der Krieg mit den Molchen, leben die zivilisierten Molche mit den Menschen zusammen in wirtschaftlichen und politischen Kooperationen. Sie tragen immer mehr Küsten ab, um neuen Lebensraum für sich zu gewinnen. Der Meeresspiegel steigt. Den Menschen steht das Wasser wortwörtlich bis zum Hals. Es kommt zum Krieg zwischen Menschen und Molchen.

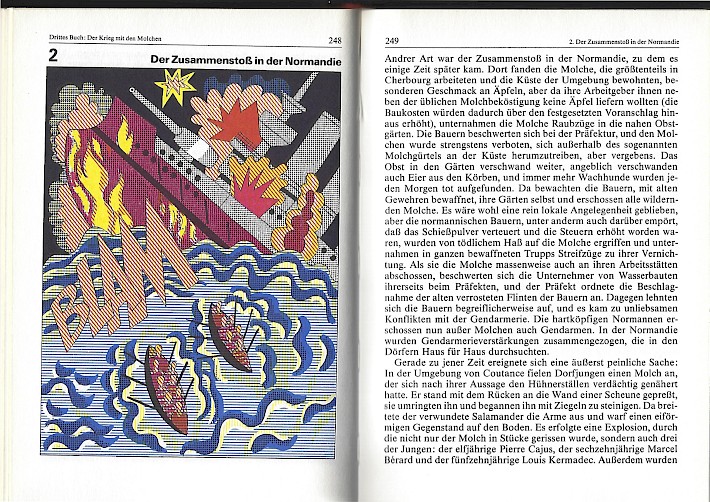

Die Menschen gewinnen den Krieg nicht, sie überleben ihn nur, die Molche meucheln sich gegenseitig. Eindringlich kritisiert Čapek im letzten Buch den sich ausbreitenden Faschismus und Krieg.
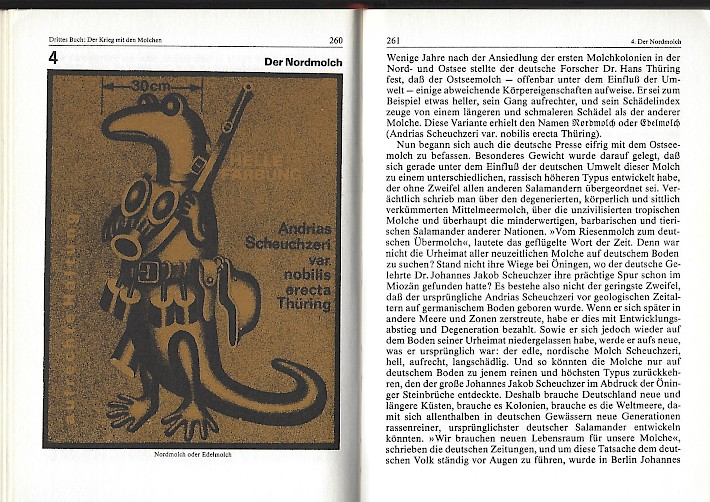


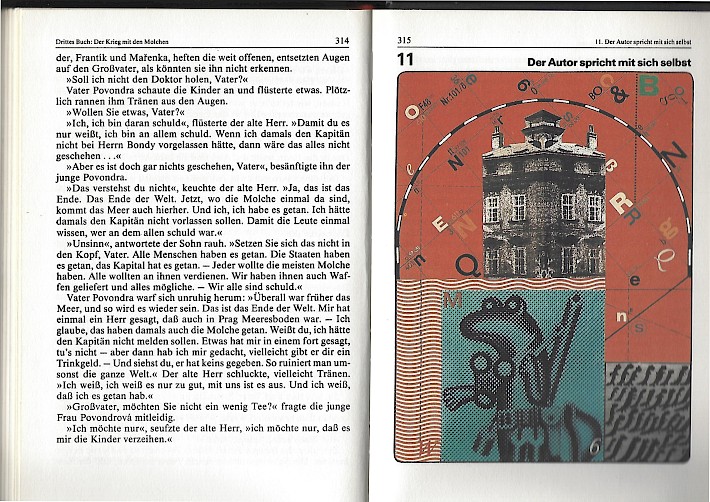
In den 1930er-Jahren schrieb Karel Čapek mutig, wie sein Bruder auch, gegen den Nationalsozialismus, den sich ausbreitenden Faschismus und die von Deutschland ausgehende Gefahr eines Krieges an. Die Gestapo sah ihn neben dem Präsidenten der ersten Tschechischen Republik, Masaryk, als Staatsfeind Nummer 2 an. Čapek starb 1938 an einer Lungenentzündung, die er sich beim Beseitigen von Hochwasserschäden am Teich Strž, an dem seine Villa lag, zuzog. Die deutschen Nationalsozialisten bekamen ihn nicht mehr zu fassen.

Sein Bruder, der Maler und Schriftsteller Josef Čapek wurde hingegen in verschiedene Konzentrationslager deportiert, die er durchlitt. Er wurde 1945 im Konzentrationslager Bergen-Belsen ermordet, drei Tage vor der Befreiung des Lagers.
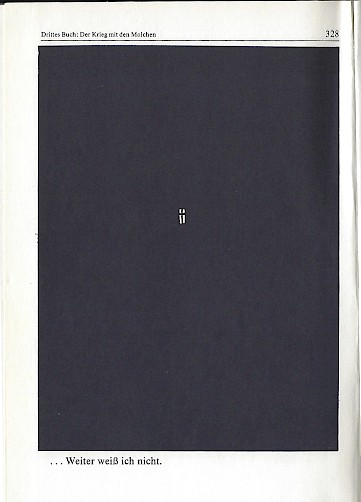
Sabine Bierich, Schaffhausen
Mit alten Illustrationen, 1971
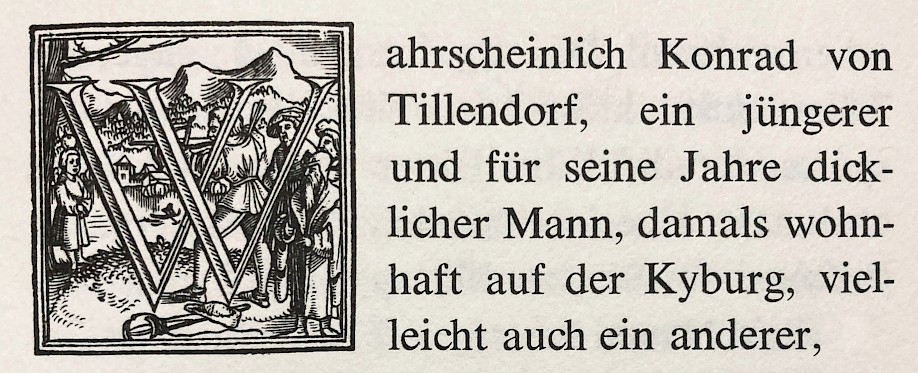
So beginnt Max Frischs Parodie des Schweizer Gründungsmythos um Wilhelm Tell, mit einer für den Text insgesamt symptomatischen Unsicherheitspartikel. Die reproduzierte Holzschnitt-Initiale, die an gerade diesem Beginn wesentlich mitschuldig ist, findet sich indes nur in der gebundenen Vorzugsausgabe des Werks (126 Seiten), die im August 1971 bei Suhrkamp erschienen ist (Abb. 1a). Anfang Oktober 1971 folgte eine rasch zum Bestseller avancierte Taschenbuch-Ausgabe (96 Seiten, enger gesetzt), bis aufs Cover ohne Illustrationen (Abb. 1b). Was indes beide Ausgaben gemein haben, ist eine andere Spielart von Paratext: Frischs Wilhelm Tell für die Schule besteht zu mehr als der Hälfte aus abgesetzten Anmerkungen, die zwischen die Abschnitte der fabulistischen Erzählung eingeschaltet sind.
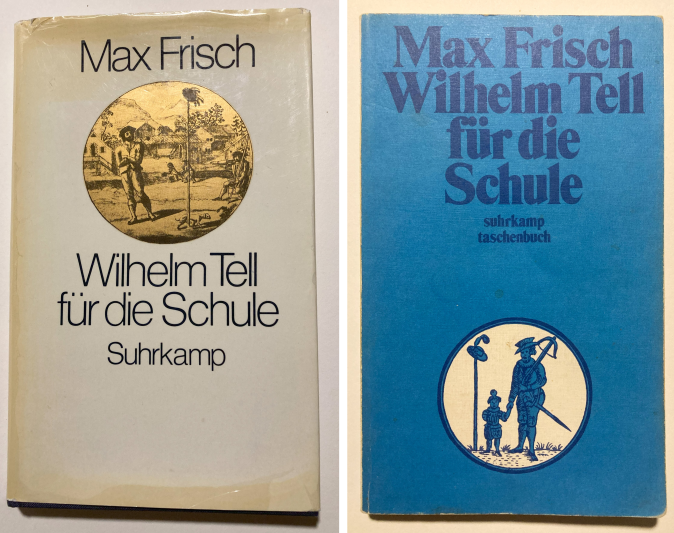
Abb. 1: (a) Max Frisch, Wilhelm Tell für die Schule. Mit alten Illustrationen, Frankfurt a.M. 1971, gebundene Erstausgabe; — (b) Max Frisch, Wilhelm Tell für die Schule, Frankfurt a. M. 1971, Nr. 2 der damals neuen Reihe suhrkamp taschenbuch.
Auf dem Titelblatt der Erstausgabe kommt ein von Christoph Murer gezeichneter Schmucktitel zu neuen Ehren, der 1606 bei Johannes Wolf in der dritten Ausgabe der Stumpf-Chronik erschienen ist. Die lateinischen Benennungen des allegorischen Personals wurden für die Nachnutzung konsequent geschwärzt (von oben Fama, Kranich und Auge für Vigilantia, flankiert von Patientia, Spes, Prudentia et Concordia über den Eidgenossen etc.), das Verlagssignet mit dem friedlichen Wolf unter Schafen von Suhrkamp überschrieben; eine klassische Antiqua ersetzt den barocken Zweifarben-Titel (Abb. 2).

Abb. 2: (a) vermutlich von Helias Fryg nach Christoph Murers Zeichnung geschnittener Schmucktitel für Johannes Stumpf, Schweytzer Chronick […], Zürich 1606 (https://doi.org/10.3931/e-rara-18550); — (b) derselbe Titelrahmen ohne Lettern-Druck (aus Paul Leemann-van Elck, Die zürcherische Buchillustration von den Anfängen bis um 1850, Zürich 1952, S. 97); — (c) Nachnutzung auf dem Titelblatt der Erstausgabe von Frischs Tell 1971.
Noch weiter zurück reicht die Geschichte der W-Initiale mit Apfelschuss-Szene. Lange vor dem kleidsamen Einsatz am Beginn von Frischs Tell hatte sie bereits prominente Nachnutzung erlebt. Sie orientiert sich ihrerseits am allerersten Apfelschuss-Holzschnitt, der in der Etterlin-Chronik von 1507 (fol. XVr) erschienen ist, geschnitten von Daniel Schwegler und gedruckt bei Michael Furter in Basel (Abb. 3a), wo ihn Jahrzehnte später auch Heinrich Petri für Sebastian Münsters Cosmographia einsetzte (dt. 1544, S. ccxxix; lat. 1550, S. 361; frz. 1552, S. 395). Die kehrseitige Stellung des Schützen in diesem und den folgenden frühen Apfelschuss-Darstellungen scheint inspiriert von der als Herkules oder Satyr gelesenen Figur aus Albrecht Dürers enigmatischem ‹Eifersucht›-Blatt von ca. 1498 (Abb. 3b).

Abb. 3: (a) Daniel Schweglers Apfelschuss-Holzschnitt für Petermann Etterlin, Kronica von der loblichen Eydtgnoschaft, Basel 1507 (https://doi.org/10.3931/e-rara-6898), Bl. XVr; — (b) Albrecht Dürer, Herkules am Scheideweg (Die Eifersucht; Der große Satyr), ca. 1498 (https://www.staedelmuseum.de/go/ds/31387d).
Inzwischen hatte Christoph Froschauer aus Zürich die chronikalische Apfelschuss-Szene ins Kleinstformat eines Versals für «W» wie Wilhelm Tell umzeichnen lassen, vermutlich durch den Berner Ratsherrn, Reformator und Künstler Niklaus Manuel. Froschauer setzte die Apfelschuss-Initiale erstmals für den Majestätsplural der bis 1537 druckerlosen Berner Obrigkeit ein, im Reformationsmandat vom 15. Juni 1523 (Abb. 4a). Dasselbe Tellen-Wir nutzte Froschauer in Drucken für seine Gnädigen Herren in Zürich, etwa am 11. Dezember 1527 sowie in der zum Ersten Kappelerkrieg hinführenden Proklamation vom 3. März 1529. – Bei der Nachnutzung in Fritz Ernsts Tell-Studie von 1936 ist aus dem Pluralis Majestatis ein Pluralis Auctoris/Modestiae geworden (Abb. 4c).

Abb. 4: (a) Christoph Froschauers Einblattdruck für die Berner Regierung, 15.06.1523, mit der vermutlich von Niklaus Manuel entworfenen W-Initiale (aus Gutenbergmuseum XIV, 1928, Faksimile-Beigabe); — (b) Nachnutzung der W-Initiale im Gutenbergmuseum XIV, 1928, S. 3; — (c) Nachnutzung der W-Initiale durch Fritz Ernst, Wilhelm Tell. Blätter aus seiner Ruhmesgeschichte, Zürich 1936, S. 7.
Im Jahr 1525 trat die Apfelschuss-Initiale in zwei Zusammenhängen auf, die in ihrer Bezogenheit auf den Textinhalt stark differieren: Einerseits nahm Froschauer sie damals in den ersten Zürcher Bibeldruck auf, zu Psalm 1, mit dem sie nichts am Hut hat außer den Buchstabenwert: «Wol dem der nit wandlet […] den wäg der sünd» (Abb. 5a). Anderseits und mit vollstem Recht kam sie zeitgleich bei seinem Zürcher Kollegen Hans Hager zum Zug, in Huldrych Zwinglis Antwort an den Urner Landschreiber Valentin Compar; denn Zwingli beschwört darin initial den von «got […] zu eim ursprung und stiffter einer loblichen Eydgnoschafft» erkorenen, mithin bildlich und schriftlich präsenten Tell (Abb. 5b).

Abb. 5: (a) Froschauers Druck des dritt teyl des Alten Testaments, Zürich 1525 (https://doi.org/10.3931/e-rara-1760), Bl. XVIv, Psalter-Beginn mit W-Initiale; — (b) Hans Hagers Druck der Antwurt Huldrychen Zvinglis […], Zürich 1525 (https://doi.org/10.3931/e-rara-3468), Beginn mit «Wilhelm Tell» und W-Initiale.
Gut möglich, dass Frisch und der für die Bildauswahl 1971 beigezogene Kunsthistoriker Konrad Farner sich zur rezyklierten W-Initiale wie auch zum Palimpsest des Titel-Holzschnitts inspirieren ließen von Franz Heinemanns Studie über die Tell-Iconographie, der 1902 nämlich ganz analog vorgegangen war; die prächtig gerahmte Stelle des Verlagssignets allerdings diente ihm als Bildfeld für eine neuangefertigte Apfelschuss-Szene (Abb. 6).

Abb. 6: Franz Heinemann, Tell-Iconographie. Wilhelm Tell und sein Apfelschuss im Lichte der bildenden Kunst eines halben Jahrtausends […], Luzern 1902, zweites Titelblatt und S. 5.
Andreas Moser, Bern
Dieser Text ist aus einem längeren Beitrag gezogen, der unter dem Titel «Alte Bilder, neu genutzt. Zum Illustrationsprogramm in Max Frischs Wilhelm Tell für die Schule (1971)» in einem künftigen Librarium-Heft erscheint.
Weiterführender Weblink:
Paul Michels Seite über zählebige Bildtraditionen hat einen Tellenschuss-Abschnitt mit vielen weiteren Stationen: http://www.enzyklopaedie.ch/dokumente/Persistenz.html#Tell.
Angesichts der jüngsten Entwicklungen in der globalen Politik ist es schwer optimistisch zu sein. Den grossen französischen Philosophen Voltaire (1694-1778) hätte das nicht verwundert. Sein wohl bekanntestes Werk Candide, ou l’optimisme (1759) widmet sich gerade diesem Thema und führt den Lesern vor Augen, dass die Welt nicht in Einklang stehen kann mit einer Philosophie der Zuversicht.
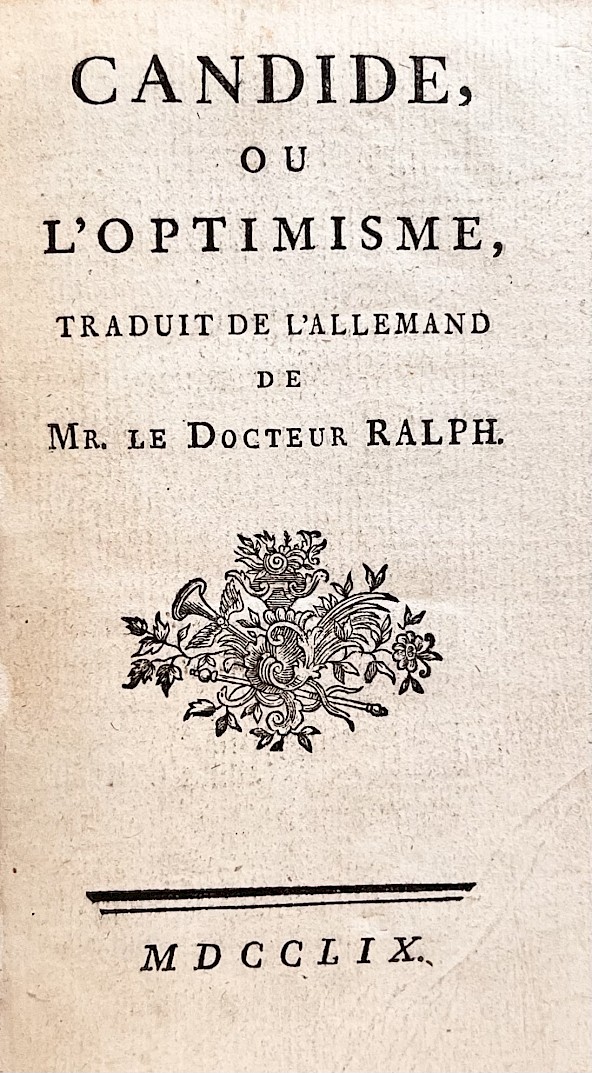
Das Werk, das sich insbesondere gegen die damals populäre, optimistische Weltanschauung von Leibniz (1646-1716) richtet, der in der von Gott geschaffenen Welt die bester aller möglichen Welten erkennen wollte, ist voll von beissendem, ironischen Spott. Das Ziel Voltaires war es diesen Optimismus in einer satirischen Übersteigerung auf die Realität prallen zu lassen. Damit sollten Zweifel an der Sinnhaftigkeit der Menschen geschaffenen Institutionen der Kirche und des Staates, an religiösem Fanatismus und an den versteinerten sozialen Vorstellungen der Gesellschaft geweckt werden.
Zu diesem Zweck erfand Voltaire seine naive, optimistische Romanfigur Candide. Im Laufe einer Reise durch Europa erlebt er einen Schicksalsschlag nach dem anderen und bleibt doch lange Zeit davon überzeugt, dass er in der besten aller möglichen Welten lebe. Am Ende zieht sich der ermattete Held auf das Private im Leben zurück. Voltaires Candide beschliesst, dass das Wichtige im Leben sei, den eigenen Garten zu bestellen. Diese Metapher benutzen wir auch heute noch für Menschen, die den Glauben an ihre Wirksamkeit in der Welt verloren haben.
1758 und 1759 waren schwierige Jahre für die französischen Philosophen der Aufklärung. So erschien im Juli 1758 Helvétius (1715-1771) Werk De l’Esprit mit einer offiziellen Druckgenehmigung, die aber schon im August wieder entzogen wurde. Im November verurteilt der Erzbischof von Paris die Encyclopédie von D’Alembert (1717-1783) und Diderot (1713-1784). Für Voltaire war klar, dass in einem solchen Umfeld der Inhalt seiner Satire die weltlichen und kirchlichen Zensoren unmittelbar auf den Plan rufen würde. Dementsprechend unternahm er grosse Anstrengungen, um das Buch auch gegen etwaige Widerstände, Verbotserklärungen und Konfiskationen auf den Markt bringen zu können.
So liess er nicht nur das Buch im Januar 1759 bei den Gebrüdern Cramer in Genf drucken, sondern sorgte auch dafür, dass in unmittelbarer Folge weitere Ausgaben bei anderen Druckern in London und Paris erschienen sind. Dazu liess Voltaire die erste Ausgabe von Cramer direkt nach Druck nach Paris, London und Amsterdam verschicken. Das hatte den wertvollen Nebeneffekt, dass eine Hausdurchsuchung bei den Druckern keine Spuren des Buchs finden konnte. Eine Aufzeichnung aus den Geschäftsunterlagen der Cramers belegt, dass der Versand bereits Mitte Januar 1758 stattgefunden hat.
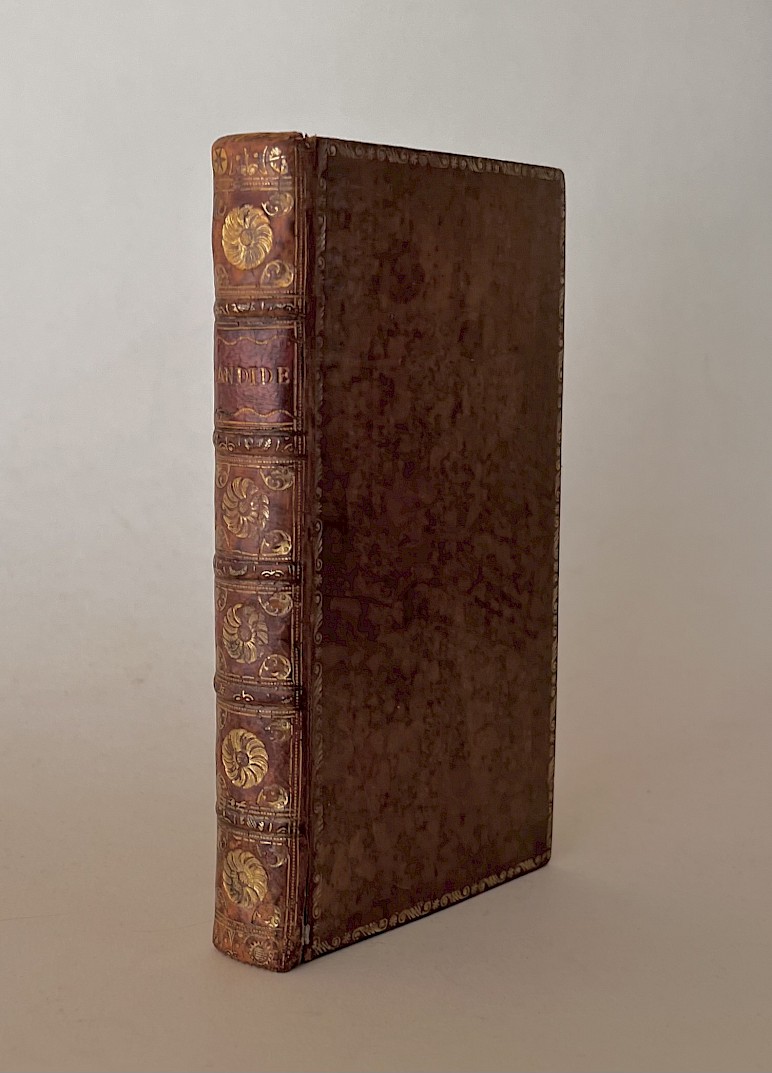
Am 6. Februar bestätigten sich Voltaires Befürchtungen. Die Zensur kritischer Bücher wurde drastisch verschärft. Helvétius De l’Esprit wurde verboten und die Verbrennung aller auffindbaren Werke angeordnet. Kurz darauf finden wir die erste offizielle Aufzeichnung über das Buch in den Unterlagen des damaligen Inspektors der Buchhandels D’Hémery (1722-1806) vom 22. Februar. D’Hémery war wie immer sehr gut informiert über den Druck in Genf und erwähnte bereits eine zweite Ausgabe aus Lyon. Diese Ausgabe ist deutlich erkennbar in grosser Eile gedruckt worden. Es erscheint wahrscheinlich, dass es sich dabei um den ersten Piratendruck von Candide handelt. Lyon liegt auf der Handelsroute von Genf nach Paris und war für offiziell aus der Schweiz eingeführte Bücher das Eingangstor in den französischen Markt. Mit grosser Wahrscheinlichkeit hat eine Kopie der Erstausgabe auf dem Weg nach Paris den Weg zu einem lokalen Drucker gefunden.
Das Buch wurde in der Folge in Frankreich verboten, beschlagnahmt und, wo man der Kopien habhaft werden konnte, ebenfalls verbrannt. Dementsprechend selten sind Kopien dieser beiden ersten Ausgaben. Bereits am 8. März schliesslich erfolgte das Verbot von Druck und Distribution der Encyclopédie.
Dennoch war der Siegeszug von Candide nicht mehr aufzuhalten. Noch im Frühling erschienen zwei weitere der Erstausgabe sehr ähnliche Ausgaben bei Nourse in London. Eine davon reflektiert eine frühere Manuskriptversion als die Erstausgabe aus Genf. Diese Ausgaben findet aber ihre erste Erwähnung erst im Mai 1759, weswegen es sich wohl um die dritte Ausgabe handelt. Aus diesen Beobachtungen wird deutlich, wie geschickt Voltaire vorging, um sicherzustellen, dass sein Werk auf alle Fälle den Markt erreicht. Das ist ihm schliesslich auch gänzlich gelungen. Allein das Jahr 1759 zählt 17 verschiedene Ausgaben und Candide wurde zu Voltaires meist verbreitetem Werk überhaupt.
Klaus Wellershoff
Von Pietro Mattioli ist unlängst ein aussergewöhnliches und interessantes Künstlerbuch erschienen. Auf dem Umschlag ist ein Taschenbuch aus der «Sonderreihe dtv» abgebildet. Blättert man in dem Buch, stösst man auf weitere genau gleiche Abbildungen und nur solche der Bücher dieser Reihe. Die Bücher sind im Massstab 1:1 abgebildet. Die Covers zeigen immer ein gekreuztes Quadrat, das man auch als Pyramide von oben lesen kann. Sie unterscheiden sich lediglich in der Farbgebung. Was faszinierte den Künstler so an dieser Taschenbuchreihe, um sie über einige Jahre zu sammeln?

Abb. 1: Das Buch erschien in drei Cover-Varianten; der Name des Autors befindet sich als Aufkleber auf der Rückseite.
Pietro Mattioli realisierte 1977 eine 66-teilige Serie von Porträts. Ein strenges Konzept war bereits hier vorgegeben: Mattioli porträtierte junge Besucher des Nachtclubs Hey jeweils vor weisser Wand, frontal mit Blitz abgelichtet. 2005 wurde die Serie in der Edition Patrick Frey publiziert. Hier war schon etwas angelegt, was dem Künstler immer wieder so wichtig war: das Serielle. Es folgten weitere Serien, so u.a. 2004 mit einem Spinnennetz, oder 2007 Fernsehantennen. Spinnennetz wie Antennen wurden immer gleich akkurat mit der Kamera festgehalten.
1962 erschien erstmals die «sonderreihe dtv», die sich internationaler und moderner Literatur widmete. Werke von William Faulkner, Alain Robbe-Grillet, Ingeborg Bachmann, Gottfried Benn, Pablo Neruda und vielen anderen wurden so in grossen Auflagen verbreitet. Für diese Sonderreihe entschied sich Celestino Piatti für eine eigene Gestaltung. Jedes Taschenbuch zeigte die gleiche geometrische Figur, eine quasi von oben gesehene Pyramide. Diese Pyramide erhält durch die Lichtführung Plastizität. Das linke Viertel wird im hellen Licht, das obere und das untere Viertel im Streiflicht und das rechte Viertel als im Schatten liegend gezeigt. Unter sich unterscheiden sich die Bücher durch die Farbgebung. Sozusagen alle Farben wurden durchgespielt, wobei meist gedeckte Mischtöne zum Einsatz kamen.
Pietro Mattioli ging es offensichtlich weniger um den Inhalt als um die gleichförmige, von Buch zu Buch sich wiederholende Gestalt der Sonderreihe. In den Jahren vor 2009 begann Mattioli, Band um Band der Reihe zu sammeln, in Antiquariaten und Bücherbrockis zu suchen, bis er sie fast vollständig zusammengetragen hatte. Wenn er ein schöneres Exemplar fand, wurde das vergilbtere ausgeschieden. Eine Ausnahme erlaubte er sich: Als er von Georges Bataille den Roman «Das Blau des Himmels» fand – die Pyramide war in helle Blautöne getaucht – bildete die Vergilbung eine eigene geometrische Figur, die Mattioli offensichtlich gefiel, und er deshalb das Taschenbuch in zwei Exemplaren in die Sammlung aufnahm. Im Laufe der Jahre kamen so 133 Taschenbücher zusammen. Gebrauchsspuren und Vergilbungen auf Bucheinbänden hatten ihn bereits vor der «dtv sonderreihe» zum Fotografieren von Einbänden von Kunstbüchern verführt.

Abb. 2.
2010 stellte Mattioli das Werk «Celestino Piatti, dtv sonderreihe 1966-1979» in der Zürcher Galerie lange + pult in einer eigenen Installation aus (siehe Abb. 2). Er breitete fast die komplette Reihe auf einem speziell gebauten grossen Tisch aus. Sie bildeten einen bunten Teppich mit einem strengen geometrischen Muster. In der Ausstellung von 2012 im Krienser Museum im Bellpark bildete die Serie in Form von Reproduktionen der Covers eine Wand füllende Tapete. Nun liegt diese spezielle Buchsammlung sozusagen als Metabuch vor.
CELESTINO PIATTI: DTV SONDERREIHE 1966–1979 by Pietro Mattioli
Text by Aoife Rosenmeyer, English, 16.1 × 23 cm, 284 pages, 134 color plates, softcover, three different cover motifs
Kodoji Press, Baden 2023, ISBN 978-3-03747-115-9
Retail price CHF 25.00
Erschienen in drei Cover-Varianten (siehe Abb. 1), der Autor als Aufkleber auf der Rückseite.
Paul Tanner, Zürich
David Herrlibergers bislang unbekannte Vignette-Kopien nach Bernard Picart
David Herrlibergers Serien nach Schlussvignetten (‹Laubzierrat›) seines früheren Lehrers Bernard Picart (1673–1733) sind kein klassisches Buch, am ehesten ein Musterbuch für Kollegen, Kunsthandwerker, Buchproduzenten. Weder in Picarts noch Herrlibergers Schaffen stechen sie als Hauptwerke heraus, im Gegenteil: Es sind ‹Parerga›, ‹Beiwerke›, nachträglich allerdings der Buchbezogenheit enthoben, zu eigenen Serien mit Werkcharakter emanzipiert. Bereits Picarts Atelier selbst war so vorgegangen: 1729 erschienen in Picarts Verlag 25 seiner elaborierten Culs-de-lampe aus den zwei Folianten der postumen Prachtausgabe mit Werken von Nicolas Boileau Despréaux (1636–1711) als separate Gaphik-Folge nebst Erläuterungen: Explication des Vignettes de la Seconde Edition des Oeuvres de Boileau, in folio. Gravées pour la seconde fois, avec divers changemens & plusieurs nouveaux desseins, par Bernard Picart. Die damit epitomierte, aufs Schmuckprogramm reduzierte Boileau-Werkausgabe erschien in Den Haag bei Pieter de Hondt sowie bei Gosse & Neaulme zeitgleich 1729 (nachdem die Erstausgabe bei David Mortier 1718 nur erst die Titel- und eine Dedikations-Kopfvignette nebst einigen Tafeln von Picart hatte, ansonsten florale Holzschnitt-Schlussstücke). Zugleich erschienen die Oeuvres diverses von Bernard de Fontenelle (1657–1757) in drei Folianten bei Gosse & Neaulme 1728/29, ebenso prachtvoll illustriert und geschmückt durch die Picart-Werkstatt, genau zu der Zeit also, da Herrliberger dort als Graveur mitwirkte (1722–1727); laut Caspar Füsslis Künstlergeschichte «arbeitete er für Picart» auch noch in London 1728.
Am Ende des 17. Jahrhunderts geboren, hatte Herrliberger, von einem Mäzen unterstützt, sich früh bei den namhaftesten Kupferstechern und Verlegern in Augsburg und ab Mitte der 1720er Jahre bei Picart in Amsterdam aus- und weitergebildet, dessen Werkstatt damals für die prächtigsten Illustrationen und Buchschmuck-Programme Europas verantwortlich zeichnete, so für (Doppel-)Folio-Tafeln zu biblischen Geschichten, zu Ovids Metamorphosen (‹Musen-Tempel›), zur Religionsethnologie, zu antiken Gemmen oder eben zu Werkausgaben namhafter französischer Autoren. Via London und Paris kehrte der inzwischen über 30 Jahre alte Herrliberger 1729 nach Zürich zurück, wo «sich zum grösten Nachtheil der Kunst eine vortheilhafte Heyrath für ihn darbot» (so Caspar Füssli), in deren Folge er bis 1736 auf Schloss Hegi bei Winterthur in die Obervogtei seines Schwiegervaters trat. Nachdem tragischerweise seine Frau und vier der fünf Kinder verstorben waren, reaktivierte er das in frühen Jahrzehnten seines Lebens perfektionierte Metier und etablierte sich als Stadtzürcher Kupferstecher. Er reproduzierte zahlreich die Illustrationsserien seines früheren Meisters Picart, lancierte aber auch ortskundlich und kulturgeschichtlich besonders interessante eigene Projekte mit Schweiz-Bezug. Ab 1749 wohnte und arbeitete Herrliberger als Gerichtsherr, Graveur und Verleger in der Burg Maur, bis er die Gerichtsherrschaft 1775 wieder verkaufte und wenig später als Achtzigjähriger in Zürich starb.
Was vor mir liegt, ist mehr Puzzle als Buch: Einzelstücke aus inkompletten Ornamentstich-Folgen des Herrliberger-Verlags, durchweg getreu nach Picarts Buchschmuck kopiert, rund zwei Dutzend lose Blättchen, eng beschnitten (oft entlang, teils innerhalb der Plattenkante), meist nummeriert, etliche Nummern doppelt, darunter drei mit Titel, Namen und Jahr beschriftete, der Rest unsigniert. Mit Sicherheit sind sie vor 1748 entstanden, stammen mithin aus Herrlibergers Zeit (kurz) vor dem Umzug nach Maur. Nichts davon ist bislang irgend bibliographisch oder archivalisch erfasst; die einzigen Hinweise finden sich in einigen lakonischen Positionen der ab 1744 gedrucken Kataloge aus dem Herrliberger-Verlag.
Nachweisbar und auch in digitalisierter Form greifbar ist aus dem Gebiet der Vignette-Folgen von Herrliberger einzig die (um deutschen Text ergänzte) Reproduktion der oben genannten Vignettes de la Seconde Edition des Oeuvres de Boileau, wie sie der Selbstvermarkter Picart 1729 – mithin höchstwahrscheinlich unter Herrlibergers Mitarbeit – in Amsterdam herausgegeben hatte, in Zürich 1743 mit dem typographischen Titel: Vorstellung und Explication der sämtlichen Vignettes oder Laub-Zierrathen, welche sich in den geistreichen Wercken Nicolas Boileau Despréaux befinden […], von dem berühmten Bernhardt Picart gestochen, Nun aber wiederum verfertiget und verleget von David Herrliberger (25 nummerierte Tafeln, signiert «D. Herrliberger sculps. dir.», zudem das «Kupfer-Titel-Blatt» mit zugehöriger «Erklärung» in Schriftgravur und ein Druckbogen mit acht Seiten inkl. Titel und Vorbericht, dasselbe parallel auch in Französisch). Die komplex gestalteten Schlussvignetten haben im zentralen, spielfreudig umrahmten Mittelfeld meist eine figurative Szene, beispielsweise die bildliche Konkretion der Metapher vom ‹widerspenstigen Dichterross› (Abb. 1), mit der im buchgebundenen Ursprungsort der dadurch illustrativ beschlossene ‹erste Gesang› über L’Art poëtique anhebt (Boileaus Oeuvres 1729, Bd. 1, S. 279 zu 267: «Pour lui» – «un téméraire Auteur» – «Pégase est rétif»). Laut dem ersten Verzeichniß der in dem Herrlibergerischen Verlage in Zürich sich befindlicher Kupferwerke vom darauffolgenden Jahr war diese Serie für 30 Kreuzer zu haben; ebenso laut den Verlagskatalogen von 1749 und 1761, je als Nrn. 24 und 25 («mit Französischer» bzw. «mit Teutscher Erklärung», der Autorname versetzt als «Nicolas Baileau d’espreaux»). Im Verzeichniß von August 1769 ist der Preis auf 1 Gulden 45 Kreuzer gestiegen (so auch im letzten Verzeichniß von 1774, nun Nrn. 13 und 14). – Am Ende eines auf «Schloß Maur, unweit Zürich, den 2. Julii, 1770» datierten Vorberichts, der 31. Lieferung zur Neüen Topographie der Eidgenoschaft vorgebunden (Bd. 3, 1773 komplettiert), wendet Herrliberger sich besonders dem Interesse an Vignette-Mustern (statt getreu abgebildeten Ortschaften) zu: «Man nimmt auch Anlaß, Liebhabern einer andern Classe, als Topographischer Kupferstiche, Anzeige zu thun, daß bey Autor und Verleger deses Werkes noch einige Exemplare von den samtlichen Vignettes zu dem Werkgen des Nicolas Boileau Despreaux, in 27. Stüken […] zu haben. Sie sind dem Original des berühmten B. Picart genau nachcopiert, und zu allen Edtionen von Boileau, die keine Kupfer haben, als eine sehr schikliche Zierart, bequem zu binden.» (Als Verkaufsargument brachte Herrliberger dies auch in seinen Annoncen in den Zürcher Donnstangs-Nachrichten, etwa in Nr. 36 und 37 von September 1758: Jene «Laub-Zierrathen» seien «vornehmlich nöthig und dienstlich zu denen Werken des Boileau, bey welchen diese Kupfer und Explication nicht befindlich sind».) So sollte der Buchschmuck mithin wieder zurück in die Bücher gelangen; man hätte, dem folgend, die Reproduktionen der Picart’schen (Kapitel-)Schlussvignetten (ursprünglich auf den Großfolio-Seiten der Ausgabe von 1729) nun vollgültigen Tafeln gleich mit dem Textdruck anderer (kleinerer) Werkausgaben zusammengebunden.

Abb. 1: (a) B. Picart, Vignette zu den Oeuvres de Nicolas Boileau Despréaux, Den Haag 1729, Bd. 1, S. 279 (Pl. 12,1 × 13,6 cm); — (b) D. Herrliberger, Nr. 15 (von 25 Einzeltafeln) aus Vorstellung und Explication der sämtlichen Vignettes oder Laub-Zierrathen, welche sich in den geistreichen Wercken Nicolas Boileau Despréaux befinden, Zürich 1743 (Pl. 11,5 × 14 cm); — (c) D. Herrliberger, Nr. 3 (von 4 Tafeln à 3 Vignetten) aus XII. Underschiedliche nach Bernh. Picards Invention gestochne Vorstellungen, Zürich 1748 (Pl. 14,3 cm breit).
Keines der mir vorliegenden 25 Täfelchen, worunter etliche mit zwei Vignetten, stammt jedoch aus Herrlibergers Boileau-Serie von 1743. Ich bilde im Folgenden einige dieser bislang unbekannten Blätter ab und erwäge ihre Subsumierbarkeit unter die «Vignette»-Positionen in Herrlibergers Verlagsangebot (die Kataloge von 1744, 1749, 1761, 1769 und 1774 sind digital verfügbar über die untenstehenden Hyperlinks).
Drei der losen Blättchen tragen eine Titelei und sind zugleich je als Nr. 1 entsprechender Serien(-Teile) ausgewiesen. So kopierte Herrliberger die Picart-Vignette zum lateinischen Titelblatt der Reproduktionen geschnittener Steine mit Philipp von Stoschs Kommentar (1724 in Picarts Selbstverlag erschienen), um anstelle des originalen Monogramms in die Mitte der drachenflankierten Rahmung den Titel seiner Tafelfolge von 1748 zu setzen: XII. Underschiedliche, nach Bernh. Picards Invention gestochne Vorstellungen (Abb. 2). Die weiteren Tafeln dieser Folge sind unsigniert. Ins Verzeichniß und Nachricht der in dem Herrlibergerrischen [!] Kunstverlag in Zürich befindlicher Kupfer-Stücke und Werke, mit ihrem Preise vom 20. August 1749 ist diese Neuerscheinung aufgenommen als Position Nr. 20: «XII. underschiedenliche nach B. Picart gestochene Vorstellungen», zum Preis von 10 Kreuzern (identisch im Verzeichniß von August 1761). Der Verlagskatalog von 1769 erweitert die Position um den Hinweis, die zwölf «nach Picart» kopierten «Vorstellungen» seien «zu allerhand Gebrauch dienstlich», und erhöht den Preis auf 24 Kreuzer. Im neu nummerierten Katalog von 1774 sind unter «V» als Nr. 99 geführt: «Vorstellungen, unterschiedene nach Picart gemachte», nun für 42 Kreuzer. Unter den zahlreichen Verlagsanzeigen in den Zürcher Donnstags-Nachrichten ist diese Serie mit keinem Wort angezeigt (Hermann Spiess-Schaad, David Herrliberger. Zürcher Kupferstecher und Verleger 1697–1777, Zürich 1988, S. 183–185 listet alle Herrliberger’schen Annoncen in den Donnstags-Nachrichten). In allen Katalogen seit 1749 verzeichnet Herrliberger ausdrücklich, diese zwölfteilige Folge werde in ‹nur› vier «Kupferstücken» verkauft. Auf Basis des mir Vorliegenden lässt sich dies dahingehend rekonstruieren, dass die Folge aus vier nummerierten Tafeln mit je drei übereinander stehenden ‹Vorstellungen› aus unterschiedlichen Picart-Werkkomplexen bestand. Wichtige Anhaltspunkte für die Rekonstruktion liefern die Plattenmaße (siehe Bildlegenden). So lassen sich vier der mir vorliegenden Blättchen mit Nummerierung von 1 bis 4 und einer identischen Plattenbreite von 14,3 cm (bei einer Gesamthöhe von ca. 30 cm) den Kopfbereichen dieser Tafel-Folge zuordnen. Da die mir vorliegenden ‹Vorstellungen› alle mithilfe einer Schere vereinzelt worden sind – die genannten vier Kopf-Nummern sind daher gegen unten ‹offen›, ohne Abdruck einer Plattenkante –, ist die weitere Rekonstruktion nicht mit Sicherheit möglich; mir liegen aber einzelne unnummerierte Blättchen mit gleichem Breitenmaß vor, die sich in diesen Zusammenhang fügen (Mittelstücke nur mit seitlichen Plattenabdrücken und ein Schlussstück mit dreiseitiger Plattenkante, durchs Zerschneiden gegen oben ‹offen›). Das breitenidentische, mit «2.» nummerierte Kopfstück kopiert Picarts Devise-Vignette («INTER OMNES») zum französischen Titelblatt der Stosch-Gemmen (Abb. 2c). Und als Nr. 3 dieser Serie zuzuordnen ist die interessante Nachnutzung einer Schlussvignette aus der Boileau-Serie, nämlich der gesamten Rahmung aus der dortigen Tafel Nr. 15 (Abb. 1b), aber mit Ersetzung der zentralen Pegasus-Szene durch die Darstellung einer aufgeräumten Bibliothek unter Tonnengewölbe (an Zürichs erste öffentliche Bibliothek in der Wasserkirche gemahnend), zum bücher- und blätterreichen seitlichen ‹Zierrat› passend (Abb. 1c).

Abb. 2: (a) B. Picart, Vignette auf dem lat. Titelblatt der Gemmæ antiquæ cælatæ mit Erläuterungen des Barons von Stosch, Amsterdam 1724 (Pl. 10,3 × 16,5 cm); — (b) D. Herrliberger, Nr. 1 (von 4 Tafeln à 3 Vignetten) aus XII. Underschiedliche nach Bernh. Picards Invention gestochne Vorstellungen, Zürich 1748 (Pl. 14,3 cm breit); — (c) D. Herrliberger, Nr. 2 derselben Serie (Pl. 14,3 cm breit; nach Picarts Vignette auf dem frz. Titelblatt der Stosch-Gemmen: Pierres antiques gravées, Amsterdam 1724; nachgenutzt als Titelvignette der Impostures innocentes, Amsterdam 1734).
Die beiden andern Vignette-Täfelchen mit (Zwischen-)Titeln im Plattenfuß – nämlich: Vignette oder Zierraden, vorliegend «Erster Theil» sowie der «Fünffte Theil» – tragen je die (Abschnitt-)Nr. 1, sind mit Herrlibergers Initialen versehen und 1741/42 datiert. Es handelt sich dabei um Kopien nach Picarts Buchschmuck für Fontenelles dreibändige Oeuvres diverses von 1728/29, einerseits eine Kopfvignette (aus Bd. 1 [1728], S. 181 bzw. Bd. 3 [1729], S. 74 und 260), die Herrliberger ohne Einfassungslinie kopiert hat, und anderseits ein trophäenartiges Schlussstück (aus Bd. 1, S. 298 bzw. Bd. 2 [1728], S. 207 und Bd. 3, S. 280), das ihm als Titelvignette für die fünfte Abteilung dient (Abb. 3).

Abb. 3: (a) D. Herrliberger, Vignette oder Zierraden. Erster Theil, Zürich 1741, Nr. 1 (Pl. 7,5 × 13,3 cm); — (b) D. Herrliberger, Vignette oder Zierraden Fünffte Theil, Zürich 1742, Nr. 1 (Pl. 9,8 × 14,5 cm); — (c) B. Picart, Kopfvignette zu B. de Fontenelles Oeuvres diverses, Den Haag 1728/29, Bd. 1, S. 181 (Pl. 7,5 × 13,6 cm); — (d) B. Picart, Schlussvignette ebenda, Bd. 2, S. 207 (Pl. 7,2 × 12,6 cm).
Dass Herrliberger eine umfassende Reproduktion auch von Picarts reichhaltigem Illustrationsprogramm der Fontenelle-Werkausgabe feilbot, ist in seinen Verlagskatalogen zweifelsfrei belegt. Erstmals im Verzeichniß von 1749 findet sich die entsprechende Position (als Nr. 23 direkt vor der Boileau-Serie geführt): «Samtliche Kupfer-Titul, Vorstellungen und Laubzierrahten der berühmten Werke des Hrn. Bernhard von Fontenelle, wie selbige in der kostbaren Holländischen Folio Ausgabe befindlich sind; bestehende in V. Abtheilungen von LXIX. Vorstellungen, mit ihren Französischen Unterschriften» (ausgeliefert als 27 «Kupferstücke», also möglicherweise je ‹Abtheilung› fünf entsprechend große Tafeln mit je zahlreichen ‹Vorstellungen›, plus Titelkupfer und evtl. das Frontispiz mit Fontenelle-Porträt). Preislich lag diese Kopien-Folge mit 40 Kreuzern über der ebenfalls aus 27 Tafeln bestehenden Boileau-Folge (30 Kreuzer). Mit «Laubzierrahten» (wie sie im Verzeichniß geschrieben sind), Zierraden (so in den Platten Abb. 3) bzw. den ja auch in der Boileau-Serie auftretenden Laub-Zierrathen übersetzt Herrliberger offenbar den Begriff der Culs-de-lampe, also (Zier-)Schlussvignetten. Die mathematisch herausfordernden Kennzahlen – 27 «Kupferstücke» mit «V Abtheilungen von LXIX Vorstellungen» – wiederholt Herrliberger im Katalog von 1769, jedoch bei markant gestiegenem Preis von 2 Gulden 45 Kreuzern und mit einem neu hinzugefügten (etwas ungrammatisch geformten) Werbesatz: «Ist ein wegen vielen Sinn- und geistreichen Vorstellungen, der trefflichsten Werke, so je an den Tag gekommen ist». Bei den nachfolgend verzeichneten «samtlichen Vignettes, und Laubzierrathen» aus Picarts Boileau-Buchschmuck steht nun: «Ein eben so trefflich Werk, als wie No. 23». Im letzten, alphabetisch umgeordneten Verlagsverzeichnis von 1774 findet sich die Modifikation, das Werk «Fontenelle, sämtliche Kupfertitel-Vignete etc.» umfasse insgesamt «72 Vorstellungen» (gleichbleibend in 27 Kupferstücken für 2 Gulden 45 Kreuzer).
Bislang muss mit Hermann Spiess-Schaads Herrliberger-Katalog (1988, S. 157, Nr. 2.12) hinsichtlich der über Jahrzehnte in den Verlagsverzeichnissen zum Kauf angebotenen Kopien-Folge nach Picarts Fontenelle-Vignetten dennoch gelten: «Das angekündigte Werk ist nicht bekannt.» Spuren dieses Verlagswerks finden sich allerdings, wie ebenfalls Spiess-Schaad feststellte, in dem 1770/73 erschienenen dritten und letzten Band («Haubtheil») der Neüen Topographie, aus dessen Vorbericht ich oben zitiert habe. Herrliberger schmückte nun sein eigenes Werk mit der Serie allegorischer Putti-Kompositionen zu den Wissenschaften, die Picart für die Eloges des dritten Fontenelle-Bands von 1729 geschaffen hatte. Die ursprünglich mit klarem Textbezug zu Fontenelles entsprechenden Lobreden auf verstorbene Akademiemitglieder (Chemiker, Physiker, Philosophen usw.) gedruckten Kopfvignetten dienen bei Herrlibergers Nachnutzung über 20 Jahre nach der Erstankündigung der reinen Verzierung freien Seitenraums auf den gravierten Topographie-Zwischentiteln, ohne inhaltlichen Bezug zu diesem Werk des Maurmer Verlags. Die oblongen Täfelchen wurden wahrscheinlich aus den großen ‹Kupferstücken› vereinzelt. Nebst «ihren Französischen Unterschriften» (wie’s ja in Herrlibergers Verzeichniß seit 1749 heißt) tragen die aufwendig gearbeiteten Täfelchen je oben in der Platte die Nummerierungen im Sinn des annoncierten Gesamtumfangs; sie gehörten alle der «V.» Abteilung zu (oben rechts) als Nrn. 1–8 (oben links). Beispielsweise Picarts «Philosophie»-Allegorie (nach Cesare Ripas Iconologia gebildet), die 1729 am Kopf der Lobreden über Malebranche, Leibniz, Du Hamel und Reynaud steht, figuriert bei Herrliberger 1770 auf dem Kupfertitel seiner 35. «Ausgabe» (Lieferung) der Topographie (Abb. 4a/b). Die Schriftgravur des Titels und die nachgenutzte bildliche Allegorie wurden separat abgezogen, die ursprüngliche Kopf- zu einer ‹Fußvignette›.

Abb. 4: (a) B. Picart, Kopfvignette «La Philosophie» zu Fontenelles Oeuvres diverses, Bd. 3 (1729), S. 203 (auch S. 65, 232, 432); — (b) D. Herrliberger, Neue und vollständige Topographie der Eidgenoßschaft, Bd. 3, Zürich 1773, Zwischentitel zur 35. Lieferung (1770) mit Kopie dieser Picart-Vignette (Nr. V.5 der Fontenelle-Serie); — (c) B. Picart, Titelvignette zu Frans van Mieris’ Histori der nederlandsche Vorsten, 3 Bde., Den Haag 1732/33/35 ; — (d) D. Herrliberger, Neue und vollständige Topographie der Eidgenoßschaft, Bd. 3, Zürich 1773, Zwischentitel zur 31. Lieferung (1770); — (e) D. Herrliberger, Gottesdienstliche Ceremonien […] der Christen […]. In VII Ausgaben abgetheilt, Zürich 1746, Kupfertitel Heilige Ceremonien und Kirchen-Gebräuche der Christen in der ganzen Welt, Erste Ausgabe, Zürich 1744.
Die Allegorie auf der ersten so geschmückten Lieferung («La XXXI. Partie», 1770) hat ihre Vorlage allerdings nicht aus dem Kreis von Picarts Fontenelle-Buchschmuck, sondern kopiert dessen Titelvignette für Frans van Mieris’ Geschichte der niederländischen Fürsten von 1732, die Herrliberger bereits 1744 auf dem Kupfertitel seines Ceremonien-Werks in etwas modifizierter Fassung genutzt hatte (Abb. 4c–e); im aufgeschlagenen Buch, auf das die von der Zeit enthüllte Wahrheit sich abstützt, steht bei Herrliberger als mise-en-abyme des damit geschmückten Werks 1744 «Cerem.» und 1770 «Helvet. Topogr.» (Abb. 4d/e). Picarts programmatisches Frontispiz zu Mieris’ Werk indes recodierte Herrliberger für ein dem neugewählten Zürcher Bürgermeister Hans Caspar Escher 1740 zugedachtes Blatt, indem er Picarts geflügelte Geschichte isolierte, ihr eine Trompete in die Linke gab – so ist sie Fama – und in die Rechte anstelle der bei Picart an die Malerei übergebenen Feder das Wappen der Escher, das am mittleren Pilaster zwischen vier identischen Medaillons – für die zuvor bereits von dieser Familie gestellten Bürgermeister – aufzuhängen ist (Abb. 5). Der entvölkerte Raum ist nun Erinnerungs- und (Familien-)Ehrentempel; die Zeit in Saturns Gestalt rafft ihren Vorhang weg, befreit die Gedenkstätte vom Schleier des Vergessens. Picarts Chronos hingegen unterstützt Fama dabei, einen Bildteppich mit thronender Hollandia und Porträtmedaillen der Herrscher zu entfalten, worauf seine Geschichte deutet, genauer: aufs Profil Karls des Kühnen in der Bordüre oben links (Abb. 5a). Derselbe Zeigefinger an Herrlibergers transponierter Fama weist in den Himmel, der bei ihm Geschichte, Gerechtigkeit und Wahrheit zeigt, angestrahlt von unsterblichem Ruhm, wie er besonders den Zürcher Bürgermeistern sicher sei; denn auf dem Deckel des von der Geschichte in der himmlischen Wolkenszene dargebotenen Buchs steht «BURGUE MAITRE de Zurch», im Plattenfuß sind deren Namen eingraviert, von Rudolf Brun bis eben zum fünften Escher (Abb. 5b). Das offene Tempelrund ist nach dem Vorbild von Picarts Frontispiz zu den Eloges des Academiciens im dritten Fontenelle-Band 1729 gebaut. Für die Szene der Buchdarreichung im Himmel bediente Herrliberger sich bei einer allegorischen Kopfvignette, die sein früherer Lehrer 1732 graviert hatte (Abzüge avant la lettre am Rijksmuseum) und die 1740 für die Haager Ausgabe von Jacques-Auguste de Thous Histoire universelle (Bd. 1, S. 5) mit entsprechender Schriftgravur versehen wurde, einschließlich der mithin ebenfalls von da übernommenen mise-en-abyme des überreichten Buchtitels (Abb. 5c; ausgedeutet im Plattenfuß: «L’Histoire accompagnée de la Verité et de la Justice presente l’Ouvrage de Mr. de Thou á l’Immortalité»). Herrliberger nutzte wenig später eine getreue Kopie dieser Picart-Vignette (jedoch nun ohne Buchbeschriftung) zur Bebilderung seines Ceremonien-Titelkupfers, Zweyte Ausgabe 1744 (Abb. 5d). –

Abb. 5: (a) B. Picart, Frontispiz zu F. van Mieris’ Histori der nederlandsche Vorsten, Bd. 1, Den Haag 1732; — (b) D. Herrliberger, Bürgermeister-Blatt zu Ehren von H. C. Escher, Zürich, 17. März 1740; — (c) B. Picart, allegorische Kopfvignette (1732) für de Thous Histoire universelle, Den Haag 1740, Bd. 1 (S. 5); — (d) D. Herrliberger, Kupfertitel Heilige Ceremonien und Kirchen-Gebräuche der Christen, Zweyte Ausgabe, Zürich 1744 (Ausschnitt).
Im Unterschied zu den detailliert gearbeiteten Kopien nach Picarts allegorischen Eloge-Kopfstücken ist der mir vorliegende ‹Laubzierrat›, den Herrliberger ebenfalls der dreibändigen Fontenelle-Ausgabe entnahm, allerdings bislang nirgendwo nachweisbar. Eine römisch gezählte Markierung der Abteilung (wie die «V.» auf den kopierten Lobrede-Vignetten) findet sich hier nicht. Aus dem Bereich dieser unscheinbareren Ziervignetten und Fleurons liegen vor mir beispielsweise sechs identisch als «4.» nummerierte Täfelchen mit zusammen neun Vignetten (Abb. 6). Die zugrunde gelegten Picart-Tafeln sind in den Fontenelle-Bänden alle mehrfach eingesetzt: die ersten sechs (auf drei Platten) als Culs-de-lampe, der trophäenartig umspielte Globus mit Turteltauben (Abb. 6c oben) zudem als Titelvignette des dritten Bands. Eine der drei größeren Platten mit der Nummerierung «4.», die einen Opfergang inszeniert (Abb. 6d), fand Einsatz als Kopfband zur Histoire des Oracles (Bd. 1, S. 241, S. 299) und zuletzt zum Eloge auf Abbé de Louvois (Bd. 3, S. 287). Die Jakobsmuschel-Vignette (Abb. 6e) diente einmal auch als Kopfvignette (zu Fontenelles Eloge de Monsieur Berger, Bd. 3, S. 153), typischerweise aber als Schlussvignette; so am Ende des zweiten Bands (S. 440) wie auch im ersten Band (S. 234). Herrlibergers sechste Nr. «4» – im Zentrum zwei Putti, Hasenbeute schulternd – tritt erstmals am Kopf von Fontenelles Gedanken Du Bonheur auf (in Bd. 1, S. 341), zudem über den dritten Band verteilt zu drei Eloges (S. 29, 145, 321). –

Abb. 6: D. Herrliberger, sechsmal eine als «4.» nummerierte Tafel aus der Folge Vignette oder Zierraden von 1741/42 (kopiert nach Picarts Buschmuck für Fontenelles Oeuvres diverses, 3 Bde., Den Haag 1728/29): Plattenmaße (teils beschnitten) v. o. l. n. u. r.: (a) 9,8 × 14,3 cm; — (b) 7,3 × 12,5 cm; — (c) 7,3 × 11 cm; — (d) 10 × 14,3 cm; — (e) 10,5 × 13,6 cm; — (f) 11 × 13,6 cm.
Ich kann das Puzzle nicht mit Sicherheit lösen. Doch am wahrscheinlichsten scheint mir, dass die von Herrliberger aus Picarts Fontenelle-Programm kopierten Vignette oder Zierraden nicht (erst) für die in seinen Verlagskatalogen belegte 69-teilige Folge von «Kupfer-Titul, Vorstellungen und Laubzierrahten der berühmten Werke des Hrn. Bernhard von Fontenelle» entstanden sind, sondern – jedenfalls auch und bereits Jahre früher – einer seit dem Verzeichniß von 1744 als Position Nr. 8 geführten 37-teiligen Serie zuzuschlagen sind, die lakonisch bezeichnet ist als «Vignette, zu allerhand Gebrauch dienlich» (für 24 Kreuzer, identisch in den Verlagskatalogen von 1744, 1749 und 1761). Anhand der mir vorliegenden, nach Maßen und Nummern gruppierbaren Täfelchen vermute ich, diese Folge bestehe aus sechs Teilen (Titeleien des 1. und 5. Teils in Abb. 3) mit sechs Nummern (je 1–6, alle mehrfach vorliegend), die untereinander gleiche Plattenbreite haben, plus Haupttitel. Sie sind laut Datierung auf den Zwischentiteln 1741/42 entstanden, waren in Herrlibergers Verlag mithin vor den ab 1743 expedierten Vignettes oder Laub-Zierrathen aus Picarts Boileau-Programm erhältlich (und lange vor erstmaliger Ankündigung des umfassend reproduzierten Fontenelle-Schmucks). Im ersten Katalog von 1744 ist zudem die «Größe» der «Vignette»-Folge als in «4to» angegeben, was wohl bedeutet, dass jede der separat von 1 bis 6 nummerierten Reihen auf ein einzelnes Quartblatt abgezogen wurde. Laut Verzeichniß von 1769 sind die weiterhin geführten «Vignette, zu allerhand Gebrauch dienlich» – «Vignette» jeweils als Pluralform – von 37 auf «42 Kupferstücke» angewachsen und der Preis hatte sich verdoppelt auf 42 Kreuzer. Im letzten Verlagskatalog von 1774 nennt Herrliberger die Folge dann «Vignettes nach Picart gestochen» (nun mit korrektem französischen Plural) und gibt einen Umfang von «41» Täfelchen an, bei gleichem Preis von 45 Kreuzern.
Die biblionomen Spuren der Picart’schen Vorlagen an ihrem Herkunftsort in der Fontenelle-Ausgabe von 1729 führen mich auf einige abschließende Bemerkungen über die damaligen Herausforderungen kollektiver Buchproduktion, besonders bei Prachtausgaben wie den von Picart (und Herrliberger) gestalteten Werken, die separate Druckgänge fürs Typographische und auf demselben Seitenspiegel im Tiefdruckverfahren abzuziehende Kupfertafeln erforderten. Picarts Culs-de-lampe kommen in den Fontenelle-Bänden nämlich hie und da mit Bogensignaturen und Kustoden in Konflikt und werden so gleichsam von der Buchgebundenheit gebrandmarkt, aus der Herrliberger sie dann seriell kopierend heraushebt. Die bei ihm als Teil der Vignette oder Zierraden reproduzierte Schlussvignette mit Kopf und Blumentöpfen beispielsweise ist an ihrem Abstammungsort im zweiten Band der Fontenelle-Werke von 1728 (S. 397) von der Bogensignatur «Ddd 3» und der Kustode «A» (des nachfolgenden Briefs «A Monsieur» etc.) überlagert (Abb. 7). Wie in diesem Fall kommen die buchproduktionsbedingten typographischen Markierungen zwar oft innerhalb der Plattenkante, doch geflissentlich nicht im druckenden Bildbereich zu liegen. Durch die Wahl kleinerer Schlussstücke wie der von Herrliberger mit einem andern Fleuron zusammen kopierten Musikinstrumente-Trophäe auf Lage «Ddd 3» des dritten Fontenelle-Bands (1729, S. 397) ließen sich entsprechende Konflikte am Seitenfuß vermeiden (Abb. 7d). – Andere Effekte der potenzierten Fehleranfälligkeit bei kombiniertem Buch- und Kupferplatten-Druck sind kopfständig abgezogene Textillustrationen, Fleurons und Initialen (Abb. 8) oder versehentlich leer bleibende Papierstellen (Abb. 9). Solche Buchschmuck-Fehldrucke betreffen freilich nicht die jeweilige Gesamtauflage, sondern einzelne Exemplare.

Abb. 7: (a) D. Herrliberger, Vignette oder Zierraden, Zürich 1741/42, «2.» (Pl. 11 × 14,3 cm); — (b) B. Picart, Schlussvignette (Pl. 5,6 × 13,6 cm) mit Bogensignatur «Ddd 3» in Fontenelles Oeuvres diverses, Bd. 2 (1728, S. 397); — (c) D. Herrliberger, Vignette oder Zierraden, «6.» (7,5 × 11 cm); — (d) B. Picart, Schlussvignette (Pl. 3,6 × 10,6 cm) in Fontenelles Oeuvres diverses, Bd. 3 (1729), Bogen Ddd 3 (S. 397).

Abb. 8: (a) Kopfstand von Picarts Schlussvignette in Fontenelles Oeuvres, Bd. 2 (1728), S. 190 (Pl. 4,8 × 11 cm); — (b) Kopfstand einer wohl von Isaac Briot gravierten D-Initiale in den Metamorphoses d’Ovide, Paris 1622 (Guillemot & Thiboust), S. 173 (mit nachgenutzter Illustration von C. de Passe 1602).

Abb. 9: (a) Leerstand in Fontenelles Oeuvres, Bd. 3 (1729), S. 31; — (b) dieselbe Stelle in einem Exemplar mit Abzug von Picarts Kopfvignette «La Chimie» (Pl. 7,6 x 13,3 cm); — (c) Herrlibergers Kopie dieser Vignette (Nr. V.3 der Fontenelle-Serie), eingesetzt 1770 auf seiner Topographie, Lfrg. 33 zu Bd. 3 (1773).
Eine bemerkenswerte Lösung für Fälle, in denen eine Bogensignatur wirklich mitten im Bild einer textkonstitutiven ‹Vignette› zu liegen gekommen wäre, findet sich 1792 im zweiten Band der englischen Erstausgabe von Johann Caspar Lavaters Physiognomischen Fragmenten (als Essays on Physiognomy ab 1788 ausgeliefert, Bd. 2.1 der geläufigsten Bindung in fünf Folianten): Die Bogensignaturen «X» und «Y» (S. 81 und 85) wurden hier mit in den Plattenfuß graviert (das «Y» unterm Namenszug von Thomas Holloway, dem graphischen Programmleiter), in Substitution typographisch gedruckter Marker (abzusehen von der Bandangabe, die weit genug neben den Bildtäfelchen links am Rand steht). Eine typographische Bogensignatur auf der normalen Höhe des Seitenspiegels müsste den Plattenabdruck hier brutal (zer-)stören, stünde sie doch im Knie- bzw. Kopfbereich des Dargestellten (Abb. 10a/b). Im Vergleich mit der autorisierten französischen Physiognomik-Ausgabe (Abb. 10c), an der sich die englische in Text und Bild orientiert (nicht an der deutschen), suchte man durch öftere Zusammenziehung separater Bildfelder auf eine Platte das Fehlerpotenzial – die Anzahl nötiger Tiefdruckgänge pro Seite – zu minimieren (Abb. 10a); nur kamen die Tafeln im einmal gewählten Rahmen und bei luftigerem Textsatz eben oft weit unten im Fußsteg zu liegen, wo regelmäßig Lage-Bezeichnungen hingehörten, um aus den Druckbogen weiter ein Buch zu machen. Die von Lavater physiognomisch und kunstkritisch taxierten Vignette-Figuren – «What dignity in this figure after Raphael!» etc. (S. 81), «Below I present a head after Holbein» etc. (S. 85) – tragen mit «X» und «Y» eingeätzte Male ihrer wesentlich biblionomen Bedingtheit. Ohne Kenntnis ihrer Buchgebundenheit könnte man durch die parapikturalen Zeichen vielleicht auf den Gedanken verfallen, der Apostel solle mittels Andreas-Kreuz genauer identifiziert werden; oder als griechische Letter stehe das X für Christus; und das Y-Signum unterm sinnierenden Kopf zeige diesen ‹am Scheideweg›.

Abb. 10: (a) J. C. Lavater, Essays on Physiognomy, Bd. 2, London 1792, S. 81: Tafel mit eingravierter Bogensignatur «X» (Pl. 13,3 × 9,3 cm); — (b) ebenda, S. 85: Vignette mit Bogensignatur «Y» (Pl. 6,4 × 8,5 cm); — (c) J. C. Lavater, Essai sur la Physiognomonie, Bd. 2, Den Haag 1783, S. 75 (zwei Pl. 3,8 × 9,8 cm & 8,1 × 4,1 cm).
Andreas Moser, Bern
-------
Die abgebildeten Fotos stammen von mir oder von e-rara.ch und rijksmuseum.nl, Abb. 9a aus dem Digitalisat der Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt.
Digitalisate von Herrlibergers Verlagsverzeichnissen:
1744: https://www.e-rara.ch/zuz/content/zoom/5485345 (1 Bl. 2°, 41 Positionen, eingebunden in die Heiligen Ceremonien und Kirchen-Gebräuche der Christen in der ganzen Welt, Zweyte Ausgabe, nach S. 22)
1749: https://doi.org/10.3931/e-rara-116369 (2 Bll. 4°, 58 Nrn., Teil eines Sammelbands von Hans Jacob Leu: ZBZ, Ms L 68, nach S. 539; auch am Ende des ersten Bands der Neuen und vollständigen Topographie der Eydgnoßschaft, ZBZ, Res 1364)
1761: https://doi.org/10.3931/e-rara-17808 (2 Bll. 4°, 61 Nrn., ZBZ, 18.661,6)
1769: https://doi.org/10.3931/e-rara-88919 (6 Bll. 8°, 82 Nrn., ZBZ, AX 5199)
1774: https://doi.org/10.3931/e-rara-88920 (4 Bll. 8°, 110 Nrn., nun alphabetisch geordnet, ZBZ, AX 5199,2)
Catalogue des Pieces qui composent l’Oeuvre de Bernard Picart, Dessinateur et Graveur:
als Schluss-Teil der Impostures innocentes (1734 bei Picarts Witwe): https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/picart1734/0035 bzw. https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10501770x/f176.item
als späterer Separatdruck: http://data.onb.ac.at/rep/103FC496
Naturforscher und Landschaftsmaler im Val Medel
Von Disentis führt der Weg dem (durch die Schlucht Ruinas in den Vorderrhein mündenden) Rhein-Arm entlang südwärts durch das Val Medel mit dem grössten Ort Curaglia zum Lukanierpass ins Tessiner Bleniotal. Zwischen 1780 und 1830 sind Künstler in das Bergtal gekommen, um vor Ort auf Bergreisen zu zeichnen und zu malen. Diesen Landschaftsillustratoren ist das von Albert Lutz verfasste Buch gewidmet.

Abb. 1: Johann Ludwig Bleuler, Ansicht von Disentis 1829/30; im Vordergrund der Maler und seine Begleiter.
Die Erkundung und künstlerische Wahrnehmung dieses Landstrichs erfolgte aus verschiedenen Interessen.
• Johann Jakob Scheuchzer (1672–1733) war bei seinen Schweizer-Reisen allumfassend naturkundlich interessiert: Gesteinsformen beobachtete er und die Schneeverhältnisse, die Tierwelt und die Milchwirtschaft und vieles mehr. Insbesondere die Entstehung der Gebirge interessierte ihn. Durch diese Gegend kam er am 9. August 1705. Er beschrieb die Route und fertigte eine Landkarte der Gegend an und bemerkte u.a.: Um dise Gegend [Medels] wachset neben Wießwachs [Grünfutter] auch Feldfrüchte/ Korn/ Roggen/ Gersten. Er erwähnte und zeichnete auch die Histen zum Trocknen des Getreides.
• Die malerischen Schönheiten der Natur – Wasserfälle, Brücken, Schneeberge im Hintergrund – und ihre Wirkung auf die empfindsame Seele der Betrachter wollten einige dieser Zeichner und Maler vermitteln.

Abb. 2: Ludwig Hess (1760–1800) Brücke von Acla über den Medelser Rhein (1477 m.ü.M.) 1787.
Salomon Gessner (1730–1788) setzte 1788 das Bild von Hess in eine kleinformatige Radierung um; er verwandelte die präzise Zeichnung von Hess ‹in ein Bergidyll, ein alpines Arkadien› (S. 23):

Abb. 3: Salomon Gessner nach Ludwig Hess, Rhein-Brüke, nahe bey St.Roch im Medelser Thal in Bünten.
Mit Salomon Gessner bewegen wir uns in der Welt der Idyllen: Schäferinnen und Hirten leben – ein Gegenbild zum dekadenten Leben in den Städten – im Einklang mit der urwüchsigen, friedvollen Natur; glückliche Lämmer und Ziegen umgeben sie. Gessners Gedichtsammlungen «Daphnis» und «Idyllen» erschienen von 1754 an in mehreren Auflagen. – Die Lebenswelt der in Wirklichkeit armen bäuerlichen Bevölkerung kommt in den Bildern der Kunstschaffenden ebenso wenig ins Blickfeld wie in Albrecht von Hallers (1706–1777) berühmtem Gedicht «Die Alpen», zu dem er durch eine 1728 mit Gessner unernommene Alpenreise angeregt worden war (erste Auflage 1729).
• Ein eigenartiges Interesse zeigt sich im Kunstmarkt, der die Nachfrage nach erhabenen, pittoresken Bildern bediente. Der junge Schaffhauser Verleger Johann Ludwig (Louis) Bleuler (1792–1850) unternahm 1817/19 – geführt von P. Placidus Spescha – Reisen in die bündnerischen Bergtäler, um akribisch genaue Landschaftsstudien anzufertigen. Der Rhein entwickelte sich allmählich zu einem eigenen Bildmotiv, und von 1827 bis 1842/43 entstand dann in seinem Verlag nach und nach die «Große Rheinreise», an der 25 Graphiker arbeiteten: 80 Ansichten von den Quellen bis zur Mündung, die der Nachfrage nach Bildern von Sehenswürdigem nachkamen, die mit Correctheit und Effect gestaltet wurden. Es gab eine Ausgabe in Gouachen auf Umrissradierung und eine einfachere in Aquatintadrucken, mit Erklärungs-Skizzen.

Abb. 4: Johann Ludwig Bleuler, Quelle der Froda, 1829/30.
• Hans Conrad Escher (1767–1823), der mit dem Fernglas die Berge absuchte, um ihre Schichtung zu erforschen, setzt sich mit seinem geognostischen Interesse deutlich ab von den malerischen Alpenansichten. Ihm ging es um die Erforschung der Entstehung der Gebirge, wozu er zahlreiche Exkursionen in die Alpen unternahm. Rund 1000 oft kolorierte Zeichnungen, sowie Landkarten und Panoramen hat er gezeichnet, und Tausende von Gesteinsproben gesammelt. H. C. Escher ist aber nicht nur wegen seines Interesses für die Schichtung und Faltung der Gesteine ein Geistesverwandter von J. J. Scheuchzer, sondern bei ihm erkennt man auch physikotheologische Gedanken, wie sie Scheuchzer (besonders seit 1721) entwickelte:
Ob der Mensch nun diese zahllosen Welten zum Vorwurf seiner Betrachtungen wähle, oder ob er die zweckmäßige Bildung unserer Erdoberfläche untersuche, oder dem bewundernswerthen Organismus der Geschöpfe nachspüre, so wird er immer auf die gleiche göttliche Urquelle alles Daseins hingeleitet, die dem Mensch zwar zu fühlen, nicht aber mittels seiner Vernunft zu begreifen vergönnt ist, so lange diese an die Bedingungen von Zeit und Raum für ihre Begriffe gebunden ist (Escher, zitiert auf S. 59).

Abb. 5: Johann Ludwig Bleuler, Rheinwaldgletscher; im schwarzen Habit der Benediktiner Pater Placidus.
• Geführt wurden die Alpinisten immer wieder von Pater Placidus Spescha O.S.B. (1752–1833 in Trun; 1782 Priester in Disentis). – Auch die Leserinnen und Leser dieses Buches begleitet P. Placidus. – Seine Natur hatte (mit seinen eigenen Worten) von Jugend auf einen besonderen Hang, hohe Gegenden zu besteigen und die Schätze der Alpen aufzusuchen. Von P. Placidus sind zwischen 1702 und 1824 mindestens 25 Gipfelbesteigungen bekannt, wovon mehrere Erstbesteigungen. Der begeisterte Alpinist wanderte oft in Begleitung von Gemsjägern und andern Männern, und war noch im Alter wetterhart.
Er interessierte sich für die Gestalt der Berge und Theorien ihrer Entstehung, Gesteine, Gewässer, Witterungserscheinungen, Alpwirtschaft, und auch für die Lebensart der freiheitsliebenden Menschen der Alpen mit ihren besonderen Anlagen. Das Zeichnen traute er sich kaum zu, indessen beschrieb er die Landschaften sehr plastisch. Seine weitläufigen Aufzeichnungen sind handschriftlich überliefert und neuerdings zum Teil ediert von Ursula Scholin Izeti. Befreundet war er u.a. mit Johann Gottfried Ebel (1764–1830), der sich ebenfalls für den Bau der Berge und die Gebirgsvölker interessierte, und dem er Informationen zukommen liess.
Der unermüdliche Pater Placidus Spescha war indessen nicht nur kulturgeographisch unterwegs. Sein Einsatz gegen die Verarmung der Bevölkerung, sein Verhalten im Kriegsjahr 1799 und im Jahr ohne Sommer mit Überschwemmungen, Brückeneinstürze und einer Hungersnot 1816 sind weitere, beeinduckende Leistungen dieses Manns.
Viele interessante Einsichten zu gezeichneten und gemalten Ansichten sowie Aussichten auf die Mentalitätsgeschichte findet man in diesem Buch:

Paul Michel, Zürich
----
Albert Lutz, Val Medel – Naturforscher und Landschaftsmaler erkunden den Rhein und die Berge am Lukmanier 1700–1830 (Neujahrsblatt der Gelehrten Gesellschaft in Zürich auf das Jahr 2024), 86 Seiten, 27 Abbildungen, Herausgegeben von «La Vitrina» (ISBN: 978-3-033-10110-4).
Buch-Bestellung per Mail: (Preis: CHF 25.00 inkl. Versand)
Horacio Quiroga, erfolgreicher Schriftsteller und einsamer Anarchist
„Horacio Quiroga (1878-1937) wird heute als der erste klassische Erzähler Südamerikas angesehen“, schreibt Roland Berens in seiner Monografie (1). „Ihm gebührt das Verdienst, die Erzählung, die vor ihm nicht hinreichend anerkannt oft abschätzig als cuentito bezeichnet wurde, zu einer literarisch respektierten Kunstform entwickelt zu haben.“ Doch wer steckte hinter den Geschichten aus dem Urwald? (2) Eine Art Rudyard Kipling vom Río de la Plata?

Horacio Quiroga, aufgewachsen als Sohn eines Diplomaten in Salto, der zweitgrössten Stadt Uruguays, ist in Europa wenig bekannt, nur ein Fünftel seiner Erzählungen ist ins Deutsche übersetzt worden. Seine Geschichten gliedern sich thematisch in Jugenderinnerungen, Mysterien, phantastische Elemente enthaltende Horrorgeschichten, Fabeln und Kindererzählungen. Sein Leben war geprägt von einer Reihe von Tragödien – Tod des Vaters, Tod seines besten Freundes, Selbstmord der ersten Ehefrau. Doch Horacio Quiroga schaffte es immer wieder, über alle Schicksalsschläge hinwegzukommen und dabei ein Opus von rund 200 Kurzgeschichten, zwei Romanen und zahlreichen Filmkritiken zu hinterlassen.
Wilson Alves Bezerra, Professor für vergleichende Literaturwissenschaft an der Universidade de São Carlos in Brasilien, hat sich seit der Studienzeit mit Horacio Quiroga beschäftigt. In seiner Biografie ist es ihm ein Anliegen, eine Reihe mehr oder minder pietätvoller Mythen um den Autor in Frage zu stellen – schwerer Charakter, tragischer Held, krank von seiner zweiten Frau verlassen – und ein möglichst umfassendes, teils auf unerschlossenen Quellen basierendes Porträt des Schriftstellers zu entwerfen. Dabei kam ihm ein Zufall zu Hilfe: Im Juni 2012 wurde auf einem argentinischen Internetportal eine Sammlung Dokumente aus Quirogas Nachlass angeboten. Diese «Sammlung» bestand aus zwei Bananenkisten aus Ecuador in der hintersten Ecke eines Antiquariats in Mar del Plata, einem argentinischen Badeort. Es gelang, die zwei Kisten, die mit einer zwei Meter langen Schlangenhaut ausgelegt waren, am Zoll vorbei nach Brasilien zu transportieren. Doch das war erst der Anfang. Recherchen in den Archiven von Salto, Buenos Aires und Montevideo folgten, bevor die Pandemie die nötige Distanz zur Hektik des Alltags schuf, um die Lebensgeschichte des einsamen Anarchisten zu vollenden: In überzeugender Weise schildert Wilson Bezerra die Pendelbewegung des Schriftstellers zwischen Buenos Aires und seinem immer wieder verlorenen und wiedergewonnen Arkadien, der ehemaligen Jesuitenmission San Ignacio in der Provinz Misiones. Die Geschichten aus dem Urwald nahmen ihren Anfang in einer ehemaligen Jesuitenreduktion, die Horacio Quiroga erstmals 1903 als Photograph des Dichters Leopoldo Lugones (1874-1938) besuchte, der eine Expedition in den unerschlossenen Urwald des argentinischen Nordostens leitete.
Drei Kapitel dieser Biografie verdienen besondere Erwähnung. Da ist zunächst die mysteriöse Beziehung Horacio Quirogas zu der aus dem Tessin stammenden Dichterin Alfonsina Storni (1892-1938). Die beiden Künstler lebten mehrere Jahre in Buenos Aires zusammen, wobei ihre drei Kinder eine Art Patchwork-Familie bildeten, die nicht in das patriarchalische Weltbild der argentinischen Hauptstadt passte. Ein weiteres Kapitel ist der jahrelangen literarischen Fehde mit Jorge Luis Borges (1899-1986) gewidmet, der Horacio Quiroga zeit seines Lebens nicht ausstehen konnte und einen jahrelangen Grabenkrieg gegen ihn führte. Ein drittes Kapitel ist Horacio Quirogas Rezeption in Brasilien gewidmet, insbesondere seinem Briefwechsel mit José Bento Monteiro Lobato (1882-1948). 1922 reiste Horacio Quiroga als Delegierter der Regierung von Uruguay zur Jahrhundertfeier der brasilianischen Unabhängigkeit nach Rio de Janeiro und São Paulo. Seine Begegnung mit Monteiro Lobato war der Höhepunkt seiner Reise.
In der Geschichte A la deriva (wörtlich Abdrift) (3) schildert Horacio Quiroga, wie die Hauptperson, Paulino, von einer Giftschlange gebissen wird. Er tötet sie und merkt zugleich, wie sein Fuss anschwillt. Auf der Suche nach Heilung treibt er in einem Kanu den Rio Paraná hinunter zur nächsten Sanitätsstation. Doch er verliert das Bewusstsein und stirbt unterwegs.
Die Mythen, die sich um Horacio Quiroga ranken, haben viel mit dieser Geschichte zu tun: Kampf gegen die Natur, Wahnsinn, Gift und Tod. Die vorliegende Biografie beleuchtet ganz neue Aspekte des Schriftstellers, jenseits der Urwaldgeschichten, die ihm den Ruf eines südamerikanischen Rudyard Kipling eingetragen haben.
Es ist an der Zeit, Horacio Quiroga auch im deutschen Sprachraum wiederzuentdecken. Die faszinierende Biografie von Wilson Alves Bezerra bietet hierzu die beste Gelegenheit.
Albert von Brunn (Zürich)
Bezerra, Wilson Alves. A Narrative Biography of Horacio Quiroga the Lone Anarchist. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2023.
(1) Berens, Roland. Narrative Ästhetik bei Horacio Quiroga. Bielefeld: Aisthesis, 2002, SS. 9-10.
(2) Quiroga, Horacio. Geschichten aus dem Urwald. Übersetzt von Brit Düker. München: dtv, 2023.
(3) Quiroga, Horacio. «Treibgut» in: Geschichten von Liebe, Irrsinn und Tod. Aus dem Spanischen von Wilfred Böhringer, Hans-Otto Dill, Astrid Schmitt und Erna Stoldt. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1990.
In ihrem neuen Lyrikband zeigt sich die Winterthurer Schriftstellerin Ruth Loosli wortverspielt und ernst zugleich. In fünf Zyklen vereint sie eine Vielfalt an Themen, die sie zu Gedichten und kurzen Prosatexten verwebt: Politik und Gesellschaft vermischen sich mit persönlichen Erfahrungen und Eindrücken. Alltägliche Bilder sind hinterlegt mit Fragen an diese Welt. Die sich wandelnde Weltlage ist immer wieder Thema: Klimawandel und die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine sind in den Gedichten spürbar. Auch die Pandemie und die damit verbundene Zeit des Eingesperrtseins klingen in den Gedichten nach.
Der Liebe in ihren verschiedenen Variationen widmet Ruth Loosli den Zyklus Spiele um Liebe, in dem sie ihren Wortwitz gekonnt in Szene setzt. Sie spielt mit Gedichtformen und Assoziationen und zeigt, wie facettenreich Liebe ist, ob innerhalb der Familie oder im Freundeskreis. Sie steht «zwischen Chemie und Chaos», lässt das Herz überquellen «wie ein / Hefeteig den man zu lange / gehen lässt». Trotz ernster Untertöne gelingt es Ruth Loosli immer wieder, in wenigen Zeilen Heiterkeit und Lichtblicke zu zeichnen: Schmunzeln lässt das kurze Gedicht «Zum Foto des Geliebten» oder das poesiekundige Krokodil auf dem Bauplatz.
Textauszüge
Wolkenformationen
Schwan löst sich auf
Kamel verliert seinen Höcker
Wir sitzen am Ufer des unteren Sees
Wir sind Gesellschaft
Ausgeschlossen
Eingeschlossen
Das Wolkenschloss treibt uns
in wilde Spekulationen
wer wir sind und sein wollen
Und doch
müssen wir reden
weil wir Menschen sind
uns der condition humaine
beugen
Wäre ich eine Pflanze in
diesem Frühling
weißes Blütenblatt oval
oder breiter
mit einem zarten Grün am Rand
das Schweigen wäre mir lieb
Der Lehre Schönheit
dass alles vergeht
Schreibbilder

Begleitet wird die Lektüre von Schreibbildern der Autorin, die von ihrer immerwährenden Beschäftigung mit Wortfeldern zeugen. Sprache ist Waffe, «Widerstand / WiderWort» im Alltag, der bedrängt, einengt oder die Grenzen der Zeit sprengt. «Jeder Tag ist eine Fläche / mit offenen Fragen», schreibt Ruth Loosli. Mit ihren Gedichten sucht sie nach möglichen Antworten.
Für den Band «Ein Reiskorn auf meiner Fingerkuppe» erhielt Ruth Loosli im Oktober 2023 einen Anerkennungsbeitrag der Stadt Zürich.
Ruth Loosli
Ein Reiskorn auf meiner Fingerkuppe
Gedichte
Mit Schreibbildern von Ruth Loosli
128 Seiten
Reihe: Caracol Lyrik, Band 14
978-3-907296-28-8
Hier einige Schreibbilder von Ruth Loosli außerhalb des Buches




Einen Beitrag von Julia Röthinger zu den Schreibbildern von Ruth Loosli finden Sie hier.
Zur Autorin
Leben und Arbeiten
Ruth Loosli ist 1959 in Aarberg geboren und im Berner Seeland aufgewachsen. Sie ist ausgebildete Primarlehrerin und hat drei Kinder. Seit 2002 lebt und arbeitet Ruth Loosli in Winterthur, wo sie sich in verschiedenen literarischen Projekten engagiert. Neben dem Schreiben von Prosa und Lyrik gestaltet sie auch Schreibbilder.
Ruth Loosli ist Mitglied des AdS (Autorinnen und Autoren der Schweiz).
Auszeichnungen
- Kulturelle Auszeichnung der Stadt Zürich, 2023, für Ein Reiskorn auf meiner Fingerkuppe
- Werkbeitrag der Stadt Winterthur, 2019, für das Manuskript ihres ersten Romans
- Anerkennung «Goldene Feder» vom Kulturmagazin Coucou, 2019
- Text des Monats, Literaturhaus Zürich, 2006, 2010 und 2015
- Preis des Spiegeltheaters Kanton Zürich, 1997, für den Einakter Jura
Website
- loosli_schriftbilder.pdf (759.9 KB)
Die «Metamorphosen» von Ovid (43 v. Chr. bis 17 n. Chr.) sind für Illustratoren vieler Jahrhunderte attraktiv gewesen. Sie bieten unter anderem den Anreiz, das Sichverwandeln von Gestalten zu visualisieren, was interessante Mischfiguren erzeugt und eine vom Bild generierte Dynamik evoziert. Zudem dürfen viele in den Geschichten Handelnde nackt gezeigt werden, was immer eine Attraktion darstellte.
Und so sind die «Metamorphosen» seit der Antike, in mittelalterlichen Handschriften, in Holzschnitten des 16. Jahrhunderts, in Radierungen und Kupferstichen des Barock und insbesondere des Rokoko sowie auf Tafelmalereien und als Fresken, auch als Skulptur sehr häufig illustriert worden. Freilich können die Illustratoren die retardirenden Momente der Erzählung, die inneren Monologe der in Verwandlung Begriffenen nicht wiedergeben; auch gehen die von Ovid in die Geschichten eingefügten gedanklichen Implikationen im Bild verloren. Am ehesten vermögen die Illustrationen Gefühle der handelnden mythischen und menschlichen Figuren zu repräsentieren.
Hier greifen wir ein Buch heraus:

Titelblatt
P. Ovid Nasonis XV. Metamorphoseon librorum figuræ elegantissime, a Crispiniano Passæo laminis æneis incisæ. Quibus subiuncta sunt epigramata latine ac germanice conscripta fabularum omnium summam breviter ac erudite comprehendentia, autore Guilhelmo Salsmanno […] apud Crisp. Passæum chalcographum coloniensem et Joannem Jansonium typographum Arnhemiensem anno aVrea MeDIoCrItas.
Das Erscheinungsjahr ergibt sich aus dem Chronogramm: Wenn man die als Majuskel geschriebenen Buchstaben in aVrea MeDIoCrItas als römische Zahlen auffasst und addiert, ergibt das 1607. Aura mediocritas, der ‹goldene Mittelweg› ist ein Zitat aus Horaz, Oden II, x, 5.
Bilder: Der Ausdruck laminis aeneis incisae bedeutet: in Kupferblech eingeschnitten bzw. geätzt. Die Kupfertafeln erschienen bereits 1602; und es gibt offensichtlich verschiedene Ausgaben. Als Zeichner signiert gelegentlich Maerten de Vos (1532–1603), und als Kupferstecher bzw. Radierer setzt Crispijn van de Passe d.Ä. (1564–1637) mitunter sein Monogramm (Nagler, Monogrammisten, Band 5, Nr. 1082) ins Bild. Mehrere der Bilder sind freilich Kopien von Hendrick Goltzius (1558–1617), was hier nicht thematisiert werden soll.
Texte: In die Kupferplatten graviert sind lateinische Distichen (nicht Texte aus den «Metamorphosen»!). Darunter stehen im Buch von 1607 typographisch gesetzte Kurzfassungen der Geschichten (fabulae) Ovids, teils mit moralisierenden Deutungen; links lateinisch in jambischen Trimetern, rechts in deutschen Knittelversen. Als Poet nennt sich auf dem Titelblatt Wilhelm Salsmann (Wirkungsdaten bekannt von 1593–1620).
Erstes Beispiel: Daphne wird in einen Lorbeerbaum verwandelt
Apollo hat eben die Schlange Python getötet. Wie Apollo Cupido einen Bogen spannen sieht, prahlt er mit dieser Tat. Cupido indessen wettet, dass sein Pfeil sogar Apollo besiege. Er erörtert die Wirkung der beiden Pfeile mit der goldenen (die Liebe entzündenden) und der bleiernen (die Liebe verscheuchenden) Spitze und verschießt sie auf Apollo und die Nymphe Daphne; die Wirkung stellt sich sofort ein. Apollo sieht Daphne und ist sofort von der Liebe zu ihr ergriffen. Daphne enteilt, in der Flucht erscheint sie noch anmutiger, und Apoll wird dadurch noch mehr angetrieben sie zu verfolgen. Sie bittet ihren Vater, den Flussgott Penëus, sie zu verwandeln, und sofort findet ihre‚ Metamorphose zum Lorbeerbaum statt. (Metamorphosen I, 452–565)

Abb. 1: Im Hintergrund links ist das Streitgespräch zwischen Apoll und Cupido klein dargestellt. – Uns tritt sofort die Skulptur von Bernini (1622/25) vor die inneren Augen.
Zweites Beispiel: Perseus rettet Andromeda
Andromedas Mutter brüstete sich mit ihrer Schönheit und prahlte, schöner zu sein als die Nereiden. Diese Meernymphen baten Poseidon um Rache, und er sandte eine Flut und das Meerungeheuer Cetus. Der Priester Ammon orakelte, das Land werde befreit, wenn Andromeda dem Monster vorgeworfen würde. Und so fesselt der König seine Tochter Andromeda an einen Felsen. Perseus, der soeben der Medusa das beim Anblick den Tod bringende Haupt abgeschlagen hatte, fliegt – mit Flügelschuhen ausgestattet – zufällig dort vorbei, entdeckt die Gefesselte, ist entflammt, tötet das Scheusal, befreit Andromeda und bekommt sie zur Frau.

Abb. 2: Ovid (Metamorphosen IV, 663–764) kostet alle Reize literarisch aus, und das tun auch die Illustratoren, die das Scheusal in Kontrast setzen zur schönen Frau auf dem garstigen Felsen: Die Schöne und das Biest. (Man beachte das aus CVP ligierte Monogramm von Crispijn van de Passe oben links.)
Drittes Beispiel: Die in Frösche verwandelten Bauern
Die lykischen Bauern verwehren der Göttin Latona – auf ihrer Flucht mit zwei Neugeborenen dem Verdursten nahe – Wasser zu trinken, ja sie wühlen sogar den Schlamm des Sees auf. Die so entehrte Göttin ruft zornig: ‹Ewig sollt ihr in diesem Teich leben!› – und sogleich werden die Bauern in quakende Frösche verwandelt. (Metamorphosen VI, 339–381)

Abb. 3: In der Illustration (links) erscheinen die Bösewichter in verschiedenen Stadien: einer noch ganz als Mensch, drei in Verwandlung als Mischwesen, einer schon ganz Frosch.
Viertes Beispiel: Philemon und Baucis
Jupiter und Hermes besuchen eine Stadt; niemand gewährt ihnen Obdach. Einzig ein altes Ehepaar – Philemon (‹der Liebende›) und Baucis (‹die Zärtliche›) – bewirtet die Wanderer freundlich in ihrer ärmlichen Hütte. Die beiden erahnen am sich stets neu füllenden Weinkrug, dass ihre Gäste Götter sind, und wollen ihnen ein Opfer darbringen: ihre einzige Gans. Das wehren die Götter aber ab. Die Götter wollen die üblen Nachbarn strafen und das gastfreundliche Paar belohnen. Sie begleiten die beiden auf eine Anhöhe zu einem Tempel, während die ganze sonstige Gegend im Sumpf versinkt. Philemon und Baucis wünschen sich, dort Priester zu werden. Die Götter verwandeln sie am Ende des Lebens in Bäume. (Metamorphosen VIII, 618 – 725.)

Abb. 4: Rechts das Gastmahl: Die beiden Götter sind an Krone und Adler (Jupiter) und Flügelhelm und Caduceus-Stab (Hermes/Mercur) erkennbar; die Gans sitzt auf dem Mäuerchen. – Links im Hintergrund ist simultan das darauf folgende Ereignis dargestellt: Die beiden Alten werden vor dem Tempel in Bäume verwandelt.
Fünftes Beispiel: Actaeon wird angespritzt
Sorglos durch den Wald streifend, betritt der Jäger Actaeon zufällig eine Grotte, wo Diana und einige Nymphen gerade ein Bad nehmen. Unter dem Blick des Sterblichen errötet die Göttin, bespritzt Actaeon mit Wasser und ruft ihm zu: ‹Nun sag, wenn Du kannst, du habest mich nackt gesehen!› Daraufhin wächst Actaeon ein Geweih auf der Stirn, seine Ohren werden länger und länger, Hände und Füße wandeln sich zu gespaltenen Hufen, und ein geschecktes Fell bedeckt seinen Leib. Er ergreift die Flucht, und als er schließlich sein Spiegelbild im Wasser erblickt, will er vor Erstaunen ausrufen, aber seine menschliche Stimme ist geschwunden, und nur ein Stöhnen entringt sich seiner Kehle. Noch während er sinnt, erspähen ihn seine Jagdhunde und zerfleischen ihn. (Metamorphosen 3, 138–252)

Abb. 5: Hier haben die Illustratoren Gelegenheit, mehrere weibliche Akte zu zeichnen sowie den sich zum Hirsch verwandelnden Mann. Auf diesem Bild im Hintergrund simultan bereits die Szene, wo er von seinen Hunden angefallen wird.
Die Verse unter dem Bild stammen nicht aus den Metamorphosen, sondern aus Ovids Klageliedern:
Inscius Actaeon vidit sine veste Dianam:
Præda suis canibus non minus ipse fuit.
‹Nichts ahnend erblickte Actaeon Diana ohne Gewand; nicht minder wurde er seinen Hunden zum Raub.› («Tristia» II, 103–108) Die deutschen Knittelverse betonen seine Unschuld: Acteon sahe on bedacht | Die Diana […].
Literaturhinweise
Wer nicht gerade eine Ovid-Ausgabe im Büchergestell zur Hand hat, kann die Texte im Original und in deutscher Übersetzung auch bequem online einsehen bei http://www.gottwein.de/Lat/ov/met01de.php (Die fetten Pfeile oben führen von Buch zu Buch.)
Gerlinde Huber-Rebenich, Sabine Lütkemeyer und Hermann Walter, Ikonographisches Repertorium zu den Metamorphosen des Ovid, 3 Bände, Berlin: Gebr. Mann Verlag 2004–2014.
Paul Michel, Zürich
Text und Bild - eine gute Tradition
Im Altertum wurden Texte und Bilder auf Papyrus gezeichnet und gemalt. Dieses Material war aber nicht so haltbar, die Fasern lösten sich auf.
Später, in Byzanz, hat man Felle von Schafen und Kühen gebraucht: das Pergament. Den grossen Fortschritt brachte das Papier, das eine uralte chinesische Erfindung war. Die ersten europäischen Papierfabriken entstanden in Italien. Im Mittelalter entstand die hohe Kunst der Buchmalerei, welche wir zum Beispiel von der Manessischen Handschrift kennen. Ein Meilenstein war die Erfindung des Holzschnitts, der neben dem geschriebenen Text gedruckt werden konnte. Ab 1440 wurden die Druckstöcke zusammen mit den gesetzten Buchstaben verwendet. Die Buchdruckerkunst war erfunden.
Ein weiterer Schritt war die Einführung des Tiefdruckverfahrens: Kupferstich und Stahlstich. Mit einem Grabstichel graviert der Künstler die Zeichnung auf eine polierte Platte. Beim Druck wird die Farbe aus den Vertiefungen geholt. Albrecht Dürer und viele andere haben mit dieser Technik grossartige Kunstwerke geschaffen.
Ein schönes Beispiel einer wissenschaftlichen Anwendung, die aber auch ästhetische Ansprüche erfüllt, ist der von dem französischen Botaniker und Geologen Charles Henry Dessalines d'Orbigny (1806-1876) von 1841 bis 1849 in 16 Bänden in Paris herausgegebene
Dictionnaire universel d'histoire naturelle

Dem Hauptautor dieser naturhistorischen Enzyklopädie standen rund fünfzig Spezialisten zur Seite. Ein Grossteil der damals bekannten Tier- und Pflanzenarten wurden auf den rund 9000 Textseiten ausführlich beschrieben; meistens steht auch der griechische Namen dabei. Neben den 13 Textbänden prangt ein Tafelwerk in drei Bänden mit 287 Stahlstichen, die von dem Maler Édouard Traviès (1809-1876) geschaffen wurden. Traviès galt als hervorragender Beobachter der Tierwelt und mit seinem aussergewöhnlichen Talent malte er Reptilien, Amphibien, Fische, Säugetiere und vor allem Vögel.

Gedruckt wurden nur die Umrisse. Fournier und andere Künstler haben fast alle Bilder koloriert, auch die feinsten Haarstriche von Hand gemalt und das in der ganzen Auflage - eine enorme Leistung!
Die Bilder sind eine wahre Augenweide. Die leuchtenden Farben sind sehr nuanciert angewendet.

Bei jedem Bild steht der französische und der lateinische Name des Objekts sowie der Abbildungsmassstab. Auch die jeweiligen Künstlernamen sind genannt: sculpsit für den Stecher, pinxit für den Maler.




Rolf A. Stähli, Biel
60 Biblische Geschichte [!] des alten Testamentes in Kupfer geäzt von Iohann Rudolf Schellenberg 1774
Die 1774 publizierten Bibelradierungen des Winterthurer Künstlers Johann Rudolf Schellenberg (1740–1806), mit anonym beigesteuerten Begleittexten in Prosa und vereinzelten Reimversen des Zürcher Pfarrers und Schriftstellers Johann Caspar Lavater (1741–1801), haben in den letzten Jahrzehnten einige Aufmerksamkeit erfahren als das erste Bibelbilderbuch spezifisch für das frühe Kindesalter. Diese Ausrichtung, der die Bilder-Wahl ebenso wie eine kindgerechte Sprache Rechnung zu tragen suchen, zeigt sich deutlich bereits in Schellenbergs programmatischer Titelradierung (Abb. 1).

Abb. 1: 60 Biblische Geschichte [!] des alten Testamentes in Kupfer geäzt von Iohann Rudolf Schellenberg, Winterthur 1774, 8°, Titelradierung (Privatbesitz, Bern).
Der Grammatikfehler im Titel der Erstausgabe erklärt sich wohl daher, dass zunächst noch keine Anzahl bestimmt war, wie die Vorzeichnung zum Titelblatt nahelegt. Dort steht nur «Biblische GESCHICHTE in Kupfer geätzt» (Abb. 2). Später kam die «60» hinzu, ohne Anpassung des Substantivs «Geschichte». – Allerdings gibt’s auch den Letztzustand dieser Radierung mit korrigiertem Titel: «60 Biblische Geschichten des alten Testamentes» (Abb. 3). Dieser Titel findet sich am Beginn einer gänzlich ohne typographischen Druck abgezogenen Serie der Radierungen, die später zum Einbinden in Vollbibeln angeboten wurde. Sie hat je zwei Tafeln pro Blatt-Vorderseite und im oberen Plattenrand die zugehörigen Bibelstellen, eingraviert als Hilfe für den Buchbinder (Abb. 4).

Abb. 2: Schellenbergs lavierte Tuschzeichnung des Titelblatts Biblische GESCHICHTE, um 1771/72, später von der Lavater-Werkstatt hinter Glas montiert zu einem klappbaren Kabinett-Stück mit dem Pendant gerahmter Hexameter von Lavaters Hand, dat. «12.IX.1789»: «Ernstaufhorchen die Kinder, Die zartgebildete Mutter / Deütet die erste Geschichte, die erste Einfalt der Einfalt – / Was verstehn kann, horcht, und sehn will, was nicht versteh’n kann.» (Universitätsbibliothek Bern, Bibliothek Münstergasse, Rar alt fol 177 1, Nr. 1).

Abb. 3: 60 Biblische Geschichten [!] des alten Testamentes in Kupfer geäzt von Iohann Rudolf Schellenberg, Winterthur 1774, 8°, Titelradierung im späteren Zustand mit berichtigter Grammatik (Privatbesitz, Zürich).

Abb. 4: 60 Biblische Geschichten des alten Testamentes in Kupfer geäzt von Iohann Rudolf Schellenberg, Winterthur 1774, 8o, Tafeln zum Einbinden in Oktavbibeln, letzter Zustand mit eingravierten Bibelstellen oben in den Platten, ohne weitere Texte, hier: «I. Mos. VIII. 20.» (Noahs Opfer) und «I. Mos. XII. 4.» (Abrahams Auszug) auf einem Blatt (Privatbesitz, Zürich).
Veranlasst und finanziell getragen wurde das Projekt von der 1764 gegründeten Moralischen Gesellschaft, einer gemeinnützigen Sozietät, die religionspädagogisch und volksaufklärerisch im Zürichbiet wirkte. Lavater als Schellenbergs enger Mitarbeiter und Auftraggeber im Namen der Moralischen Gesellschaft berichtete im März 1772 seinem Freund Johann Georg Zimmermann (1728–1795), einem aus Brugg stammenden Arzt und Schriftsteller in Hannover, er arbeite «izt mit einem sehr geschickten Mahler schon 3 Wochen unverrückt an einer Kupferbibel für Kinder»: «Nur die allerbeßten Meister werden aufs beßte genutzt […]. Unten an jedes Stück kömmt eine bedeütsame Reflexion von mir. Sie ist der Pendant zu den Biblischen Geschichten, die unsere Gesellschaft herausgiebt!» (Lavater an Zimmermann, 03.03.1772, Zentralbibliothek Zürich [ZBZ], FA Lav, Ms 589d.1, Nr. 3, S. 4.) Damals nämlich erschien auf Veranlassung der Moralischen Gesellschaft in Zürich der erste Band Biblische Erzählungen für die Jugend (1772 bei Orell, Gessner, Füssli & Co., 141 alttestamentliche Geschichten auf 655 Seiten), gemeinschaftlich verfasst von Lavater, seinem gleichaltrigen Kollegen Johann Jacob Hess (1741–1828) und weiteren Sozietätsmitgliedern. Die Eckpunkte der Illustrationsserie standen im Mai 1772 fest. Laut Versammlungsprotokoll sollte das «Projeckt in Ansehung der Kupfern zu den Biblischen Erzählungen […] kurz darinn» bestehen, «daß für die Geschichten des Alten Testaments eine Auswahl von 60 Kupfern getroffen u. der Verlag davon den beyden Hrn von Winterthur die sich dazu anheischig gemacht überlassen werden möge» (Tagungsbücher der Moralischen Gesellschaft, Bd. 3, 200. Versammlung, 28.05.1772, ZBZ, Ms J 533, S. 39). Mit ‹den beiden Herren› waren der Buchhändler-Novize Johann Heinrich Steiner (1747–1827) und als paritätischer Verlagsteilhaber der Winterthurer Stadtarzt Johann Heinrich Sulzer (1735–1814) gemeint. Zu dieser Zeit hatte Steiner, wie sein erster Brief an Lavater erweist, denn bereits «auch projectirt eine Presse machen zu lassen, um Hr. Schellenbergs Arbeit ab zu druken»: «Das wäre doch erwünscht wenn ich dann das BibelWerk in Verlag bekäme, und Selbst verfertigen könte!» (Steiner an Lavater, 19.05.1772, ZBZ, FA Lav, Ms 527, Nr. 165, S. 2.) – Die Quellen fließen rechlich. Dennoch wird bis heute behauptet, sowohl die illustrationslosen Biblischen Erzählungen für die Jugend als auch das daraus hervorgegangene Gemeinschaftswerk von Schellenberg und Lavater seien nicht der Moralischen, sondern der Ascetischen Gesellschaft, dem heutigen Zürcher Pfarrverein, zu verdanken (so auch alle Referenzbibliographien, religionspädagogische Dissertationen usw.).

Abb. 5: Histoires Sacrées du Vieux et du Nouveau Testament, gravées en taille douce par Jean Rodolphe Schellenberg, Tome I: Le Vieux Testamt., Vinterthour 1774, 4°, Titelradierung der frz. Ausg. (Privatbesitz, Bern).
Schellenberg fertigte noch im Jahr der Erstausgabe eine Kopie der Titelradierung für eine französische Edition, auf der die alttestamentliche Serie bereits als erster Band des 1779 mit 60 Radierungen zum Neuen Testament fortgesetzten Werks ausgewiesen ist (Abb. 5). Beide Erstausgaben bot der Verlag von Heinrich Steiner & Co. wahlweise im Oktav- oder Quartformat an. Da Lavaters Texte, die jeweils unter Schellenbergs Radierungen gedruckt sind (Abb. 6), für die französische Parallelausgabe nicht übersetzt wurden, hat diese Ausgabe entsprechend viel Seitenleerraum rund um die Bilder; einzig der Paratext des Titels, mit dem das Dargestellte knapp bezeichnet ist, wurde unterhalb der Radierungen gedruckt sowie oben rechts eine Nummerierung von 1 bis 60, die in der deutschen Ausgabe fehlt. Ein angesichts der unbedruckten Seiten etwa aufgekommener ‹horror vacui› führte mitunter zu handschriftlicher Eintragung der entsprechenden Bibel-Episoden; wobei in der Quartausgabe noch immer reichlich ‹Immakulatur› übrigblieb (Abb. 7).

Abb. 6: 60 Biblische Geschichte des alten Testamentes in Kupfer geäzt von Iohann Rudolf Schellenberg, Winterthur 1774, 8°, Nr. [5]: «Noahs Opfer», Text von Lavater (Privatbesitz, Bern).

Abb. 7: Histoires Sacrées du Vieux et du Nouveau Testament, gravées en taille douce par Jean Rodolphe Schellenberg, Tome I: Le Vieux Testamt., Vinterthour 1774, 4°, Nr. 5: «Le Sacrifice de Noë»; Exemplar mit handschriftlichen Einträgen der zugehörigen Bibelgeschichten auf den gegenüberliegenden Seiten: «aussitot que noë fut sorti de l’arche il offrit un sacrifice a dieu qui le benit et l’assura qu’il n’y auroit plus de deluge» etc. (Privatbesitz, Bern).
Der fehlerhafte deutsche Titel («60 Biblische Geschichte») wurde übernommen in die um 1780 in Prag entstandenen Kopien der Schellenberg-Serie durch Jan Jiří Balzer (1738–1799). Schellenbergs Radierungen, die ihrerseits fast ausschließlich auf bestehende Bilder aus der reichen Tradition der Bibelillustration zurückzuführen sind – für Noahs Dankopfer bediente er sich aus dem Nürnberger Figurenband Gantz neue Biblische Bilder-Ergötzung von ca. 1700 (Abb. 8) –, hat Balzer getreu kopiert, nur jeweils oben etwas verlängert; Lavaters zugehörige Texte hingegen, von Balzer direkt in die Platten radiert, erfuhren teils beträchtliche Kürzungen und Abänderungen. Im Fall der Geschichte von «Noachs Opfer» fielen die «du»-Anrede der Kinder, der direkte «hier»-Bezug aufs Bild und die vier appellierenden Reimverse weg (Abb. 9).

Abb. 8: Gantz neue Biblische Bilder-Ergötzung Dem Alter und Der Jugend Zur Beschauung und Erbauung, Aus dem alten Testament angestellet und mitgetheilet: Von Johann Andreæ Endters Seel. Söhnen in Nürnberg, [1700], Quer-4°, S. IX: «Das erste Opffer der andern Welt», geschnitten von Porzel («EP») nach Sandrart, Verse von Negelein: «Als Noah und sein Haus aufs neu die Erd betraten / bracht er GOTT Opffer dar und rühmte seine Thaten. / Wann dich des Höchsten Gnad errettet aus Gefahr / so bau du Ihm dein Herz zu einem Dank-Altar.» (Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen, Sign.: 4 BIBL UFF 707, Bd. 1).

Abb. 9: 60. Biblische Geschichte des Alten Testaments, Prag [um 1780], 8°, Nr. 5: «Noachs Opfer», radiert von Balzer nach Schellenberg/Lavater (Privatbesitz, Bern).
Weiterhin mit Impressum der «Steiner’schen Buchhandlung» erschien 1826 eine «Neue, im Texte revidirte Ausgabe» – indem Johann Jacob Bernet (1800–1851), Lehrer und Pfarrer in St. Gallen, die Lavater’schen Texte orthographisch modernisierte –, bei der die Titelradierung fehlt; an ihre Stelle ist ein typographisch gesetztes Blatt mit dem grammatikalisch berichtigten Titel «Sechszig [!] Biblische Geschichten des alten Testaments» getreten. Auf Basis dieser Neuauflage erschien 1834 in Magdeburg eine auf 72 Bibelgeschichten erweiternde lithographische Nachbildung der Schellenberg-Serie (Abb. 10), verantwortet von Judenmissionar Carl Becker (1803–1874) und mit dessen «ganz neuem Texte, da der ältere mangelhaft und unzweckmäßig erschien» (laut seiner Vorrede); die Lithographien wurden in den Magdeburger Steindruck-Instituten von Werner & Co. sowie später – da man mit deren Qualität nicht zufrieden war – von Kehse & Sohn hergestellt.

Abb. 10: Zwei und siebzig Geschichten des Alten Testaments in lithographischen Darstellungen mit dazugehorigem Texte von Carl Becker, Missionar, Magdeburg [1834], 4°, Nr. 5: «Noah’s Opfer», Steindruck von Werner & Co., Beckers Text verso fortgesetzt (Privatbesitz, Bern).
Andreas Moser, Bern
Freundschaftsalbum einer unerfüllten Liebe
Die Burgerbibliothek Bern besitzt eine grössere Sammlung von Stammbüchern, Freundschaftsbüchern und Poesiealben. Das älteste von einer Frau geführte Freundschaftsalbum ist dasjenige von Marie Elisabeth (Lise) Kuhn, geborene Wäber (1783-1850). Das 20 x 11 cm grosse, in ursprünglich veilchenfarbenen Karton gebundene und mit bescheidener Goldprägung versehene Album ist betitelt mit «Souvenir d’amitié». Es umfasst rund 200 Seiten, es enthält aber nur 26 Einträge. Rund die Hälfte der Texteinträge ist zusätzlich mit einer Illustration – Aquarellen, Federzeichnungen, Collagen oder einem eingeklebten Kupferstich - versehen. Geführt wurde das Album zwischen 1806 und 1810. Ein einziger Eintrag datiert auf 1824. Er stammt vom damals 15-jährigen Sohn Gottlieb.

Abb. 1: Marie Elisabeth Kuhn-Wäber (1783-1850) (Burgerbibliothek Bern, Porträtdok. M.112, Künstler unbekannt, Foto: Gerhard Howald).
Auf den ersten Blick unterscheidet sich das Album nicht von zeitgenössischen Freundschaftsalben. Mit einem Gedicht oder guten Wünschen verewigt haben sich erwartungsgemäss Freundinnen und weibliche Verwandtschaft, aber neben dem Sohn auch Bruder, Schwager und Ehemann Gottlieb Jakob Kuhn (1775-1849), bekannt als Dichter, Mitbegründer des Unspunnenfestes, Verfasser theologischer Streitschriften und Herausgeber des Alpenrosen-Almanachs. Zwei Einträge, nämlich derjenige des Ehemanns und derjenige von Freundin Charlotte (Lotte) Massé (1781-1813), waren für Lise von besonderer Bedeutung, verband die Drei doch eine ganz eigene Geschichte.

Abb. 2: Gottlieb Jakob Kuhn (1775-1849), porträtiert von David Sulzer (1784-1864) (Burgerbibliothek Bern, Porträtdok. M.111, Foto: Gerhard Howald).

Abb. 3: Charlotte Lauterburg-Massé (1781-1813) (Burgerbibliothek Bern, Porträtdok. 7365, Künstler unbekannt).
«I ha amene Ort es Blüemli gseh»
1799 kam der junge Theologe und Dichter Gottlieb Jakob Kuhn als junger Vikar ins hoch über den Thunersee gelegene Dorf Sigriswil. Von dort aus besuchte er pflichtbewusst die benachbarten Pfarrhäuser. Besonders gerne hielt er sich in Reichenbach bei Frutigen auf, nicht des amtierenden Pfarrers Friedrich Massé (1744-1816) wegen, den er später in seinen «Fragmenten für meine Kinder» als «kalten, trocknen, steifen Mann und zum Sterben eintönigen Prediger» beschrieb. Die zahlreichen Besuche galten vielmehr dessen Tochter Charlotte, «ein liebes, frommes, zartes, sanftes und hübsches Mädchen». Kuhn und Lotte bekannt gemacht hatte deren gemeinsame Freundin Lise Wäber. Mit der Familie Wäber verband Kuhn schon seit Kindertagen eine enge Beziehung. Lise Wäbers Mutter hatte vor ihrer Heirat mit dem Zimmermeister Franz Wäber Kuhns Mutter als Kindermädchen bei der Erziehung der fünf Kinder unterstützt, der Kontakt blieb stets eng. Sohn Franz Wäber (1781-1804) und Gottlieb Kuhn verbanden zudem das Theologiestudium und die gemeinsamen dichterischen Ambitionen.
Gottlieb Kuhn verliebte sich in Lotte, was sich unter anderem in zwei Gedichten niederschlug: «Reichenbach», in dem er Lotte namentlich nennt (1801), und «Über’m See», wo er davon träumt, wie der Heilige Beat ohne Schiff ans jenseitige Thunerseeufer zu gelangen. Franz und Lise Wäber waren Kuhns engste Vertraute in seinen Liebesnöten, denn «ich schwärmte im Stillen und träumte manchen Traum, hielt mich aber immer in geziemender Entfernung, denn mir war immer als könnte ich armer Schlucker mit dieser holden einzigen Tochter nie zusammen kommen». Nachdem Lise in Erfahrung gebracht hatte, «wie Lottens Herzen Compass stand», heckte man einen Plan aus. Die Geschwister organisierten im August 1802 eine Wanderung auf den Niesen, auf der sich Gottlieb Lotte erklären wollte. Doch es kam anders: Kurz vor dem Aufbruch zur Wanderung erreichte den Verliebten die Nachricht, dass sein ehemaliger Schüler Rudolf von Rodt unerwartet verstorben war, «ich musste also hinab zu den tief gebeugten Eltern [von Rodt nach Bern]. Man bestieg den Niesen ohne mich, der gelegene Moment war für einmal vorbei, ich kam eine zeitlang nicht mehr hinüber [nach Reichenbach], und indessen hatte ein anderer sich in ihr Herz geschlichen – mit mir war es also aus und amen!» Kuhn war untröstlich, noch mehr als 40 Jahre später notierte er bei der Niederschrift der Geschichte «treten [mir] die Tränen in die Augen». Seinen Kummer verarbeitete er erneut in Gedichten, darunter das bekannte «I ha amene Ort es Blüemli gseh», das heute noch zu den bekanntesten Schweizer Volksliedern zählt.
«Ego te semper amavi»
Die Geschwister Wäber versuchten den Unglücklichen zu trösten, so gut es ging. Schliesslich offenbarte ihm Lise, dass sie seit langem Gefühle für ihn hege, diese aber verborgen hatte, da sie «treu gegen Lotte und [Gottlieb] und vorsichtig und klug» den Beiden nicht vor dem Glück stehen wollte. Umgekehrt wusste Kuhn, dass einer seiner Freunde für Lise schwärmte, «weshalb er keinen Gedanken hegen [konnte], sie zu besitzen». 1805 endlich kam die Einsicht, «dass ich mit ihr [Lise] glücklicher als mit keiner anderen leben würde. - Ich wagte danach die Anfrage und Gottlob, sie gab mir ihr Jawort. […] Es hat uns beide nie gereut.» Am 20. Juli 1805 fand die Verlobung statt, am 23. Juli 1806 traute Pfarrer Friedrich Massé, der zwischenzeitlich in Schüpfen amtete, Lise und Gottlieb Kuhn in der dortigen Kirche. Das «Blüemli» Lotte nahm an der Feier teil. Sie heiratete 1807 Gottlieb Lauterburg und starb 1813 im Kindbett. Mit dem Ehemann seiner grossen Liebe hatte sich Kuhn schliesslich auf Bitten Lottens hin («zum Opfer für Dich, du Theure!») versöhnt, die Familien blieben danach in freundschaftlichem Kontakt.
Trotz offenbar glücklicher Ehe mit Lise Wäber trauerte Gottlieb Jakob Kuhn Lotte Massé zeitlebens nach. Noch im Juni 1805, also einen Monat vor seiner Verlobung mit Lise, verfasste er ein Gedicht «Bey Lottens Abschied». Und noch mehr als 40 Jahre später im hohen Alter notierte er: «Ruf ich ihr nach: Ego te semper amavi. Et si quid faciam nunc quoque quaeris amo» (Ovid, Remedia amoris).
Zeichen einer unerfüllten Liebe?
Die unerfüllte Liebe zu Lotte scheint sich sogar im Freundschaftsalbum seiner Frau Lise widerzuspiegeln. Am Tag ihrer Hochzeit eröffnete Gottlieb Kuhn das Freundschaftsalbum - wohl als ein Hochzeitsgeschenk - mit einem Titelblatt, das stark an die letzte Strophe des «Blüemli»-Liedes erinnert: «U wen i einisch gstorbe bi, / U d’s Blüemeli o verdirbt, / So thue mer dee mys Blüemeli, / Zu mir uf d’s Grab, i bitte di. / O Blüemeli my! / O Blüemeli my! / I möchte geng by der sy.»

Abb. 4: Gottlieb Jakob Kuhn war auch zeichnerisch begabt. Mit diesem Bild eröffnete er das Freundschaftsalbum seiner Frau am Tag ihrer Hochzeit am 23. Juli 1806. Das Motiv erinnert stark an sein «Blüemli»-Lied (Burgerbibliothek Bern, Mss.h.h.LI.340, S. Titelblatt).
Auch der nachfolgende Eintrag mit der Warnung vor falschen Freunden will nicht so recht zur jungen Braut passen. Ja, fast meint man darin eine Stelle in Johann Wolfgang Goethes «Römischen Elegien» («Aber ganz abscheulich ist’s, auf dem Wege der Liebe Schlangen zu fürchten, und Gift unter den Rosen der Lust.» Röm. Elegien XVIII) mitschwingen zu hören. Goethe warb damals um Charlotte (!) von Stein. Kuhn dürfte die 1795 erschienenen Elegien gekannt haben.

Abb. 5: «Trit[t]’st du hinaus in die Welt, dann pflücke dir Rosen zu Kränzen. /
Siehe! Die blühen unser, schön, wie mein Herz sie dir wünscht. /
Aber es warnet der Freund: gewahre, Freundin, die Schlange, /
Welche gleissend doch falsch unter den Blumen dir lauscht. /
Götter! Gefiele es Euch dass, meine Schwester zu schirmen, /
Immer ich nahe um sie wäre ein Warner und Freund.
Bern den 23ten. Julii 1806. G.J. Kuhn»
(Burgerbibliothek Bern, Mss.h.h.LI.340, S. 2f.).
Und umgekehrt verewigte sich die noch unverheiratete Lotte Massé am 24. März 1807 mit einer Beschwörung zukünftiger Freundschaft.

Abb. 6a: «O! Nicht nur blos für dies Leben / Dieser schnelle Augenblik / Was die Freundschaft uns gegeben / Nein sie wächst dem reineren Glük / Einer besseren Welt entgegen / Uns hier lieblich aufgeblüht / trägt sie dort erst Frucht und Segen / Wo der Trennung Sturm entflieht.
Schüpfen den 24ten. Merz. 1807 / Bey Durchlesung dieser Zeilen, erinner dich an deine treue Freundin, Charlotte Masse» (Burgerbibliothek Bern, Mss.h.h.LI.340, S. 26f.).
Sie illustrierte ihren Eintrag mit einer Schäferin, die ein Lamm in den Armen hält. Ob Lotte bewusst war, dass in der Tradition der Hirtendichtung ein beliebtes Thema das der abweisenden Geliebten war, nach der sich ein Liebender sehnt und leidet?

Abb. 6b: Zeichnung der Charlotte Massé (Burgerbibliothek Bern, Mss.h.h.LI.340, S. 27).
Literatur
- Gottlieb Jakob Kuhn, Fragmente für meine Kinder, begonnen im August 1815, beendigt am 25. Oktober 1842 (Burgerbibliothek Bern Mss.h.h.LI.305).
- Marie Elisabeth Kuhn-Wäber, Souvenir d’amité, 1806-1810 (Burgerbibliothek Bern, Mss.h.h.LI.340).
- Gottlieb Jakob Kuhn, Volkslieder und Gedichte. Bern 1806.
- Heinrich Stickelberger, Der Volksdichter Gottlieb Jakob Kuhn (1775-1849), in: Neujahrs-Blatt der Literarischen Gesellschaft Bern auf das Jahr 1910. Bern 1909.
Claudia Engler, Bern
-

(1/7) -

(1/7) -

(1/7) -

(1/7) -

(1/7) -

Abb. 6a: «O! Nicht nur blos für dies Leben / Dieser schnelle Augenblik / Was die Freundschaft uns gegeben / Nein sie wächst dem reineren Glük / Einer besseren Welt entgegen / Uns hier lieblich aufgeblüht / trägt sie dort erst Frucht und Segen / Wo der Trennung Sturm entflieht.
Schüpfen den 24ten. Merz. 1807 / Bey Durchlesung dieser Zeilen, erinner dich an deine treue Freundin, Charlotte Masse» (Burgerbibliothek Bern, Mss.h.h.LI.340, S. 26).
(1/7) -

(1/7)
Der Pilot aus Casablanca - Auf den Spuren eines Mythos
Das Drehbuch des Films Casablanca beginnt mit einer Beschreibung von Lissabon als Hafen der Hoffnung im Zweiten Weltkrieg, Ziel aller Flüchtlinge aus dem besetzten Mitteleuropa: „Zu Beginn des Zweiten Weltkriegs richteten sich viele Augen im gefangenen Europa hoffnungsvoll oder verzweifelt auf die Freiheit der Vereinigten Staaten. Lissabon wurde zum großen Einschiffungshafen. Aber nicht alle schafften es, direkt nach Lissabon zu kommen“ (1).
Der Film erzählt die Geschichte von Ilse Lund und Victor Laszlo, die während des Krieges nach Lissabon fliehen. Eine Karte zeigt die Fluchtroute: von Paris nach Marseille, über das Mittelmeer nach Oran, entlang der Küste nach Casablanca, damals ein Teil von Französisch-Marokko. Der Film endet mit einer berühmten Schlussszene: Humphrey Bogart (Richard Blaine) nimmt Abschied von Ingrid Bergman (Ilsa Lund), bevor sie mit Paul Henreid (Victor Laszlo) das Flugzeug nach Lissabon besteigt. Die Motoren dröhnen – doch wer sitzt im Cockpit? Wer ist der Pilot?

Abb. 1: Der Autor des Buches, José António Barreiros.
Der Jurist und Schriftsteller José António Barreiros hat sich auf die Suche nach diesem Mythos begeben und ist in seiner Biographie fündig geworden: Es handelt sich um einen portugiesischen Militärpiloten mit Namen José Cabral (1897-1984), der als Einziger zum Zeitpunkt, der im Film erwähnt wird (2.-4. Dezember 1941) die Route Lissabon-Tanger-Casablanca fliegen durfte. Den französischen Piloten wurden im Waffenstillstandsabkommen zwischen Nazideutschland und Vichy-Frankreich alle Auslandmissionen verboten.

Abb. 2: Das Cover des Buches.
José Cabral hatte seine Karriere bei der Aviação Naval, der nach dem Ersten Weltkrieg aufgebauten portugiesischen Luftwaffe begonnen. Er wurde auf Missionen nach Afrika und nach Macau eingesetzt, damals eine portugiesische Kolonie in China (1927-1932). Angesichts des im Reich der Mitte herrschenden Bürgerkriegs entstand eine enge Zusammenarbeit mit der Royal Air Force in Hongkong, damals britische Kronkolonie.
Zurück in Lissabon nahm José Cabral seinen Abschied von der Luftwaffe und engagierte sich in der zivilen Luftfahrt bei der Aero Portuguesa, Vorgängerin der TAP, mit einer Beteiligung der Air France von 75%. 1934 gegründet, war die Aero Portuguesa nach unspektakulären Anfängen beim Aufbau diverser Flugverbindungen nach Afrika erfolgreich. Zu Beginn des Zweiten Weltkriegs reduzierte sich ihre Aktivität auf das Dreieck Lissabon-Tanger-Casablanca mit einer einzigen Maschine und einem einzigen Piloten – José Cabral.
Doch dies war nur die eine Seite der Medaille. Diese Linie - die einzige Verbindung zwischen Nordafrika und dem letzten freien Hafen Europas, Lissabon – hatte eine geheime Dimension, eine Art Krieg im Krieg: „Die humanitäre Mission, während des Krieges Flüchtlinge aus Afrika herauszuholen, wird niemals in Vergessenheit geraten“, erklärt José Cabral in einem Interview. „Damals hätte ich nie gedacht, dass ich 28 Flüge pro Monat durchführen sollte, um Flüchtlinge aus Mitteleuropa nach Portugal zu transportieren, die dann nach England oder in die Vereinigten Staaten weiterreisten“. Die Schlussszene von Casablanca hat einen realen Hintergrund – die Vorbereitung der alliierten Landung in Nordafrika, die Operation Torch (1942).
Albert von Brunn (Zürich)
Barreiros, José António: O piloto de Casablanca. Alfragide: Oficina de Livros, 2023.
--------------------------------------------
(1)Weber, Ronald. The Lisbon Route: entry and escape in Nazi Europe. Lanham: Ivan R. Dee, 2011.
(2)Lochery, Neill. Lisbon: war in the shadows of the city of light 1939-1945. New York: Public Affairs, 2011.
(3)Pimentel, Irene Flumser und Christa Heinrich. Zuflucht am Rande Europas: Portugal 1933-1945. Leipzig: Hentrich & Hentrich, 2022.
Le Noyer - Der Nussbaum
Kleiner Gedichtzyklus, geschrieben 1924 auf Bitten von Jeanne de Sépibus-de Preux, die den Dichter in ihrem Garten in Sierre unter einem Nussbaum zu empfangen pflegte.
Petit cycle de poèmes écrit en 1924 à la demande de Jeanne de Sépibus-de Preux qui a souvent reçu le poète sous le noyer de son jardin à Sierre.

Einband des Büchleins
Rainer Maria Rilke lebte von 1921 bis 1926 im Château de Muzot in Veyras oberhalb von Sierre/Siders im Kanton Wallis. 1921 war das Herrenhaus aus dem 13. Jahrhundert von dem Schweizer Kaufmann und Kunstmäzen Werner Reinhart gekauft worden, der es Rilke mietfrei überließ. Jeanne de Sépibus-de Preux, eine ortsansässige Adlige, besuchte den Dichter dort mehrfach und wünschte von ihm ein Gedicht. Sie wusste zwar, dass er Dichter war, wie berühmt er damals bereits war, wusste sie jedoch nicht.
So schrieb er am 12. Juni für sie in ein Büchlein einen kleinen Zyklus über einen Nussbaum, da Mme de Sépibus ihn in ihrem Garten unter einem Nussbaum zu empfangen pflegte. Es ist das einzige Rilke-Gedicht, das er auf Bestellung anfertigte.
Als Rilke bei ihr und ihrem Mann zum Abendessen eingeladen war, legte er das Büchlein unter ihre Serviette, zusammen mit einer Rosenknospe.
Das Büchlein enthält folgende Widmung:
à Madame Jeanne de Sépibus-de Preux
Quelques aperçus, qu’on n’aurait pas osé d’offrir sans commande expresse
RMR

Das Originalmanuskript befindet sich in der Fondation Rilke in Sierre. Ein Facsimile (hergestellt von Wolfau Druck AG Weinfelden) kann dort erworben werden.
Im Mai 1967 schenkte Jeanne de Sépibus der Stadt Sierre Handschriften, Briefe und andere an Rilke erinnernde Gegenstände aus ihrem Besitz, darunter das Manuskript des Gedichts «Le Noyer» und 38 Briefe Rilkes an sie. Diese Dokumente wurden im ‘Blauen Salon’ des Rathauses ausgestellt. Nach dem Tod der Donatorin kam ein weiterer Teil ihres Nachlasses hinzu, bestehend aus Salonmöbeln, Porträts und Fotografien. Das ihr gewidmete Manuskript der «Quatrains Valaisans», das sie an einen Londoner Antiquar veräussert hatte, konnte von einigen Einwohnern der Stadt Sierre zurückgekauft werden und gehört heute zum Archiv der Fondation Rilke.
Text:
I
Arbre qui, de sa place,
fièrement arrondit
tout autour cet espace
de l'été accompli,

arbre dont le volume
rond et abondant
prouve et résume
ce que l'on attend longtemps:
j'ai pourtant vu rougir
tes feuilles en devenant vertes:
de cette pudeur offerte
ta magnificence, certes,
les veut à présent punir.

II
Arbre, toujours au milieu
de tout ce qui l'entoure -,
arbre qui savoure
la voûte entière des cieux,

toi, comme aucun autre
tourné vers partout:
on dirait un apôtre
qui ne sait pas d'où
Dieu lui va apparaître...
Or, pour qu'il soit sûr,
il développe en rond son être
et lui tend des bras mûrs.

III
Arbre qui peut-être
pense au dedans:
antique Arbre-maître
parmi les arbres servant!

Arbre qui se domine,
se donnant lentement
la forme qui élimine
les hasards du vent:
plein de forces austères
ton ombre claire nous rend
une feuille qui désaltère
et des fruits persévants.

Écrit le 12 juin 1924, Muzot

Aus: Poèmes et Dédicaces (1920-1926)
Wolfram Schneider-Lastin (Zürich)
Texte von Augenzeugen
hrsg. von Curdin Ebneter und Erich Unglaub
«Ein Monumentalwerk, das dem Dichter auf grandiose Weise gerecht wird.» Paul Jandl, NZZ
In über zehn Jahren Arbeit haben Curdin Ebneter und Erich Unglaub rund 800 Zeugnisse, darunter viele, die bislang unbekannt waren oder hier erstmals ins Deutsche übersetzt wurden, zusammengetragen. Illustriert mit zahlreichen Fotos macht diese dreibändige Edition einen der größten deutschsprachigen Lyriker ganz neu zugänglich.

Der Sohn eines Eisenbahnbeamten, der wie Onkel und Mutter eine Schwäche für den Adel hatte. Der Ehemann, den es aus dem norddeutschen Moor nach Paris zog. Der Kriegsgegner, dessen Cornet in den Schützengräben beider Seiten gelesen wurde. Der heimatlos Umherziehende, der manchmal in Schlössern zu Gast war. Ein Liebling der Frauen, der auf mönchische Zurückgezogenheit hielt. Der Turmbewohner im Wallis, der zwei der berühmtesten Gedichtzyklen der Weltliteratur schuf. Doch was weiß man wirklich über den Menschen Rainer Maria Rilke?
Kaum ein anderer Autor scheint besser geeignet, en face porträtiert zu werden als Rilke – schon sein Äußeres wirkte auf viele Zeitgenossen faszinierend: seine eisblauen Augen, sein Seehundschnauzbart und seine sensiblen Hände. Rätselhaft erschien sein bindungsloses Leben zwischen Prag, Berlin, München, Worpswede, Wien, Venedig, Rom und Duino. Vor allem aber übte seine Dichtung eine magische Anziehungskraft aus – eine Wirkung, die bis heute nicht nachgelassen hat. Verfestigt hat sich dabei das Bild eines großen Dichters, dessen Aura ihn von aller Lebensnähe entrückt. Folgerichtig erschienen die Ausgaben seiner Briefe meist ohne die Antworten seiner KorrespondentInnen; die Erinnerungen von Literaten, Freunden, Verehrerinnen und Zufalls besuchern wurden, wenn überhaupt, nur an ephemeren Orten publiziert. Kaum rezipiert sind schließlich die aufschlußreichen fremdsprachigen Rilke-Erinnerungen aus Skandinavien, Rußland, Frankreich und Italien.
Mit dem 4. Band der Reihe En Face liegt erstmals eine umfassende Sammlung von Berichten vor, die Rilke aus der Perspektive seiner Zeitgenossen zeigen; darunter sind prominente Namen wie Stefan Zweig, Thomas Mann, Jean Cocteau oder Boris Pasternak, aber auch Stimmen von nebenan. Dokumentiert sind despektierliche Militäranekdoten von Theodor Csokor und Pikanterien von Claire Goll neben Berichten über glückliche Tage in der Schweiz oder von Begegnungen mit dem wahlverwandten Paul Valéry. Rund 800 Zeugnisse und zahlreiche unbekannte Fotos machen einen der größten deutschsprachigen Lyriker ganz neu zugänglich.
Curdin Ebneter, Erich Unglaub (Hrsg.)
Erinnerungen an Rainer Maria Rilke
3 Bände im Schuber, Broschur, Fadenbindung
1450 Seiten, 1100 Illustrationen
ISBN 978-3-907142-87-5
EUR 98,00 | CHF 98.00
Vor 50 Jahren verstarb der Zürcher Künstler Hans Witzig (1889–1973). Während sein Name heute nur mehr wenigen bekannt ist, blieben seine Kinderbuchillustrationen und Zeichenhefte vielen in liebevoller Erinnerung. Darüber hinaus schuf er Werke, die ihn als experimentierfreudigen und vielseitigen Künstler seiner Zeit ausweisen.
Zu seinem 50. Todesjahr ist eine Publikation als Neujahrsblatt der Antiquarischen Gesellschaft in Zürich in Kooperation mit der Zentralbibliothek Zürich erschienen. Die Grundlage dafür bildet der umfangreiche Nachlass Hans Witzigs, der seit 1983 in der Zentralbibliothek aufbewahrt wird.

Abb. 1: Vom Schlaraffenland zum Totentanz. Der Zürcher Illustrator und Zeichenlehrer Hans Witzig, hg. von Anna Lehninger, Mitteilungen der Antiquarischen Gesellschaft in Zürich, Bd. 90, Zürich: Chronos Verlag, 2023, Einband.
Weitere Abbildungen - ausser den hier im Text inserierten - sehen Sie durch Klicken auf die Abbildung oben rechts bzw. - auf dem Handy - am Ende des Beitrags.
Punkt, Punkt, Komma, Strich
Der Sammelband fächert Hans Witzigs Vielseitigkeit in all ihren Facetten auf: In vier Schwerpunktessays und 21 Einzelwerkbetrachtungen besprechen Spezialist:innen aus unterschiedlichen Forschungsgebieten Werkgruppen und ausgewählte Arbeiten aus ihrer fachlichen Perspektive und ordnen Witzigs Zugang zum jeweiligen Thema ein. Das künstlerische Schaffen des Zürcher Zeichners und Zeichenlehrers, Kinder- und Schulbuchillustrators, Jugendschriftstellers, Malers und Plastikers hat über Jahrzehnte die Kindheit und Jugend von Schweizer:innen ästhetisch nachhaltig geprägt: Durch seine Zeichenanleitungen war Witzig in den Jugendjahren vieler präsent. Für den Schematismus seiner Anleitungen im Zeichnen wurde er auch kritisiert, sein Hauptwerk Punkt, Punkt, Komma, Strich von 1944 ist aber immer noch erhältlich.

Abb. 2: Punkt, Punkt, Komma, Strich. Zeichenstunden für Kinder von Hans Witzig, München: Ernst Heimeran Verlag, 1944, Einband.
Bilderbücher, Lesebücher, Jugendbücher
Witzigs Illustrationen finden sich zudem in zahlreichen Kinder- und Jugendbüchern wie Die Kinder im Schlaraffenland, Tabis Nuckerli oder Johanna Spyris Heidi.

Abb. 3: Die Kinder im Schlaraffenland, Bilderbuch von Hans Witzig, mit Versen von Karl Stamm, Zürich: Gebr. Stehli, 1917, o. S.
Durch die Zusammenarbeit mit namhaften Schweizer Autori:nnen wie Olga Meyer oder Alfred Huggenberger profilierte sich Witzig, der auch selbst Bücher schrieb, als kongenialer Illustrator der Texte anderer. Wenig bekannt sind heute seine sozialkritischen Arbeiten wie politische Karikaturen um 1920 oder der Bildzyklus Die Graue Strasse von 1933. Seine makaber-düstere Seite wird in Totentanz-Illustrationen von 1919 greifbar.

Abb. 4: Hans Witzig, Entwurf zu Totentanz 1914-1918, Rötel und Bleistift auf Papier, Zentralbibliothek Zürich, Graphische Sammlung und Fotoarchiv, Wih O 118_19.
Darüber hinaus illustrierte er auch Schulbücher wie das Lesebuch zur Heimatkunde der Stadt Zürich, in dem er historische Vorbilder als Grundlage verwendete. Auch 1945 arbeitete er für die Illustrationen seines Jugendbuchs Fortunatus mit historischen Vorlagen, ebenso 1968 für seinen Kriminalroman Der Nachtschratt ging um. 1969 erhielt Witzig für sein Gesamtwerk den Schweizer Jugendbuchpreis.

Abb. 5: Hans Witzig, Fortunatus. Seine wunderlichen Abenteuer in Wort und Bild, Bern: Francke, 1945, S. 225.
Buch zur Ausstellung
Die Publikation erscheint auch als Katalog zur aktuellen Ausstellung über Hans Witzig in der Zentralbibliothek Zürich (17. März bis 17. Juni 2023), die zahlreiche Originalwerke vor allem aus der Graphischen Sammlung der Zentralbibliothek sowie ausgewählte Leihgaben präsentiert. Entlang biografischer Stationen stellt sie zentrale Werke des Künstlers sowie seine Spuren in der Nachwelt vor. In der Ausstellung kann das Buch zum Spezialpreis von CHF 35 erworben werden.
Anna Lehninger, Zürich
Vom Schlaraffenland zum Totentanz. Der Zürcher Illustrator und Zeichenlehrer Hans Witzig, hg. von Anna Lehninger, Mitteilungen der Antiquarischen Gesellschaft in Zürich, Bd. 90, Zürich: Chronos Verlag, 2023. 176 Seiten, 240 Abbildungen. CHF 48.00. ISBN 978-3-0340-1706-0.
Klar, ein hübscher Rücken kann entzücken, gerade bei Büchern. Der hässliche Rücken einer dünnhäutig zerfingerten Interimsbroschur, aus Buchhändlershänden über Jahrhunderte bis heute erhalten (Abb. 1), entzückt aber manchmal noch mehr; konnte die Broschur doch, wie jedes andere Papier, durch Textbedruckung als Kommunikationsmittel dienen: zwecks verlegerischer oder auktorialer Information der Erstkäuferschaft. Ihrem akzidentellen Charakter entsprechend, quasi Makulatur, überliefert sich solche Information je länger, desto seltener. – Was hinter der Fassade erodierter Papierbroschur-Rücken liegt, die den Blick auf die Kannelur der Bogenlagen freigeben, ist meist nicht schlechter erhalten – mit Sicherheit breitrandiger – als bei gebundenen Exemplaren, und auf die inneren Werte kommt’s doch auch an.

Abb. 1: Lavaters Messiáde, vier Textbände, 1783–1786, Interimsbroschur-Rücken (Privatbesitz).
Johann Caspar Lavaters Bibelepos über Jésus Messías (Oder Die Evangêlien und Apostelgeschichte, in Gesängen) wurde ab 1783 (Abb. 2) in vier Bänden in Basel und Winterthur produziert und mit reichlicher Verzögerung um eine 1787 abgeschlossene Serie von 72 Radierungen im Oktavformat ergänzt, zu der Lavater dann wiederum 72 kritische Kurzkommentare drucken ließ (Abb. 3).
Abb. 2: Lavaters Messiáde, Textband 1, 1783, Umschlag-Innenseite (Preisangabe: 1 Gulden 44 Kreuzer) und Titelblatt (Privatbesitz).

Abb. 3: Lavaters Messiáde, Tafelband (komplett 1787), Nr. 5 zu Bd. 1: Die Mágier vor dem neugebohrnen Messías, radiert von Berger in Berlin 1782 nach Schellenberg und Chodowiecki, heftweise ausgeliefert 1784 mit Lavaters Kurzkommentar zu Entstehung («nach Herrn Schellenberg») und Ausführung («der nicht zärtlich genug gezeichnete Mund der heiligen Mutter und ihre mehrerer Zartheit bedürfenden Hände») (Privatbesitz).
Die sprechendsten Zeugen der verzögerten Tafel-Auslieferung finden sich auf der in Basel bedruckten Interimsbroschur dieser von Beginn an bimedial konzipierten Messiáde, zunächst mit Stellungnahmen des sonst nirgendwo firmierenden Winterthurer Verlegers Johann Heinrich Steiner, auf dem letzten Band dann mit etwas defätistischer Entschuldigung Lavaters selbst. Dass die kollaborativ an den Tafeln arbeitenden Künstler europaweit zerstreut in Rom, Berlin, Nürnberg und Winterthur lokalisiert waren, vom Pfarrerpoeten im Logistikzentrum an der Zürcher St. Peterhofstatt koordiniert und streng kritisiert, der Entwürfe und Tafeln von hier nach da und dort vielmals hin und her spedieren ließ, macht die verzögerte Tafel-Auslieferung gleichsam objektiv verständlich; den Wortbruch aber galt es der bezahlenden Kundschaft zu erklären, und die Broschur-Rückseite der tafellos expedierten Textbände bot sich als das Medium der Wahl zu diesem Zweck an (Abb. 4).
Abb. 4: Lavaters Messiáde, Textbände 3 und 4, Umschlag hinten (Privatbesitz).
Vignetten und Akzente
Wie aus Lavaters Briefwechseln hervorgeht, hatte er erstmals bereits 1771 vorgesehen, im damals federführenden Verlag von Philipp Erasmus Reich in Leipzig ein poetisches Werk über «das Evangelium, oder die Geschichte Jesu Christi» zu publizieren (so schrieb er im Februar 1771 an Reich, zit. aus Moser 2020, S. 74). Dann kamen Lavaters Großprojekte, namentlich die Physiognomischen Fragmente dazwischen, die ab 1773 im Doppelverlag für Reich und die neugegründete Winterthurer Buchhandlung (ohne Druckerei) von Steiner & Co. geplant und produziert wurden.
1780 erschien bei Johann Caspar Füssli d. J., Steiners Zürcher Associé (mit Druckerei), Lavaters ‹erste Messiade› (Jesus Messias, oder die Zukunft des Herrn), mit insgesamt 40 Vignetten (Abb. 5), hauptsächlich von Johann Rudolf Schellenberg in Winterthur radiert (Thanner, Bd. 1.1, S. 204-213). Bei Reich in Leipzig waren wenig später Lavaters Poesieen im Druck; sie erschienen 1781 in zwei Bänden mit zehn Schlussvignetten (Abb. 6) nebst Titelvignette (Thanner, Bd. 1.1, S. 215). Und nun, zehn Jahre nach seiner ersten Anfrage bei Reich, kam Lavater auch wieder auf die «Meßiade» als sein bisheriges «Hauptwerk für’s Christenthum und die christliche Leserwelt» zu sprechen, das in Leipzig «aufs gustoseste und properste gedrukt» werden sollte (Lavater an Reich, 27.04.1781, Abschrift, ZBZ, FA Lav, Ms 578, Nr. 33, S. 1).

Abb. 5: Lavaters ‹erste Messiade›, 1780, Vignette zu S. [187], nach Chodowiecki (Zentralbibliothek Zürich, https://doi.org/10.3931/e-rara-87942).

Abb. 6: Lavaters Poesieen, 1781, Bd. 1, Vignette zu S. 120 (Privatbesitz).
Im November 1781 formulierte Lavater erstmals den auch aus dem Titel ersichtlichen Wunsch, seine Messiáde mit «accentuirten Vokalen» setzen zu lassen; wenn auch «vielleicht […] die accente» erst «noch gegossen», dabei aber «so klein wie möglich gemacht werden» müssten (Lavater an Reich, 03.11.1781, SUB Hamburg, LA Lav, Nr. 137). – Dieser Einfall wie überhaupt die Grundidee seiner Messiáde dürfte von Friedrich Gottlieb Klopstock inspiriert worden sein, der beispielsweise seine 1754 entstandene Ode Die Genesung mit diakritischen Lesehilfen versehen und dazu angemerkt hatte: «Da einige die Silbenzeit unserer Sprache nicht genug kennen; so habe ich jene zuweilen bezeichnet. Ich habe dieses vielleicht zu selten gethan; ich konte es aber auch leicht zu oft thun» (Klopstock, S. 143). Bei Lavater sollten die für seine Messiáde entwickelten Vokal-Akzentuierungen bald zum Selbstläufer werden; er setzte sie bei erster Gelegenheit auch in Prosa- und Akzidenztexten ein, so in den Kurzkritiken zu den Messiáde-Tafeln (Abb. 3) und in seiner Stellungnahme auf dem Broschur-Text zum letzten Messiáde-Band (Abb. 4).
Wohl nicht zuletzt wegen Lavaters detaillierten Ansprüchen punkto Papier und Druck (die Verse sollten durchaus ohne Umbrüche gesetzt werden) und aufgrund des Sonderwunschs mit den Vokal-Diakritika in Fraktur-Satz lehnte Reich zum Jahresende 1781 den Druck und Verlag der Messiáde ab. Lavater scheint dafür Verständnis gehabt zu haben und informiert Reich in seinem letzten Billett aus diesem Kontext: «Haas», nämlich der Basler Drucker und Schriftschneider Wilhelm Haas, «gießt mir accente» (Lavater an Reich, 15.12.1781, UB Leipzig, Rep. IX 5/272). – Von der typographischen Handwerkskunst des frühberufenen Haas, Sohn eines Nürnberger Schriftgießers, zeugt bereits das zweifarbig in Antiqua und Fraktur auf Kleinoktav-Blättchen mit Bordüre gedruckte, laut Titelblatt dem gesellschaftlichen Vergnügen bestimmte Werk Das Geheimniß von 1774 (gesetzt und gedruckt von Wilhelm Haas / der Typographie Gewidmeten / s. Alters 8 Jahre; als Faksimile zur Bibliophilen-Jahrestagung 1944 in Engelberg den Teilnehmern überreicht von der Haas’schen Schrieftgießerei, Münchenstein). Ab 1779 war Haas mit dem Buchdrucker Johann Jacob Thurneysen assoziiert. Nach Reichs Absprung in letzter Minute wurde Lavaters Messiáde ab 1782 denn auch in ebendieser Basler Offizin gedruckt – mit den von Haas gegossenen Vokal-Akzenten –, für den Steiner’schen Verlag in Winterthur. Die Witwe des 1739 verstorbenen Emanuel Thurneysen hatte dessen Teil der Firma «Gebrüder Thurneysen» noch einige Jahre weitergeführt, sich 1743 aber geschäftlich von ihrem Schwager Johann Rudolf Thurneysen getrennt und die Teilhabe ihrem in Tübingen bei Cotta ausgebildeten, damals 20-jährigen Sohn Johann Jacob verkauft, der die Buchhandlung und Druckerei unter dem Namen seines Vaters führte. So firmiert dieser Johann Jacob auch im Kolophon von Lavaters Messiáde als «Emanuel Thurneysen» (die Firma blieb bis zur Geschäftsaufgabe um 1840 bestehen). – Lavaters Cousine und Chronistin Anna Barbara von Muralt notierte am 20. November 1782, er habe von Thurneysen aus Basel nun erste «Mesiaden»-Probebogen erhalten: «Mit accenten!», was ihr «ein etwas sonderbahrer Einfahl zu seyn» schien (Muralt, S. 182).
Säumende Künstler, drängender Verfasser und Verleger
Lavaters Messiáde «gehört zu den schönsten schweizerischen illustrierten Büchern des 18. Jahrhunderts» (Leemann-van Elck, S. 190). Neben Schellenberg waren an den 72 Tafeln hauptsächlich Daniel Nikolaus Chodowiecki (Berlin) und der als Jüngling bei Lavater 1773 eingestellte Johann Heinrich Lips beteiligt (ab 1780 auf Deutschlandreise und in Rom). Lavater schmeichelte einerseits seinem Zögling Lips, dessen «Arbeiten» seien und blieben «immer die beßten, die mir gemacht werden» (Lavater an Lips, 03.10.1782, Abschrift, ZBZ, FA Lav, Ms 572, Nr. 106, S. 2), anderseits zugleich Chodowiecki, den er durchaus «der Mitarbeit an den Kupfern der Messiade nicht entladen» könne: «Es ist etwas in allen Ihren Arbeiten, das ich in keinem andern finde»; zudem sei die Mitarbeit des berühmten Illustrators «schon öffentlich angezeigt» (Lavater an Chodowiecki, 21.12.1782, Abschrift, ZBZ, FA Lav, Ms 556, Nr. 27, S. 1). Chodowiecki, der bald auch seinen Berliner Kollegen Daniel Berger als Mitarbeiter für die Messiáde-Tafeln vermittelte, hat öfters auf Lavaters Geheiß die ihm zugeschickten Entwürfe Schellenbergs «verbessert»; so auch eine «Zeichnung des Kindlein Jesus» für den Beginn der Messiáde (ebd.; das Resultat in Abb. 3).
Anfang 1783 wandte sich Lavaters Sekretär Johann Michael Armbruster mit einem beschwichtigenden (wegen empfundener «Beleidigungen»), aber weiterhin primär drängenden Schreiben an Chodowiecki, das in «die Einzige Bitte» mündete, «keine unserer Bitten, die hier vorstehen, abzuschlagen, da wir gedrungen sind, den 1. Theil dieser Messiade auf Ostern zu liefern – und nur Sie helfen können» (Armbruster an Chodowiecki, 27.01.1783, zit. aus Steinbrucker, S. 401, Nr. 553).
In Reichs Katalog zur Leipziger Herbstmesse 1782 war Lavaters «Messiade. Mit Kupfern auf schönem Schreibpap. und ohne Kupf. auf gutem Druckpap.» («bey Steinern und Comp.») wirklich bereits angekündigt worden (Allgemeines Verzeichniß, Herbst 1782, S. 484). Man wollte also den angepeilten Termin der Ostermesse 1783 einhalten. Im ersten Messkatalog 1783 wurde Lavaters «neue Messiade» («oder die vier Evangelien und Apostelgeschichte in Hexameter, mit accentuirter Schrift») denn auch unter den fertig gewordenen Büchern angezeigt (ebd., Ostern 1783, S. 561), sowohl in der Ausgabe «auf Druckpap. ohne K.» als vollmundig auch auf «Schreibpap.» mit Kupfern («m. K.»). Tatsächlich aber lagen die 18 Kupfer zum ersten Band damals eben noch nicht komplett vor. Ausgeliefert wurde auf Ostern der bei Thurneysen gedruckte Textband, in der Vorzugsausgabe mit immerhin vier Schlussvignetten (Thanner, Bd. 1.1, S. S. 237). Eine davon, am Ende des ersten Gesangs, stellt einen Betenden dar, in Nürnberg von Andreas Leonhard Moeglich nach Chodowieckis Zeichnung radiert (Abb. 7).

Abb. 7: Lavaters Messiáde, Textband 1, 1783, Vignette zu S. 9, Moeglich nach Chodowiecki (Privatbesitz).
Das Sujet findet sich indes, auf Chodowieckis früheren Entwurf zurückgehend, bereits in Lavaters ‹erster Messiade› 1780 (Abb. 5) sowie auch – wahrscheinlich von Schellenberg radiert, aber unsigniert – in den Poesieen 1781 (Abb. 6), leicht variiert respektive durch den Kopiervorgang gespiegelt. Der zweite Textband der Messiáde hat drei weitere Vignetten (als ‹culs-de-lampe› bei hinreichend freiem Seitenraum); im dritten und vierten Band gibt’s keine mehr.
Die immer auswegloseren, alle Messkatalog-Versprechen Lügen strafenden Verzögerungen in der Tafel-Auslieferung dokumentiert neben den Interimsbroschur-Informationen auch stellenweise der Briefwechsel Chodowieckis mit Lavater, der seit rund 100 Jahren ediert vorliegt (Steinbrucker). Daraus geht hervor, dass Buchhändler Steiner, der sich auf vertragliche Regelungen berufen konnte, nach zwei Jahren seine Geduld verlor; so schrieb Lavater im Sommer 1785, über ein Jahr nach Erscheinen des zweiten Messiáde-Textbands weiterhin um die zugehörigen Tafeln besorgt, an Chodowiecki: «Ach! Lieber! Zürnen Sie nicht, daß ich zürnen muß – schier verschmachten muß unter dem Ausbleiben der Kupfer zur Messiade. Hart daran ist’s, daß mein Verleger mir einen Prozeß machen will – Senden Sie mir doch mit umgehender Post eher alles, wie’s ist, vollendet od. unvollendet, daß ich nur meinen Verleger beruhigen, und ihm meine Unschuld zeigen kann. […] Publikum, Verleger, Setzer, Drucker stürmen täglich auf mich.» (Lavater an Chodowiecki, 29.06.1785, zit. aus Steinbrucker, S. 450f., Nr. 612.)
Auch Chodowiecki platzte eines Tages der Kragen: Dass Lavaters «Verleger», ebenjener Steiner, «unangenehme Auftritte wegen Verzögerung des Wercks durch die Kupferstiche» gemacht habe, sei «unbillich»; man könne eine solche Arbeit «nicht übereilen», und «wenn der Verleger es ankündigen will muß er erst mit den Künstlern […] eins sein […], sonst macht er seine rechnung ohne Wirth» (Chodowiecki an Lavater, 07.01.1786, ZBZ, FA Lav, Ms 505, Nr. 200, S. 2f.). – An Johann Jakob Stolz meldete Lavater einige Monate später, trotz Abschluss der Textbände keineswegs erleichtert: «Auf den heütigen Tag fehlen mir noch drey Tafeln zum III. Hefte Messiade […]. Daß ich den 31. März die Messiade vollendet, wissen Sie vielleicht schon. Ich kann’s noch nicht glauben, bis ich alle vier Bände gebunden vor mir sehe, welches freylich noch eine Weile anstehen wird.» (Lavater an Stolz, 05.04.1786, zit. aus Schulz, S. 95, Nr. 12.)
Die beiden letzten Messiáde-Bände ließ Steiner erneut in den Messkatalogen avisieren: Zur Ostermesse 1785 fertig geworden sei «Lavaters, J. C. Jesus Messias; oder die Evangelisten und Apostelgeschichte, in Gesängen. 3 Th. mit und ohne Kupf. gr. 8. Winterthur, bei H. Steiner und Compagnie» (Allgemeines Verzeichniß, Ostern 1785, S. 56). Im selben Messkatalog wurde auch bereits der Messiáde «4r und letzter Theil» angekündigt für den Herbst 1785 (ebd., S. 137). Diese durchaus verfrühte Anzeige wurde sowohl im Herbst-Katalog 1785 (S. 231: «Auf Schreibpap. m. K. und auf Druckpap. ohne Kupfer») als erneut auch in demjenigen zur Ostermesse 1786 (S. 409) wiederholt, nun mit dem entschuldigenden Zusatz: «Wird auf Johannis fertig.» Auch dieses Versprechen konnte nicht eingehalten werden.
Zur Ostermesse 1787 (S. 570f.) wurde Lavaters vierter Messiáde-Band unter den fertig gewordenen Schriften angezeigt; er dürfte nun tatsächlich auch «auf Schreibpap. m. Kpf.» lieferbar gewesen sein (ebd., S. 571). Im selben Jahr wie dieser letzte Textband war endlich die komplette Serie der 72 Kupfertafeln abgeschlossen. Stets nach den Textbänden waren sie je separat in vier Oktav-Heften (XVIII Kupfer zum Érsten Band der Messiáde etc.) aus- respektive nachgeliefert worden, wahlweise begleitet von kurzen, kritisch zu Entstehung und Ergebnis sich äußernden Kommentaren Lavaters (Abb. 3). Die Tafelfolge kostete insgesamt 24 Gulden, gemäß Titelblatt des letzten Hefts Kupfer zu Lavaters Messiáde von 1787 (nun erstmals mit Datums-, Verlags- und Orts- sowie mit Preisangaben).
Sicher ist, dass die Tafeln nicht «gleichzeitig» mit den Textbänden «in jährlicher Folge von 1783 bis 1786» publiziert worden sind, wie aber an vielen Orten zu lesen ist (zit. ist Thanner, Bd. 1.1, S. 236). Freilich lieferte Lavater selbst mit seinem autorisierten Werkverzeichnis solcher Bibliographierung Vorschub, wenn er, die leidigen Verzögerungen und leeren Versprechen übertünchend, seine Messiáde inklusive «Kupfer» als ordentlich «1783. 1784. 1785. 1786» erschienen aufführt (Vollständiges Verzeichniss von 1790, S. 24).
Damals wie heute hoch gehandelt werden die später prächtig gebundenen Exemplare auf Vorzugspapier (mit Vignetten), in die je an Ort und Stelle zu den entsprechenden Gesängen gehörige Tafeln mit eingebunden sind. Allerdings gehen dabei (nebst Broschuren) Lavaters 72 bildkritische Kommentare verloren; diesen «Einfall» Lavaters, bei der «Kupfersammlung zum Messias […] auch die Kritiken daneben gedruckt» zu publizieren, hat Chodowiecki einmal als «wahrlich schaurich» bezeichnet (Chodowiecki an Gräfin Christiane von Solms-Laubach, 27.02.1786, zit. aus Steinbrucker 1928, S. 79). Gerade diese Bildkritiken aber stellen in ihrer Eigenartigkeit vielleicht die interessanteste Textsorte des Messiáde-Komplexes dar. – Zum Schluss sollen die hinsichtlich Verzögerungsgeschichte deutlichsten Zeugen zu Wort kommen: die Broschur-Umschläge der Text- und Tafelhefte im Auslieferungszustand.
Broschur-Nachrichten
Der zur Ostermesse 1783 publizierte erste Messiáde-Textband führt auf der Umschlag-Rückseite (Abb. 8) eine Information des geschäftigen, namentlich unterzeichnenden Verlegers.

Abb. 8: Lavaters Messiáde, Textband 1, 1783, Umschlag hinten (Privatbesitz).
Die Broschur stellt damit den einzigen Ort mit Verlagsangabe dar; ein Impressum im Innern fehlt (Abb. 2). Die Gesamtzahl der illustrierenden Tafeln zu allen vier Bänden war damals offenbar noch nicht festgelegt; aber über die verzögerte Separatlieferung der ersten ‹Kupfersammlung› kann kein Zweifel bestehen:
Der Subscriptionspreis von Vier Bänden dieser schönen Ausgabe der Messiade, mit wenigstens fünfzig niedlich ausgearbeiteten Kupfertafeln und einigen Vignetten, ist für die ausdrücklich auf alle Vier Bände, gleich anfangs Subscibierenden – vier Species-Dukaten; Nachher wird kein Band unter vier Thaler verkauft werden.
Die Kupfer zum Ersten Bande werden in kurzer Zeit nachkommen. Man kann die ganze Samlung der Kupfertafeln, deren ein kurzer Text beygefügt wird, gar schicklich besonders binden.
Heinrich Steiner und Comp.
Ein Jahr später dann erschien die zugehörige Tafellieferung zum ersten Band, dicht gefolgt vom zweiten Textband (auf Ostern 1784). Dessen Broschur hat keine aufgedruckte Nachricht. Dafür meldet sich auf der Rückseite des ersten Tafelhefts (Abb. 9) erneut Steiner betreffend die zweite Nachlieferung von 18 Tafeln:
Der zweyte Band Text wird auch auf Ostern erscheinen, wenn aber die Kupferlieferung darzu fertig werden könne, getrauen wir uns nicht mehr im Voraus zu bestimmen; Genug, daß Alles zur Beschleünigung veranstaltet ist, und Alles angewendet werden solle, so viel ohne der Schönheit der Kupfer zu schaden möglich seyn wird. Auch dieser zweyte Band wird mit der nachzuliefernden Kupfersammlung Rthl. 5 Sächsisch Geld kosten.
Winterthur den 8. Merz 1784.
Heinrich Steiner und Comp.

Abb. 9: Lavaters Messiáde, Tafelheft 1, 1784, Umschlag hinten (Biblion Antiquariat, Zürich).
Zur Ostermesse 1785 wurde plangemäß der dritte Textband publiziert, auf dessen Interimsbroschur (Abb. 4) Steiner «mit Zuversicht» die weiterhin fehlenden Tafeln zum zweiten Band verspricht sowie die ausstehenden Illustrationsfolgen der beiden letzten Bände bereits in Aussicht stellt. Er scheint hier wie in den unbeirrt im Halbjahrestakt zu viel zu früh gelobenden Messkatalogen wenig aus den bisherigen Verzögerungen gelernt zu haben:
Die Kupfer zum zweyten Bande sind bis an wenige, die alle Posttage erwartet werden – und die zum Dritten schon zur Hälfte auch einige schon zum Vierten fertig. Man kann allso die zum zweyten Bande bis Pfingsten, die zum Dritten bis zur Herbstmesse 1785. und die zum Vierten auf Ostern 1786. mit dem vierten und lezten Bande des Werkes selbst, welcher die Apostel-Geschichte enthalten wird, mit Zuversicht versprechen.
Den 19. März 1785.
Heinrich Steiner und Comp.
Auch dies war noch zu viel versprochen. Ohne Datierungshinweise, aber wohl irgendwann zwischen Herbst 1785 und Ostern 1786 erschien das zweite Tafelheft, nachdem – wie im anzitierten Briefwechsel gesehen – Steiner vollends die Geduld verloren und Lavater mit einem Prozess gedroht hatte. Auf der Rückseite des Heftumschlags wurde nun explizit den beteiligten Künstlern der schwarze Peter zugeschoben, die jedenfalls ‹weniger unschuldig› seien als Verfasser und Verleger:
So viel später, als gehoff’t, und in der Hoffnung auf die arbeitenden Künstler, versprochen ward, erscheint dieß zweyte Heft – Daß man dem Publikum gar nichts mehr versprechen darf, als dieß: Weder der Verfasser, noch der Verleger werden etwas fehlen lassen, das dritte, und seiner Zeit das vierte Heft dieser Sammlung, beßtmöglich, und baldmöglichst, dem durch seine bisherige Nachsicht besonders verehrenswürdigen Publikum zu liefern, so wie sie versichern dürfen, an der Verzögerung dieses Hefts völlig unschuldig, und noch unschuldiger zu seyn, als einige durch ihre Umstände gänzlich gebundene Künstler, auf deren besondere Lage man nicht genug gerechnet hatte.
Zu guter Letzt fand Lavater es angebracht, sich mit pünktlichem Erscheinen des vierten Textbands zur Ostermesse 1786 auf dessen Broschur-Rückseite entschuldigend selbst verlauten zu lassen (Abb. 4); und wer hier ‹spricht›, ist vor der unterzeichnenden Paraphe bereits klar durch den Satz mit Vokal-Akzenten (deren Wiedergabe ist nur näherungsweise mit Unicode-Zeichen möglich):
So sehr ich mich vor Versprêchen, wie vor Verbrêchen zu hǖten, zur Pflicht mache, so hab’ ich dennoch sicherlich geglaubt, das Versprêchen, die Kupfer zum III. und IV. Bande der Messiáde auf Ostern 1786. zu liefern, wâgen und halten zu können – Nun sêh’ ich mit Schrêcken, wie weit ich, alles meines Treibens ungeachtet, noch zurück bin – Nicht einmal die zum III. Bande, obgleich nur noch zwey fêhlen, können geliefert wêrden – Einige, vielleicht zu sehr beschäftigte Künstler antwōrten nicht, oder vergessen aller Gründe vom Verleger, Publikum und Verpflichtung gegen dasselbe hêrgenommen – Allso versprêch’ ich auch jetzt nichts, als allenthalben möglichst zu treiben, daß Alles baldmöglichst vollendet, befriedigt, und erfreüt werde.
Zürch, den 31. März, 1786.
J. C. L.
Ab Ostern 1788 war der erste Messiáde-Band «auf Druckpapier mit den Kpf. auch auf geringer Papier» für einen entsprechend tieferen Preis zu haben, was «auch zu den übrigen Theilen fortgesetzt» werde (Allgemeines Verzeichniß, Ostern 1788, S. 71). Zur Ostermesse 1789 (S. 73) wurden der Messiáde «2r und 3r Bd. mit den Kpf. auf geringer Papier» annonciert; im Herbstmesse-Katalog 1789 (S. 235) ließen «Steiner und Komp.» Lavaters «Jesus Messias» in der Ausgabe «mit den Kpf. auf geringer Papp.» als ein neuerdings fertig gewordenes Werk anzeigen. Laut Steiners Verlagskatalog von 1789 kostete die Tafel-Serie nun «auf gering Papier abgedruckt in 4 Heften» umgerechnet noch 11 Gulden, knapp den halben Preis der Erstausgabe (zit. aus Ganz, S. 102; so auch Lavaters Vollständiges Verzeichniss, S. 24).
Nach Lavaters Tod vermeldet Johann Heinrich Jung, gen. Stilling in seiner Volksschrift namens Der Graue Mann (Stk. 21, 1809, S. 570): «Bey den Erben unseres seeligen Lavaters in Zürich, liegt noch ein Rest von seiner Messiade, die Edition auf Postpapier, mit 4 Heften prächtiger Chodowiekischer Kupfer; im Buchhandel sind sie nicht mehr, der herabgesetzte Preis ist zwey neue Louisd’or [20 Gulden] […]. Die Familie wünscht, daß dieser Ueberrest von den Lavaterischen Weken auch noch in ein gutes Land gesäet werden, und hundertfältige Früchte tragen möge.»
Bei Steiners und J. C. Füsslis Nachfolger, dem Zürcher Verlag von Leonhard Ziegler und Söhnen, erschien um 1815 (Datierungshinweise in der Vorrede, bes. S. IV) als Bilderbuch zu den Geschichten des neuen Testaments, mit kurzen Erklärungen eine Neuauflage respektive späte Verwertung überzähliger Tafelabzüge der 72 Messiáde-Illustrationen, ganz ohne Lavater’sche Texte, gerüstet mit Angabe der Bibelstellen und kurzer Bildbeschreibung zu jeder Tafel.
Die Illustrationsfolge zur Messiáde geht außerordentlich selten auf die gebräuchlichen Vor-Bilder zurück (Raffael, Rembrandt, Rubens, Poussin etc.). Sie ist nach Lavaters eigenen Bildanweisungen kollaborativ entstanden (so Abb. 3 nach Schellenbergs Zeichnung, von Chodowiecki ‹verbessert›, von Berger radiert – und von Lavater physiognomíekritisch kommentiert). Ihre Genese mag gewissermaßen ‹Zangengeburt› gewesen sein und Textbände wie Tafelserie sind kaum als verlegerischer Verkaufserfolg zu verbuchen; aber die Tafeln wurden als Neubelebung der neutestamentlichen Bibelillustration äußerst positiv rezipiert. Es folgte eine Geschichte transkonfessioneller Bildwanderungen, in der die Tafeln, losgelöst von Lavaters Dichtung, schweiz- wie europaweit für verschiedene Kontexte rege kopiert wurden. Doch das ist ein anderes Kapitel.
Andreas Moser, Bern
Abgekürzt zitierte Literatur
Allgemeines Verzeichniß derer Bücher, welche in der Frankfurter und Leipziger Ostermesse des 1783 Jahres entweder ganz neu gedruckt, oder sonst verbessert, wieder aufgelegt worden sind, auch inskünftige herauskommen sollen. Leipzig 1783 [und folgende, halbjährlich zu den Buchmessen]. | Digitalisate 1770–1800 |
Ganz, Werner: Johann Heinrich Steiner. Buchhändler und Politiker 1747–1827 (Neujahrsblatt der Stadtbibliothek Winterthur 271) [Anhang: Steiners Verlagskatalog von 1789]. Winterthur 1937.
Klopstock, Friedrich Gottlieb: Oden, hg. v. Horst Gronemeyer und Klaus Hurlebusch (HKA, Werke I), Bd. 1: Text. Berlin/New York 2010. | Digitalisat |
Leemann-van Elck, Paul: Die zürcherische Buchillustration von den Anfängen bis um 1850 (Veröffentlichungen der Schweizer Bibliophilen Gesellschaft 25). Zürich 1952.
Moser, Andreas: «Ich arbeite in müßigen Stunden an einer Historischen Epopée – das Evangelium, oder die Geschichte Jesu Christi». Johann Caspar Lavaters erste Verlagsanfragen für seine Messiade bereits 1771 [Anhang: Faksimile und Transkription des Briefs von Lavater an Reich]. In: Noli me nolle. Jahresschrift der Sammlung Johann Caspar Lavater, 2020, S. 65–74. | Digitalisat |
Muralt, Anna Barbara von: Anekdoten aus Lavaters Leben, hg. v. Ursula Caflisch-Schnetzler u. a. (JCLW Ergänzungsband), Bd. 1: Text. Zürich 2011. | Digitalisat |
Schulz, Günter: Johann Jakob Stolz im Briefwechsel mit Johann Caspar Lavater 1784–1798. In: Jahrbuch der Wittheit zu Bremen 6, 1962, S. 59–197.
Steinbrucker, Charlotte (Hg.): Daniel Chodowiecki. Briefwechsel zwischen ihm und seinen Zeitgenossen, Bd. 1: 1736–1786 [alles Erschienene], Berlin 1919. | Digitalisat |
Steinbrucker, Charlotte (Hg.): Briefe Daniel Chodowieckis an die Gräfin Christiane von Solms-Laubach. Straßburg 1928.
Thanner, Brigitte: Schweizerische Buchillustration im Zeitalter der Aufklärung am Beispiel von Johann Rudolf Schellenberg, Typoskript, 3 Teile in 2 Bänden, Winterthur 1987.
Vollständiges Verzeichniss aller gedruckten Schriften von Johann Caspar Lavater. 1790. | Digitalisat |
Ein Brief, den Giordano Bruno (1548-1600) im Jahr 1589 in Helmstedt verfasste und den die Herzog August Bibliothek in Wolfenbüttel aufbewahrt, wurde zum Ausgangspunkt des mit dem Künstlerbuchpreis des Jahres 2020 ausgezeichneten Projekts von Ulrike Stoltz.
Im Laufe eines Jahres erschuf die Künstlerin, die sich bereits in früheren Werken mit Bruno beschäftigt hat, ein Kaleidoskop aus Texten und Bildern, das sich diesem Philosophen, Priester, Mathematiker, Astronom, Lyriker und Gedächtniskünstler aus unterschiedlichsten Perspektiven nähert und verschiedensten Resonanzen nachspürt - ein Brückenschlag zwischen Wissenschaft, Kunst und Spiritualität. Das Künstlerbuch, das sie für den Künstlerbuchpreis der Herzog August Bibliothek und der Curt Mast Jägermeister-Stiftung 2020 anfertigte, trägt den Titel „Caro Giordano. Resonanzen & Gestrüpp“ und erschien in einer Normalausgabe und in einer Vorzugsausgabe.
Abbildungen der Normalausgabe:



Besonderheiten in Satz und Druck gehören für Ulrike Stoltz zu den wesentlichen «Spuren» in den Werken Brunos. Der von Bruno selbst gefertigte Holzschnitt Archetypus ist die Grundlage für den Satzspiegel im Künstlerbuch. Stoltz reflektiert die Werke Brunos unter anderem in Anagrammen, Gedichten und poetischer Kurzprosa. In ihren Texten versetzt sie den Renaissancephilosophen in die Gegenwart. Die Künstlerin fragt, wer wir sind, wie wir die Welt erklären und was wir überhaupt nicht verstehen, trotz aller Wissenschaft und Aufklärung.
Abbildungen der Vorzugsausgabe:




Auf einer Doppelseite nennt sie alle Lebensstationen Brunos: alle Städte, in denen er weilte und wirkte. In großer Schrift sind die genaue Reisedauer und seine zu Fuß zurückgelegten Kilometer zu sehen, die Distanzen von Google errechnet. Als Giordano Bruno durch Europa reiste, gab es noch kein System von regelmäßig verkehrenden Postkutschen. Und weil Ulrike Stoltz ihr Vorhaben ernst genommen hat, vertraute sie bei der Berechnung der Reisedauer nicht nur Google, sondern erkundete sich zusätzlich noch bei einem zuverlässigen Fernwege-Wanderfreund nach Gehzeiten auf den europäischen Wanderwegen. Insgesamt, so ihre Berechnung, soll der einstige Dominikanermönch 8961 Kilometer in seinem Wanderleben per Pedes zurückgelegt haben.

Ulrike Stoltz ist Typografin und Buchkünstlerin, aber auch Wegbereiterin und Vermittlerin des Genres Künstlerbuch. Seit über dreißig Jahren ist sie in der Künstlergemeinschaft <usus> aktiv, deren Künstlerbücher 2016 in der Ausstellung buch. räume. sprach. bilder. 30 Jahre Zusammenarbeit. ‹usus›. Uta Schneider & Ulrike Stoltz in der Herzog August Bibliothek gezeigt wurden.Von 1992 bis 2018 war sie Professorin für Typografie, erst an der FH Mainz, dann an der HBK Braunschweig. Seit ihrer Pensionierung kann sie sich ausschließlich ihrer Kunst widmen. Ulrike Stoltz lebt in Berlin.
Zusammengestellt von W. Schneider-Lastin
Filippo Tommaso Marinettis Reise nach Brasilien und Argentinien

«Zweifelsohne ist die Bucht von Guanabara verliebt in Giulio Cesare, diesen Bug Italiens mit dem schneidenden imperialen Profil, das sich von der Halbinsel entfernt auf der Suche nach Häfen, die seinen Dimensionen angemessen sind. Die schöne und ihrer Liebe gewisse Bucht bietet alle Kurven ihrer Strände und ihrer Berge an, öffnet ihre Kais und schliesst den Überseedampfer in ihre geometrischen Arme und drückt ihn an ihr glühendes Herz» (1)
Mit diesem erotisch-postkolonialen Auftakt beginnt Filippo Tommaso Marinetti (1876-1944) seinen Tagebucheintrag über die Ankunft in Rio de Janeiro am 12. Mai 1926 – in Tat und Wahrheit ein nebliger, kühler Morgen – wo er alsbald von einer Meute sensationshungriger Journalisten und Fotografen wie eine Filmdiva empfangen und ins Copacabana Palace begleitet wird. Trotz vielversprechendem Auftakt sollte der Brasilien-Reise Marinettis nur ein mässiger Erfolg beschieden sein: War bei seinem ersten Vortrag in Rio de Janeiro noch eine respektvolle Aufmerksamkeit vorhanden, so wurde er beim zweiten Auftritt bereits ausgebuht und in São Paulo von den Studenten mit Unrat beworfen. Doch der Höhepunkt dieser Reise war für Marinetti ganz anderer Art: Ein Besuch in der Favela Morro da Providência stand auf dem Programm. Es war eine kalte Mainacht, als er in Begleitung seiner Frau Benedetta, zweier Militärpolizisten und einem Schwarm Paparazzi den Hügel über der Bucht von Guanabara bestieg, wo ihm die seltsamste aller Ehrungen zuteilwurde, denn der Schmuggler und Waffenschieber Zé da Barra hatte ihn in sein Haus eingeladen. Unterwegs entstanden zahlreiche Fotos, die am nächsten Tag in den Zeitungen erschienen: Marinetti in schwarzem Mantel, den Filzhut auf dem Kopf, grell beleuchtet vom Licht der Magnesiumblitze – ein gefundenes Fressen für die Karikaturisten. Wer war dieser Mann, der 1909 den Futurismus aus der Taufe hob, eine Avantgarde-Bewegung, die ein solch zwiespältiges Echo in Südamerika auslöste?

F. T. Marinetti in der Favela. Karikatur aus der satirischen Zeitschrift O Malho (Rio de Janeiro, 1926).
Filippo Tommaso Marinetti (1876-1944)
Filippo Tommaso Marinetti, geboren am 22. Dezember 1876 in Alexandria in Ägypten, besuchte die Saint-François-Xavier-Schule der Jesuiten in der ägyptischen Hafenstadt, wo er alsbald gefeuert wurde, weil er es gewagt hatte, Émile Zola zu lesen, einen Autor, der damals auf dem Index stand. 1893 machte er sein Abitur in Paris und begann ein Studium der Rechtswissenschaft nach dem Vorbild seines Vaters. Marinetti schrieb in diesen Jahren ausschliesslich Französisch, hatte aber einen Zweitwohnsitz in Mailand, was ihm sein reich aus Ägypten zurückgekehrter Vater grosszügig finanzierte.

Foto von F. T. Marinetti. Milano, 1927. Aus Prigionieri e vulcani.
Doch all dies war nicht genug. Am 20. Februar 1909 liess er in der Pariser Tageszeitung Le Figaro das Gründungsmanifest des Futurismus drucken. In diesem Premier manifeste du futurisme stellte er eine Reihe von Postulaten auf, die der neuen Bewegung als Richtschnur dienen sollten:
- Wir wollen die Liebe zur Gefahr besingen, die Vertrautheit mit der Energie und Verwegenheit.
- Mut, Kühnheit und Auflehnung werden die Wesenselemente unserer Dichtung sein.
- Wir wollen preisen die angriffslustige Bewegung, die fiebrige Schlaflosigkeit, den Laufschritt, den Salto mortale, die Ohrfeige und den Faustschlag.
- Wir erklären, dass sich die Herrlichkeit der Welt um eine neue Schönheit bereichert hat: die Schönheit der Geschwindigkeit: ein aufheulendes Auto ist schöner als die Nike von Samotrake.
Mit diesen marktschreierischen Worten manifestierte die erste Avantgarde-Bewegung des 20. Jahrhunderts ihre globale Ideologie, die die verschiedensten Gebiete des menschlichen Lebens umfasste, von der Literatur bis zur Kunst und Musik, von der Mode bis zur Moral und zur Politik.
Futurismus in Argentinien
«Ich verstehe den Vergleich nicht. Was ist schöner? Eine nackte Frau oder ein Gewitter? Eine Lilie oder ein Kanonenschuss?» Mit diesen Worten reagiert der aus Nicaragua stammende Dichter Rubén Darío (1867-1916) am 5. April 1909 in der argentinischen Zeitung La Nación, also nur zwei Monate nach Erscheinen des Premier manifeste du futurisme, auf die Herausforderung der italienischen Avantgarde. Diese skeptische, zwiespältige Haltung gegenüber dem poetischen Imperialismus F. T. Marinettis sollte die Haltung des argentinischen Publikums prägen. Jorge Luis Borges (1899-1986), damals Vertreter des Ultraismus, einer aus Spanien stammenden dichterischen Erneuerungsbewegung, weigerte sich, Marinetti bei seinem Besuch in Argentinien 1926 zu empfangen oder auch nur zu kommentieren.
Die Reise nach Südamerika hatte der italienische Impresario Nicolino Viggiani organisiert, mit dem Marinetti am 16. Dezember 1925 einen Vertrag geschlossen hatte, der Vorträge in verschiedenen Städten vorsah, bei einer finanziellen Beteiligung von 20% an allen Einkünften. Am 7. Juli 1926 erreichte die Giulio Cesare schliesslich den Hafen von Buenos Aires. Es folgten Auftritte im Teatro Coliseo, in der Fakultät für Architektur an der Universität und eine Hommage der Avantgarde-Zeitschrift Martín Fierro, an der Jorge Luis Borges zwar teilnahm, sie jedoch mit keinem Wort kommentierte. Noch einmal sollte Marinetti nach Buenos Aires zurückkehren, im August 1936, anlässlich der historischen Sitzung des PEN-Clubs in den Räumen des Concejo Deliberante, heute das prächtige Stadtparlament der argentinischen Hauptstadt.
Was bleibt von Filippo Tommaso Marinettis Reisen nach Südamerika? Hundert Jahre nach der Publikation des ersten Manifests organisierte die Fundación Proa in Buenos Aires eine Ausstellung mit unveröffentlichten Fotos, diversen Objekten und Gedichten in spanischer und portugiesischer Sprache, die den Einfluss der Parole in libertà verraten, jener revolutionären Poetik der Futuristen, die ohne Vers und ohne Metrik auskommt. Die Spurensuche verdichtet sich in der vorliegenden Publikation, die zum ersten Mal alle Aspekte des Phänomens Futurismus in Südamerika umfasst und eine Übersetzung in mehrere Sprachen verdient hätte, um international wahrgenommen zu werden.
Albert von Brunn, Zürich
El Futurismo en Sudamérica. Gonzalo Aguilar, Cecilia Rabossi, Jorge Schwartz. Buenos Aires: Fundación Proa, 2022.
1) Marinetti, Filippo Tommaso. «Velocità brasiliane. Rio, palcoscenico del teatro oceano” in: Schwartz, Jorge. “Marinetti en el Brasil» in: El Futurismo en Sudamérica. Buenos Aires: Fundación Proa, 2022, SS. 42-55.
Quellen
1. Baumgarth, Christa. Geschichte des Futurismus. Hamburg: Rowohlt, 1966.
2. De Maria, Luciano. Per conoscere Marinetti e il futurismo. Milano: Mondadori, 1973.
3. Strobel-Koop, Regina. Geschichte und Theorie des italienischen Futurismus. Saarbrücken: VDM, 2008.
4. Barros, Orlando de. O pai do futurismo no país do futuro (as viagens de Marinetti ao Brasil em 1926 e 1936). Rio de Janeiro: E-Papers, 2010.
Die Sammlung Adelheid Schönborn
Herausgegeben von Adelheid Schönborn und Michael Rothe
Mit Beiträgen von Julia Rinck und Matthias Hageböck
150 farbige Abbildungen
Haupt Verlag, Bern 2022
In diesem Buch werden Brokatpapiere aus der Sammlung von Buntpapieren von Adelheid Schönborn vorgestellt. Solche Papiere wurden von den Buchbindern als Vorsatzpapiere genutzt und trugen zur reizvollen Gestaltung eines Buches bei. Vorsatzpapiere sind die Papierbogen, die den Buchdeckel und den eigentlichen Buchblock zusammenhalten und das Buch stabilisieren.
Im 18. Jahrhundert waren es bevorzugt Brokatpapiere, die als Vorsatz-, aber auch als Einbandpapiere für Bücher oder als Umschläge für Dissertationen, Leichenpredigten und Huldigungsschriften verwendet wurden. Auch Schatullen und Möbel wurden mit solchen Papieren ausgekleidet.

Abb. 1.
Brokatpapiere sind Prägedrucke, die mithilfe einer relativ dicken, reliefierten Kupferplatte hergestellt und mit einer Walzenpresse gedruckt wurden.
Dass in diesem Buch hauptsächlich Brokatpapiere gezeigt werden, liegt an der Einzigartigkeit dieser Papiere und daran, dass sie in ihrer ursprünglichen Art bis heute nicht mehr hergestellt werden können.

Abb. 2.
Michael Rothe, Restaurator und Verleger in der Schweiz, der sich sehr für Brokatpapiere und deren Herstellung interessiert, hat dieses Buchprojekt angestoßen. Aus der Vielzahl der Brokatpapiere aus der Sammlung von Adelheid Schönborn hat diese besonders schöne und verschiedenartig gestaltete ausgesucht; viele mit Signatur, sodass man weiß, aus welcher Werkstatt sie kommen. Zeitlich sind die meisten zwischen 1700 und 1780 entstanden - wenige auch später. Die beste Qualität stammt aus der Zeit vor 1760.

Abb. 3.
Die Papierwerkstätten lagen damals vor allem im fränkischen Raum Deutschlands, so in Augsburg, Fürth und Nürnberg. Da die Brokatpapiere um 1700 in Augsburg zum ersten Mal hergestellt wurden, nennt man sie auch "Augsburger Papiere". Die konkrete Zuordnung erweist sich als schwierig, da in vielen Fällen die Signatur fehlt. Der Buchbinder hat bei der Verarbeitung die Papiere beschnitten und so die Signaturen entfernt, die, bis auf wenige Ausnahmen, am Rand angebracht waren.

Abb. 4.
Der Sinn und Zweck dieses Buches liegt darin, dass auch Menschen, die nicht mit der Materie "Papier" befasst sind, sich an der Schönheit und Vielfältigkeit dieser Brokatpapiere erfreuen können. So soll für dieses ausgestorbene und nahzu vergessene Kunsthandwerk wieder ein Interesse geweckt werden.
Aus der Einführung von Adelheid Schönborn in das Buch, S. 7 und 11.
Abb. 5.

Johann Freiherr zu Schwarzenberg (1463 oder 1465 bis 1528) war ein führender Aristokrat seiner Zeit. Als Jurist ist er bedeutsam als Schöpfer der Bambergischen Halsgerichtsordnung (erster Druck 1507) und durch sie auch der Peinlichen Gerichtsordnung Kaiser Karls V. (1532). Auch als Befürworter der lutherischen Reform ist er hervorgetreten.

Abb. 1: Das Monogramm unten rechts kann nicht eindeutig einem Formschneider zugewiesen werden; vgl. Nagler Band I, Nummer 1888. Wenn man die Angabe beim schwartzen strich ausrechnet, muss Schwarzenberg 1.90 m groß gewesen sein.
Im Umfeld der humanistischen Antikenrezeption trug Schwarzenberg dazu bei, einen hinsichtlich Gedankenwelt und Ausdrucksweise bedeutenden antiken Klassiker weiteren Kreisen zugänglich zu machen: Cicero. Eine Übersetzung fand er wegen der mangelnden Lateinkenntnisse nötig: So aber den Teütschen/ die verstands Lateynischer sprach mangeln/ vnd zuo tugentlicher vnterweysung begirig sind/ die selben Lateinischen buchstaben nit mer/ weder vngeschriben bapir/ anzeigen konnen (Vorrede 1522).
Einen ins Deutsche übersetzten Text Ciceros hatte er noch zu Lebzeiten publizieren können: 1522 die Schrift vom Alter (‹Cato maior›) im Verlag von S. Grimm in Augsburg, bereits mit den später wieder verwendeten Holzschnitten; mit zwei weiteren Übersetzungen wurde dieser dann postum 1534 in einer Sammelausgabe «Der Teütsch Cicero» zusammen mit selbst verfassten moralischen Texten veröffentlicht.
Hier widmen wir uns der Übersetzung von Ciceros «De officiis». ‹Übersetzung› muss präzisiert werden: Schwarzenberg konnte eingestandenermaßen kein Latein; er ließ eine Rohübersetzung durch seinen Kaplan Johann Neuber anfertigen. Es gab bereits ein Buch mit der deutschen Übersetzung von «De officiis» (1488 gedruckt zuo Augspurg von Hannsen Schobser), die ihm aber der verteütschung nach/ ubel gefallen. Neuber hat dann gemäß den Vorreden von synnen zuo synnen/ vnnd nit von worten zuo worten verteütscht. (Zur Übersetzungstechnik vgl. Luthers «Sendbrief vom Dolmetschen» 1530.) Schwarzenberg überarbeitete den Text selbst stilistisch eingreifend und versah ihn mit in den Lauftext eingefügten Glossen, verdeutlichenden Texterweiterungen, Reimsprüchen und Bildern: von merer vnd besserer merckung vnd beheltligkeyt wegen/ etlich fyguren vnd teütsche verßleyn/ … zuogesetzt (so in der zweiten Vorrede). Dann ließ er den Text durch Humanisten, u.a. durch Ulrich von Hutten (1488–1523), durchsehen.
Das Buch war gemäß der Vorrede bereits 1520 fertig, konnte dann aber, nachdem der vorgesehene Verlag Grimm & Wirsung Konkurs gegangen war, erst 1531 erscheinen bei Heinrich Steiner in Augsburg, der die Materialien (Texte und Holzschnitte) des insolventen Verlags erworben hatte. Das Buch hat im Verlag von Steiner von 1531 bis 1545 zehn Auflagen erlebt, dann noch vier weitere bis 1565.
Officia M. T. C. Ein Buoch/ So Marcus Tullius Cicero der Römer/ zuo seynem Sune Marco. Von den tugentsamen ämptern vnd zuogehörungen eynes wol vnd rechtlebenden Menschen/ in Latein geschriben/ Welchs auff begere Herren Johansen von Schwartzenbergs &c. verteütschet/ Vnd volgens/ Durch jne in zyerlicher Hochteütsch gebracht/ Mit vil Figuren vnnd Teütschen Reymen/ gemeynem nutz zuo guot in Druck gegeben worden. Augspurg: Heynrich Steyner MD.XXXI.
Digitalisate:
http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0001/bsb00010109/images/
https://archive.org/stream/gri_33125012281362/page/n1/mode/2up
Cicero ist für Schwarzenberg (und andere zeitgenössische Humanisten) bedeutsam als Mann, der Staatsgeschäfte und Ethik vermitteln wollte. Das Bedeutungsspektrum von lat. officium reicht von ‹pflichtmäßige Handlungsweise› bis ‹Amtsgeschäft› – und diese beiden Prinzipien - ethisches Ideal und pragmatischer Nutzen - geraten mitunter in Widerspruch; das ist kurz gesagt das Thema dieses umfänglichen Buchs.
Benutzte Ausgabe: Marcus Tullius Cicero, De officiis. Vom pflichtgemäßen Handeln, lat.-dt., übersetzt, kommentiert und herausgegeben von Heinz Gunermann, (Reclams Universal-Bibliothek Band 1889), Stuttgart 1978.
100 (der insgesamt 103) Holzschnitte stammen vom sog. Petrarcameister, der auch das 1532 bei Steiner erschienene Buch Petrarcas, «Von der Artzney bayder Glück/ des guoten vnd widerwertigen» illustrierte – 33 Holzschnitte kommen in beiden Büchern vor, wobei es eine große Aufgabe wäre, festzustellen, wofür ein bestimmtes Bild zuerst konzipiert war. Die Bilder (ca. 15,5 cm breit; es gibt wenige Hochformate) passen optisch gut in den Satzspiegel (dieser misst ohne Randglossen 15 cm; mit Randglossen 17 cm; Höhe ohne Balkentitel 23 cm).
Das Sieb
Ein Gedankengang bei Cicero (I, iii, 10 bis iv, 11) ist der: Um pflichtgemäß handeln zu können, muss man bei zwei zur Wahl gestellten ehrenhaften Möglichkeiten feststellen können, welche die ehrenhaftere ist. In der Übersetzung von Schwarzenberg: so vns zwey erbare dinge fürgehalten werden/ sollenn wir bedencken/ welich das erbarst […] ist. – Jedes Lebewesen weicht naturgemäß dem aus, was ihm schadet. Im Unterschied zum Tier, das nur aufgrund sinnlicher Eindrücke (sensus) wählt, urteilt der Mensch mit Verstand (ratio). Schwarzenberg: Vnd ist zwyschen den menschen vnnd den thieren die höchst vnderscheyd/ das/ das thyer allein durch seyne synne/ zuo dem/ das jme bey vnd gegenwertig ist/ bewegt wirt […]/ Aber der mensch/ ist taylhafftig der vernunfft/ dadurch er alle vrsach beschawet.

Abb. 2.
Das Bild des Petrarcameisters (Fol. III recto; hier ein Hochformat, das mittels Ornamentstreifen in den Satzspiegel eingepasst ist) zeigt nicht einen Trennvorgang von mehr oder weniger ehrenhaften Handlungen, sondern eine Trennung von Mensch und Tier (repräsentiert in den Köpfen). Es scheinen die beiden Gedankengänge (Unterscheidung der mehr oder weniger ehrbaren Güter und Unterscheidung der Wahrnehmung bei Mensch und Tier) von Cicero vermengt worden zu sein.
Die Überschrift lautet:
Merck unser aller höchste zier/
Ist das vernunfft zwing böß begir.
Vnd scheidt allein dich mensch vom thier.
Die Waage
Cicero schreibt (I, xxiii, 80f.), einen Krieg solle man nur in der Absicht auf sich nehmen, dass der Friede offenbar erstrebt werde (ut nihil aliud nisi pax quaesita videatur). Und: Wenn die Umstände es erfordern, sei der Tod der Knechtschaft und Schande vorzuziehen (mors servituti turpitudinique anteponenda); in der Übersetzung von Schwarzenberg: Es ist fechten/ vnnd auch der leyblich todt schnöder dienstbarkeit fürzuosetzen.

Abb. 3.
Der Illustrator (Fol. XIX recto) hat sich wohl an der Metapher der ‹Schwere› inspiriert, die in der Versüberschrift des Bilds (Fol. XIX recto) vorliegt: Wol krieg und streyt hat vil gefer/ [Gefährdung] – Noch mer ist boeser zwangksal [Not, Bedrängnis, Ungemach] schwer. In der höheren Schale kniet ein kampfbereiter Mann in Rüstung, ‹obenausschwingend›; in der tieferen liegt ein Gefesselter (die servitus / dienstbarkeit darstellend), ‹schwergeprüft›. – Es liegt also nicht die Vorstellung vor, wie wir sie aus der Bibel kennen: «Gewogen wurdest du auf der Waage und zu leicht befunden» (Daniel 5,27 über Belsazar).
Eintracht bei der Lebensführung
Cicero sagt (I, 40, 143ff.): In der Lebensführung soll alles in einem ausgewogenen Verhältnis sein. Schickliches Benehmen beinhaltet, sich den Umständen gemäß aufzuführen, z.B. bei ernsten Gesprächsthemen nicht leichtfertig zu reden, auf dem Forum nicht zu tanzen, bei Gericht oder in einer Versammlung nicht zu singen etc. Nun folgt ein Vergleich: Wie beim Saiten- oder Flötenspiel der geringste Missklang vom Fachmann bemerkt wird, so muss man im Leben auf das Zusammenstimmen (sonorum concentus) der Handlungen achten.

Abb. 4.
Das Bild (Fol. XXXIV verso) realisiert den Vergleich als Zusammenspiel zweier Instrumentalisten; darüber stehen die Verse
Den falsch der sayten bald vernimpt/
Ein Harpffenschlaher/ den daz zimpt.
Solch gleichnis manchen menschen schent/ [≈ tadelt]
Der seyn gebrechen nit erkennt./
Aufstieg auf der Leiter
Cicero (II,x,37): Es werden diejenigen bewundert, die, wie man glaubt, die Übrigen an Tugend übertreffen und frei von jeder Schande sind, besonders aber von den Lastern, denen andere kaum widerstehen können. Denn die Freuden, die schmeichlerischsten Gebieterinnen, bringen den größten Teil der Menschen von der Tugend ab, und die Meisten lassen sich, wenn sich brennende Schmerzen nähern, übermäßig erschrecken; Leben, Tod, Reichtum und Armut beeindrucken alle Menschen aufs Heftigste (vita, mors, divitiae, paupertas omnes homines vehementissime permovent.) Diejenigen, die diese Dinge weder fürchtend noch begehrend mit einer erhabenen und hohen Gesinnung verachten und die sich, wenn sich ihnen irgendetwas Bedeutendes und Ehrenhaftes bietet, diesem ganz zuwenden und mitreißen lassen: Wer sollte da nicht den Glanz und die Schönheit der Tugend bewundern? (Übersetzung von Rainer Lohmann)
Im Frühneuhochdeutsch von 1531 tönt das so: Dye wollust [Plural] als aller sänffte herscherin/ ziehen den meren teyl der gemüt von tugenten/ vnd werden noch mer erschreckt/ so sye dye fackeln [gemeint ist: die Qual] der schmertzen anrüren/ dann [denn] das leben/ der todt/ die reychtumb/ vnd armuot/ bewegen allermeyst den menschen.

Abb. 5.
Im Bild (Fol. XLVII verso) kommen Ding-Allegorien (Stufen-Leiter; Rüstung nach Epheserbrief 6, 11–17) und Personifikationsallegorien (die vier Gewalten Armut, Krankheit, Wollust, Tod) miteinander verquickt vor. Das Bildkonzept ist alt. Bereits Herrad von (Landsberg, Äbtissin von) Hohenburg kennt und beschreibt es im «Hortus deliciarum»; ebenso Thomasîn von Zerclaere († ca. 1238) in «Der wälsche gast», Vers 5809ff. (Ausgabe von Rückert) und andere Autoren.
Das Nützliche und das Ehrenhafte lassen sich nicht trennen
Bei Cicero (II,iii,9) heißt es, dass das Nützliche (utile) und das Ehrenhafte (honestum) nicht getrennt werden können:
Das erbar hangt dem nutzen an/
Daz solchs kan mensch gescheiden kan.
Vnd wer nicht diser warheit glawbt/
Ist frummkait/ oder witz beraubt.

Abb. 6.
Die moralischen Güter werden in der Visualisierung (Fol. XL verso und nochmals LXIIII verso) allegorisch durch Kisten angedeutet, die durch die Beschriftung unterschieden werden: Erbarkeit (durch Gerechtigkeyt ergänzt), und Nutz. Die Unmöglichkeit der Trennung (Daz solchs kain mensch gescheiden kan) wird visualisiert durch Ketten zwischen den Kisten; die Dummheit der dies nicht Einsehenden durch das törichte Hantieren an Kisten und Ketten sowie das Tragen von Augenbinde und Narrenkappe.
Was leisten die Bild-Zugaben?
Die fyguren seien – so heißt es im zweiten Vorwort – von merer vnd besserer merckung vnd beheltligkeyt wegen eingefügt. Das ist eine Anspielung auf die in der Rhetorik behandelte Mnemotechnik.
Auch hierzu ein Zitat Ciceros: «Wir können uns dasjenige am deutlichsten vorstellen, was sich uns durch die Wahrnehmung unserer Sinne mitgeteilt und eingeprägt hat; der schärfste unter allen unseren Sinnen ist aber der Gesichtssinn. Deshalb kann man etwas am leichtesten behalten, wenn das, was man durch das Gehör oder Überlegung aufnimmt, auch noch durch die Vermittlung der Augen ins Bewusstsein dringt. So kommt es, dass durch eine bildhafte und plastische Vorstellung Dinge, die nicht sichtbar und dem Urteil des Gesichts entzogen sind, auf eine solche Art bezeichnet werden, dass wir etwas, was wir durch Denken kaum erfassen können, gleichsam durch Anschauung behalten» (De oratore II,xxxvii,357).
Die Text-Bild-Text-Verschränkungen ähneln denjenigen der zur damaligen Zeit aufkommenden Emblematik: Lemma (Schwarzenbergs eigene Verse) – Pictura (Holzschnitt) – Epigramm (Cicero-Text). Die erste bebilderte Ausgabe von Alciatos «Emblemata» mit dieser Struktur erscheint bei Heinrich Steiner 1531!
Literaturhinweise
Willy Scheel, Johann Freiherr von Schwarzenberg, Berlin: Guttentag 1905.
Theodor Musper, Die Holzschnitte des Petrarkameisters. Ein kritisches Verzeichnis mit Einleitung und 28 Abbildungen, München: Verlag der Münchner Drucke 1927.
Ingeborg Glier, Artikel «Johann von Schwarzenberg», in: Die deutsche Literatur des Mittelalters. Verfasserlexikon, zweite Auflage, Band 4 (1983), 737ff.
Holger Kahle / Daniel Pachurka, Cicero verdeutschen: Kulturelle und mediale Aneignungen in deutschen ‹De officiis›-Übersetzungen des 15. und 16. Jahrhunderts, in: Bernd Bastert / Manfred Eikelmann (Hgg.): Klassiker im Kontext. Spätmittelalterliche und frühneuzeitliche Antikenübersetzungen in buchmedialen Übertragungsprozessen (1460/70 bis 1620), Tübingen: Narr Francke Attempto 2022.
Paul Michel, Zürich
Die Donatorinnen im Donationenbuch: Damenschild mit Amor
Die Burgerbibliothek Bern führte von 1693 bis 1826 ein äusserst prachtvoll ausgestattetes Donationenbuch (Signatur Mss.h.h.XII.1). Angelegt wurde das Buch nicht von ungefähr zum Zeitpunkt, als die bernische Obrigkeit die bisherige Bibliothek der Hohen Schule zur barocken Universalbibliothek, zur Bibliotheca civia, ausbaute. Zum Ausbau gehörte nicht nur ein repräsentativer Bibliotheksaal, erstmals eine «Bibliotheksordnung» und die Anstellung eines fest besoldeten Bibliothekars, sondern auch die Anlage musealer Sammlungen.

Abb. 1: Allegorisches Titelblatt des Donationenbuches der Burgerbibliothek Bern von 1693: «Munificentia monumentum dicatum honori fautorum qui bibliothecam publicam donis locupletarum» (Der Freigebigkeit der Wohltäter gewidmet, welche die öffentliche Bibliothek mit Gaben überschüttet haben). Die Allegorie spielt mit Figuren der Bibliotheksgeschichte wie König Ptolemäus, dem Gründer der alexandrinischen Bibliothek und der Bildungsgeschichte (debattierende Gelehrte im Hintergrund links) ebenso wie mit Personifikationen der Hohen Schule zu Bern (Academia auf dem goldenen Thron) und der Dankbarkeit (wachholderbekränzte Figur rechts). Zusammengehalten wird das Bild vom Berner Wappen (Mss.h.h.XII.1, f. 1r).
Mit der Einrichtung des Donationenbuchs verbunden war natürlich das Ziel reichlich fliessender Schenkungen, insbesondere auch deshalb, weil es in den letzten Jahrzehnten vor dem Ausbau kaum mehr Schenkungen an die Bibliothek gegeben hatte. Tatsächlich löste der Bibliotheksumbau die gewünschte Zunahme von Vergabungen aus. Die vermachten Objekte – vorwiegend Bücher und Handschriften, aber auch museale Objekte wie Münzen, Mineralien, Kunstgegenstände oder naturwissenschaftliche Kuriosa - wurden minutiös im Donationenbuch verzeichnet, jeder Schenker wurde mit seinem repräsentativ ausgemalten Wappen aufgeführt.

Abb. 2a und 2b: Beispiel eines Schenkungseintrags mit Wappen des Arztes Sigismund König, der 1693 seine rund 40 Bücher umfassende Sammlung der Bibliothek vermacht (Mss.h.h.XII.1, f. 10r und 10v).

Unter den über 400 männlichen Donatoren finden sich lediglich drei Frauen. Es sind dies Maria Magdalena von Graffenried, Euphrosina Herport und eine Frau «Pasteur nata Guardel». Die drei Donatorinnen lassen sich leicht unter den Einträgen finden, sind ihre Namen doch mit dem sogenannten Damenschild, einem rautenförmigen Schild mit barockem Amor als Schildträger, gekennzeichnet. Dieser Damenschild ist ein Hinweis darauf, dass die Damen unverheiratet oder verwitwet waren. Bemerkenswert ist die Tatsache, dass drei Damen die Bibliothek beschenkt haben, immerhin war Frauen gemäss der Bibliotheksordnung von 1698 der Zutritt zur Bibliothek verwehrt. Leider lässt sich in allen drei Fällen die Frage nicht beantworten, was der genaue Anlass für die Schenkung war, doch das wenige Recherchierbare verweist auf eher ungewöhnliche Schicksale und Umstände.
Euphrosina Herport (1699-1774)
Anno Domini 1738 verehrte die «virgo pietate et virtute clarissima» Euphrosina Herport der Bibliothek einen «Ludovicum aureum» und «Lucii Predigten» im Quartformat. Bei der Münze dürfte es sich um eine nicht näher identifizierbaren Louis d’or-Münze oder -Medaille handeln, bei den Predigten um diejenigen des in Bern damals sehr bekannten pietistischen Predigers Samuel Lutz, genannt Lucius (1674-1750). Euphrosina Herport übergab ihre Donation im Alter von 39 Jahren, vermutlich als die Hoffnung auf eine Ehe und Kinder schwanden. Bereits 1735 hatte sie aus unbekannten Gründen ein Testament verfasst. Tatsächlich heiratete sie aber nur wenige Jahre später, 1743, den Theologen Anton Güder (1700-1750). Dieser amtete ab 1743 als Pfarrer in Ringgenberg, wurde aber 1747 «wegen Verbrechen der Pfründe entsetzt [und] vom Ministerium verstossen und des Landes verwiesen». Er «hat das von seiner Magd geborene Kind heimlich fortgeschafft, seine Frau, die von der Sache wusste, ja Anteil hatte, auf 6 Jahre in die Spinnstube getan. Für die Verpflegung musste die Familie aufkommen» (Bernhard v.Rodt, Genealogien burgerlicher Geschlechter der Stadt Bern, Bd. 2, S. 82). Als Euphrosina 1774 verstarb, hinterliess sie ein nicht geringes Vermögen, das Inventar listet insbesondere auch eine kleine Bibliothek auf. Darunter finden sich neben geistlich-erbaulicher Lektüre auch ein historischer Atlas und ein diätetisches Kochbuch. Die Bibliothek erhielt aus der Erbschaft weder die Bücher noch andere Zuwendungen. Die Auflistung der Geschenke im Donationenbuch blieb entsprechend kurz auf dem Stand von 1738.

Abb. 3: Schenkung der Euphrosina Herport (Mss.h.h.XII.1, f. 215).
Maria Magdalena von Graffenried (1685-1741)
Nicht ganz sicher identifizieren lässt sich Maria Magdalena von Graffenried. Doch ist sehr zu vermuten, dass es sich um die Tochter des Abraham von Graffenried (1660-1748) handelt, die 1708 Niklaus Kirchberger (1676-1712), Hauptmann in Holländischen Diensten, heiratete. 1706 übergab sie der Bibliothek rund 30 silberne und goldene römische Münzen, dazu zwei Gemmen. Der Eintrag im Donationenbuch macht deutlich, dass sie zum Zeitpunkt der Übergabe mit 21 Jahren noch unverheiratet («virgo») war und dass die Münzen und Medaillen aus Köngisfelden («ex agris Vindonissensibus») stammen. Ihr Vater war Hofmeister in Königsfelden, bis er 1718 «wegen Pietismus entsetzt» wurde. Wie Maria Magdalena in den Besitz der Münzen kam, ob sie selbst nach Münzen gegraben hat, welches Interesse sie daran hatte, muss ebenso offen bleiben wie die Frage, ob die Übergabe an die Bibliothek in irgendeinem Zusammenhang mit der pietistischen Lebensführung der Familie stand.

Abb. 4: Schenkung der Maria Magdalena von Graffenried (Mss.h.h.XII.1, f. 191).
Veuve Pasteur, née Guardel
Dank einem freundlichen Hinweis lässt sich möglicherweise die Identität der Witwe klären, die der Bibliothek 1795 «ein gestiktes [«geschiktes»?] Gemehlde, eine Landschafft vorstellend» schenkte. Es könnte sich um Pernette Marthe Pasteur, geborene Gardelle (1727-1799) handeln, Ehefrau des aus einer bekannten Genfer Familie stammenden Jean Pasteur (1727-1790). Sie war die Tochter des Portraitmalers Robert Gardelle (1682-1766), der auch im bernischen Raum aktiv war. Die kinderlose Witwe übergab der Bibliothek vielleicht im Andenken an ihren Vater eines seiner Gemälde. Allerdings scheint der Name Gardelle in Bern nicht mehr sehr präsent gewesen zu sein, sodass man ihn als «Guardel» notierte und auch das Geschenk recht nüchtern, ohne weiteren Dank oder Hinweis zur Schenkerin verzeichnete.
Claudia Engler, Bern
Aus der Knechtschaft zur Freiheit

Eines der Hauptexponate in der Ausstellung über jüdische Exlibris in der Schweiz in der ICZ Bibliothek in Zürich ist das Exlibris von David Frankfurter (1909–1982). Es wurde uns grosszügigerweise von Moshe Frankfurter, dem Sohn von David Frankfurter, der in Jerusalem lebt, zur Verfügung gestellt.
In einer der umstrittensten Taten der Schweizer Geschichte war Frankfurter 1936 für das Attentat auf Wilhelm Gustloff, einen deutschen Nazi, notorischen Antisemiten und Landesgruppenleiter der Auslandorganisation (AO) der NSDAP in der Schweiz, in Davos verantwortlich.
Frankfurter, der sich nach der Tat der Polizei stellte, erklärte seine Aktion sowohl als Racheakt für das jüdische Volk, das unter der mörderischen Hand des Dritten Reiches gelitten hatte, als auch als Präventivmassnahme, um die Ausbreitung der Nazi-Ideologie in der Schweiz zu verhindern. Die öffentliche Meinung in der Schweiz war während des Prozesses sehr gespalten. Es gab viele, die Verständnis für seine Tat zeigten, und viele, die sich darüber empörten. Der Prozess, der auch sehr politisch war, wurde vom deutschen Regime stark beeinflusst, welches Frankfurters Tat für seine Propaganda nutzte.

Todesanzeige für Wilhelm Gustloff aus der „Davoser Zeitung“
Das Exlibris wurde von einem Zellengenossen für ihn angefertigt während der Zeit, die er nach dem Attentat im Gefängnis in Chur verbrachte. Es ist ein Holzschnitt und besteht aus drei Hauptmotiven: eine Sonne, ein Davidstern und eine Kette. Die Sonne scheint stark auf den Davidstern unter ihr und zersprengt die Kette, die den Davidstern gefangen hielt. Dies soll die Situation von David Frankfurter darstellen, der für seine Tat zu 18 Jahren Gefängnis verurteilt wurde.
Das Ex-Libris enthält auch die hebräische Schrift: „מעבדות לחרות“ „me-Avduth le-Cherut“, was „Aus der Knechtschaft zur Freiheit“ bedeutet und den Wunsch des jüdischen Volkes symbolisiert. Ironischerweise wurde der Künstler und Zellengenosse Walter Hausmann später ein Nazi (manche sagen, er wurde dazu gezwungen) und produzierte auch Arbeiten für die Nazi-Propaganda.

Neben dem Exlibris von Frankfurter liegt in unserer Vitrine ein seltsames Exlibris, das den Namen Ludwig trägt. Es zeigt eine Nachbildung einer von Rembrandts berühmtesten Darstellungen seines Sohnes Titus, der ein Buch liest. Dank der Widmung neben dem Bild wissen wir, dass es sich um das Exlibris des berühmten Autors und Biografen Emil Ludwig (1881-1948) handelt. Ludwig, der ein grosser Bewunderer von Rembrandt war und auch zwei Bücher über ihn geschrieben hat, war David Frankfurters grösster Verteidiger während seines Prozesses. Noch im Jahr der Ermordung nahm Ludwig es auf sich, den Fall Frankfurter zu untersuchen. Er sammelte alle Informationen, die er bekommen konnte, befragte Frankfurters Familie und Bekannte und veröffentlichte sein berühmtes Buch „Der Mord in Davos“.

Emil Ludwig – Der Mord in Davos. Querido Verlag, Amsterdam, 1936.
Das Buch ist ein Plädoyer für Frankfurter, indem es sowohl seine Lebensgeschichte als Rabbinersohn verfolgt als auch den Prozess der Nazifizierung Europas detailliert beschreibt. Es vergleicht das Attentat mit anderen politischen Morden, die aus einem Gefühl von Gerechtigkeit und Ehre heraus begangen wurden, und kritisiert die Schweizer Justiz, die von der Angst vor dem deutschen Regime beeinflusst wurde.

Wolfgang Diewerge – „Der Fall Gustloff“ (1936) und „Ein Jude hat geschossen“ (1937) Franz Eher Nachf. Verlag, München.
Das Buch wurde 1936 vom berühmten Exilverlag Querido in Amsterdam veröffentlicht und in der Schweiz als Greuelpropaganda verboten, während zwei andere Bücher des Antisemiten, Nationalisten und Propagandisten Wolfgang Diwerge, die offen gegen Frankfurter hetzten und seine Auslieferung an Deutschland forderten, in der Schweiz zugelassen wurden.

Antisemitische Karikatur, die die Schweiz während des Frankfurter Prozesses kritisiert. Aus der antisemitischen deutschen Zeitung „Das schwarze Korps“ vom 27. 2. 1936.
Die zweite Auflage des Buches mit dem treffenden Titel „David und Goliath“ erschien 1945 im Carl Posen Verlag in Zürich und enthält einen Epilog, der das erste Treffen zwischen David Frankfurter und Emil Ludwig beschreibt, nachdem ersterer aus dem Gefängnis entlassen worden war (er war zu 18 Jahren verurteilt worden, wurde aber bereits nach neun Jahren freigelassen).

Emil Ludwig – David und Goliath. Carl Posen Verlag. Zürich, 1945.
Oded Fluss, Zürich
Ilustraciones, diseño y cubierta: Luis Rodríguez (Noa)
Editado por: Hasso Böhme y Johannes Baumgartner
Mit Begeisterung, Witz und Können hat sich der kubanische Künstler Luis Rodríguez (NOA) mit dem «Struwwelpeter» auseinandergesetzt. Daraus entstand eine zeitgemäße Struwwelpeter-Neuinterpretation, die Text und Bilder farbenfroh den kubanischen Kindern in einem neuen Gewand vorstellt. Surfend steht «Pedrito mit den zerzausten Haaren» auf einer Banane und schaut vergnügt in die Welt hinaus und hat sichtlich Spaß an der vielfältigen Kultur Kubas. Das Gleiche lässt sich auch über die anderen Protagonisten sagen: Bunt und fröhlich geht es in den Geschichten von NOA zu, so wie das «Vida Loca» in Kuba eben spielt.

Eine herausragende Spezialität dieses Kinderbuches ist die Dreisprachigkeit: Kubanisch - interpretiert von NOA, Deutsch - mit den Originaltexten und -bildern von Heinrich Hoffmann aus dem Jahr 1844 und auch die amerikanische Interpretation von Mark Twain von 1891 ist darin zu finden.

ISBN 978-3-00-062705-7, dohaböhme Vertrieb und Verlag AG ()
Hasso Böhme, Unterengstringen
Am 11. September 1881 ereignete sich in Elm im Kanton Glarus eine Naturkatastrophe ungeahnten Ausmaßes, die als „Bergsturz von Elm“ in die Geschichte eingehen sollte. Eine wesentliche Ursache war der jahrelange übermäßige Schieferabbau im Steilhang oberhalb der Gemeinde. Schon ab 1878 machten sich zunehmend Bewegungen im Berg bemerkbar. Im Sommer 1881 bewirkten starke Regenfälle eine Destabilisierung des gesamten Deckgebirges, was schließlich zur Katastrophe mit vielen Toten und Verletzten führte.

Noch im selben Jahr erschien in Zürich eine ausführliche "Denkschrift" von Ernst Buss, Pfarrer in Glarus, und Albert Heim, Professor in Zürich, in der frühere Bergstürze in der Schweiz, die Situation und geologische Lage von Elm vor dem Unglück, die Ursachen des Unglücks sowie Aussagen von überlebenden Augenzeugen geschildert sind.
Hier der Link zur Denkschrift: https://de.glarusfamilytree.com/_files/ugd/05586e_0a0067a5199f4b8f9f4a765195f5da3a.pdf

In der Zeitschrift „Die Eisenbahn“, Bd. 15, Nr. 12 vom 17. September 1881 erschien dazu folgender Bericht:
"Sonntags, den 11. September, zwischen 5 und 6 Uhr Abends wurde ein grosser Theil der wohlhabenden und blühenden Gemeinde Elm im Canton Glarus durch einen Bergsturz verschüttet. Schon geraume Zeit vor dem Unglückstage zeigten sich oberhalb des Schieferbergwerks „Plattenberg“ Spalten und Risse. Das Resultat einer Untersuchung, die von Herrn Cantonsförster Seeli in Glarus vorgenommen wurde, lautete keineswegs beruhigend; dies veranlasste Herrn Seeli, das Schlagen von Holz an diesem Abhang zu verbieten und den Fortbetrieb des Schieferbergwerks als gefährlich zu erklären. Immerhin erschien die Gefahr für das Dorf als keine so imminente, wie sie sich leider durch die seitherigen Ereignisse herausgestellt hat. Dass die Katastrophe durch wolkenbruchartige Regengüsse, welche sich gegen Ende der letzten Woche eingestellt hatten, beschleunigt, ja vielleicht herbeigeführt wurde, wird allgemein angenommen.
Schon während des ganzen Sonntags war das Erdreich in beständiger Bewegung. Grössere und kleinere Theile lösten sich ab und stürzten mit donnerähnlichem Getöse in die Tiefe. Eine erste bedeutende Erdmasse löste sich Abends zwischen 5 und 6 Uhr ab und begrub die nächstliegenden Häuser von Unterthal im Schutt. Sofort eilte Alles nach der Unglücksstätte, um den Verschütteten Hülfe zu bringen. Doch kaum hatten die Bewohner von Elm die unterhalb des Dorfes liegende eiserne Brücke über den Sernft passirt, so löste sich eine zweite, weit grössere Masse vom Berg ab und wälzte sich mit ungeheurer Schnelligkeit gegen die Strasse und das Dorf zu, Alles in ihrem Laufe verheerend und das ganze Unterthal, sowie auch die unterhalb Elm links und rechts vom Sernft liegenden Häuser mit Felsblöcken und Schutt bedeckend. Der Luftdruck, der den in's Thal stürzenden Massen voranging, war so gross, dass Bäume entwurzelt, Häuser zusammengedrückt und deren Dächer in der Luft fortgetragen wurden. Im Nu waren die auf die Unglückstätte eilenden Menschen vom Windzug erfasst und zu Boden geworfen. Ohne Zweifel waren sie erstickt, bevor sie von den Steinmassen zerschlagen wurden. Einzelne wurden durch die Luft getragen, niedergeworfen und von nachdonnerndem Felsmaterial verschüttet.
Augenzeugen berichten, dass zuerst der Wald oberhalb der Steinbrüche sich bewegt habe wie ein vom Sturmwind aufgeregtes Roggenfeld, dann stürzte der Wald in die Tiefe und gleichzeitig der ganze mächtige Felskopf über dem Schieferbergwerk. Die bewegte Masse wurde durch die ihr innewohnende lebendige Kraft bis nahezu 1 km unterhalb Elm geschleudert. An dem gegenüberliegenden Abhang oberhalb Unterthal stieg sie wieder empor, so dass dort die Grenze der Verwüstung ungefähr 70 m über dem Thalgrund liegt. Felsblöcke von über 3000 t Gewicht flogen wie leichte Spielbälle durch die Luft.
Der Sernft wurde durch die Schuttmasse gestaut und aus seinem Bette getrieben. Er drohte anfänglich den noch verschont gebliebenen Theil von Elm zu überschwemmen. Bald bildete sich jedoch ein Abfluss über schöne Wiesen, so dass der gefürchtete See nur in kleinem Maassstab zu Stande kam. Die heruntergestürzte Schuttmasse ist merkwürdig trocken und fest gelagert, so dass sie sozusagen fast keine hohlen Räume bildet. Auch alle die Menschen, welche bis jetzt herausgegraben worden sind, waren, bis auf einen Einzigen, der noch lebend hervorgegraben werden konnte, stark verstümmelt und zerrissen. Von anderen lebend Begrabenen hat man keine Spur und es ist überhaupt unwahrscheinlich, dass noch mehr solcher vorkommen.
Das durch den Bergsturz verwüstete Gebiet hat eine Länge von 2 km und eine Breite von 500 bis 600 m. Verschüttet wurden 22 Wohnhäuser und 50 Ställe. Als vermisst werden amtlich constatirt 110 Einwohner von Elm und 3 Einwohner aus der unterhalb Elm gelegenen Gemeinde Matt. Der Gesammtschaden des verschütteten Terrains wird nach einer vorläufigen Taxation auf ungefähr eine Million Franken angeschlagen."

Die Schweizerische Bibliophilen-Gesellschaft veranstaltete am 25. und 26. Juni 2022 ihre Jahrestagung im Kanton Glarus und verteilte aus diesem Anlass ein "Bhaltis", ein Souvenir, das den Bergsturz von Elm zum Thema hatte. Die Konzeption dieses "Bhaltis" besorgte Dr. Wolfram Schneider-Lastin, die grafische Gestaltung in Form eines Leporellos die Firma Wolfau Druck AG in Weinfelden.
Ce livre est une version imprimée de la Divine Comédie de Dante, un texte très largement diffusé au Moyen Âge qui eut un rôle fondateur pour la langue italienne et la culture littéraire de la Renaissance.

Cette édition du célèbre imprimeur vénitien Alde Manuce est remarquable : elle est l’une des premières publications à utiliser une typographie inédite et révolutionnaire, appelée à faire date. Cette police avait été mise au point dès 1499 par Francesco Griffo, en réponse à une demande de Manuce qui voulait réduire la taille des livres en fournissant des petits formats manipulables et bon marché, afin d’en faciliter l’accès aux étudiants : les "libelli portatiles" ou livres de poche.

Griffo imagina alors des caractères penchés permettant de mettre plus de texte sur des pages plus petites, sans perdre en lisibilité. Ainsi naquirent ce qu’on appelait alors les « lettres vénitiennes » et qui, le succès venant, furent surnommées « italiques », pour rappeler leur origine. Ces deux inventions, le format de poche et l’italique, contribuèrent à l’immense réputation de l’imprimeur.

Le saviez-vous ? Ce volume peut être admiré dans les salles du musée de la Fondation Martin Bodmer, dans le cadre de l'exposition « Géant et nains », au cœur de la permanente. La bibliothèque de Martin Bodmer possède également trois manuscrits exceptionnels de la Divine Comédie ainsi que huit autres éditions incunables (i.e. imprimées avant 1500).
Fondation Martin Bodmer, Cologny
Gesammelt haben die Gestalterin Regula Ehrliholzer und der Gestalter René Wäger das Gewöhnliche, das Aussergewöhnliche, das Gestylte, das Unperfekte, das Verwirrende, das Flickwerk – oder wie man auf Schweizerdeutsch sagen würde: das «Gschnurpf». «Means to an End» ist ein Buch mit Bildern von Zeichen, Markierungen und Worten, fotografiert von Frühjahr 2020 bis Sommer 2021. Im April 2020 entstand die «Corona-Signaletik»: Zeichen und Leitsysteme, welche zu einem grossen Teil von Laien zu Beginn der Pandemie erstellt wurden. Das Auftauchen von Systemen zur Orientierung im Raum weckte das Interesse von Autor und Autorin zu einer Zeit, als das öffentliche Leben auf ein Minimum beschränkt wurde und neue Regeln in Kraft traten, die im Raum sichtbar wurden. Das Buch ist eine Hommage an die Kreativität von Laien in dieser besonderen Situation – und an eine Art Ur-Grafik.» Zeitgleich begannen die Grafikerin Regula Ehrliholzer und René Wäger, Berufsschullehrer für Typografie, Schrift und Gestaltung, zu fotografieren, weshalb sie sich für das Projekt zusammengeschlossen haben.

Abb. 1: Umschlag aussen, Rückseite (links, mit deutschem Titel), Vorderseite (rechts, mit offiziellem Titel «Means to an End»).
Ganz so, wie die «Corona-Signaletik» aus dem Nichts entstand, erfolgt auch der Einstieg in das Buch: ohne Ankündigung und mit einer Bilderwucht – einem «Wildwuchs der Zeichen» – auf dünnem Magazin-Papier, eine Referenz an den provisorischen Charakter der Thematik. Der Bildteil umfasst auf 248 Seiten 1200 farbige Fotografien von Regula Ehrliholzer und René Wäger 2021 – meist, aber nicht ausschliesslich – aufgenommen in der Schweiz in ca. 30 verschiedenen Ortschaften. Die bildbearbeitenden Eingriffe sind sachte ausgeführt worden, und die Aufnahmen sind in ihrer schnappschussartigen Perspektive und Wildheit erhalten geblieben. Angeordnet sind sie in einem strengen, dokumentarisch anmutenden Raster und visuell sind in der Platzierung aufeinander abgestimmt. Die Kapitel tragen Titel wie Pfeile, Linien, Punkte, Kreuze, Boxen, Fussabdrücke, sind aber ohne Einleitung und Erläuterung nahtlos aneinandergefügt.

Abb. 2: Seiten 2–3, Kapitel «Pfeile».
Auf den 24 hellblauen Seiten am Schluss des Buches ist ein pointierter Essay des Semiotikers André Vladimir Heiz angefügt sowie Erfahrungsberichte von Fotograf und Fotografin. Das Layoutkonzept stammt vom Studio Vieceli & Cremers, Satz und Layout übernahm Regula Ehrliholzer. Erschienen ist das Buch 2021 bei everyedition in Zürich (https://everyedition.ch/studio/).

Abb. 3: Textteil in der zweiten Buchhälfte, gesetzt in der Schrift Bradford (Lineto).
Parallel zum fotografischen Sammeln begann Ehrliholzer mit dem Sortieren. Erst einmal nach dem Kriterium, dem sie von Anfang an intuitiv gefolgt war, der Form. Sie gruppierte alle Pfeile, Kreuze, Punkte, Rechtecke, Schilder, Stop-Zeichen, Exit-Hinweise, Sanitizer-Flaschen und schliesslich ganze Systeme grafischer Lösungen. Die Sortierung widerspiegelt nicht zuletzt ihre Art zu fotografieren, die sich zu Beginn auf Detailaufnahmen festlegte. Aber immer mit den Gedanken an das Ganze, an die Beweggründe, die zu den sichtbaren Ergebnissen geführt haben mögen. In der Abfolge der Bilder schliesslich ist durchgängig auch die Chronologie erkennbar geblieben. Anfänglich waren beispielsweise zwei Meter Abstand gefordert, später nur noch 1,5 Meter. Nach der Veröffentlichung des Buches hat die Fotografin einige Orte erneut aufgesucht, um die Macher:innen der «Volkssignaletik» zu Motivation und Vorgehen zu befragen. Einige dieser Porträts sind anschliessend auf Instagram veröffentlicht worden.

Abb. 4: Seiten 142–143, Kapitel «Systeme».

Abb. 5: Seiten 142–143, gehalten von einer Mitarbeiterin der Post, Scuol (links) und Seiten 76–77, Kapitel «Fußabdrücke», gehalten von einem Denner-Mitarbeiter, Zürich Witikon (rechts).
Für die Dokumentation bevorzugten Autor und Autorin das Medium Buch, um aus einer chronologischen Sammlung einen neugeordneten, gestalteten Raum zu schaffen, welcher auch die Funktion eines «Poesiealbums» übernehmen kann. Sie erkannten den humoristischen Aspekt einiger «Inszenierungen» und erfreuten sich ob der grassierenden Improvisationskunst. Denn, «einigen Instant-Grafikern und inspirierten Selfmade-Gestalterinnen macht die Sache sichtlich Spass. Andere erfüllen die Pflichtübung ohne weiteres Aufsehen.» (André Vladimir Heiz, Means to an End) Sichtbar wurde schnell, dass die Professionalität oder Sorgfalt der Ausführung nicht mit der Grösse eines Geschäftes oder der Bekanntheit einer Marke zusammenhing, sondern Ausdruck des Gestaltungswillens oder der Gestaltungskompetenz einzelner Personen war. Oder dass, gerade bei grösseren Unternehmen, die pressanten und unplanbaren Gestaltungsaufgaben (sofort oder auch erst im Laufe der Zeit) interne Abläufe, Zuständigkeiten und Anspruchshaltungen zu Tage förderten. Manifestiert im Eingangsbereich einer Postfiliale, einer Apotheke, eines Grossverteilers oder Museums.

Abb. 6: Seiten 98–99, Kapitel «Zählen»: Wie viele Personen dürfen sich in einem Raum, in einem Geschäft aufhalten?
Deshalb «Means to an End», der Titel: die improvisierende Gebrauchsgrafik als «Mittel zum Zweck». «Selbermachen hat hier allen Grund» (Heiz, ebd.). Als Gestalter:innen beschäftigen sich Ehrliholzer und Wäger laufend mit Kennzeichnung, Beschriftung und Wegleitungen. Das Bundesamt für Gesundheit erliess 2020 Auflagen, an welche sich Geschäfte, die während der «Ausserordentlichen Lage» geöffnet sein durften, zu halten hatten. Für die Umsetzung der Bestimmungen wurden Merkblätter zur Verfügung gestellt, die bald überall zu sehen waren. Weitgehend aber waren Geschäfte für die Umsetzung der Vorgaben auf die Interpretation von schriftlichen Verordnungen angewiesen. Inzwischen haben Standards die Schule gemacht, Zeichen verwittern, werden oft gar nicht mehr erneuert, wir kennen die Litanei. Es ist Zeit für ein Erinnerungsalbum.
Regula Ehrliholzer, Zürich
Angaben zum Buch:
Titel: Means to an End
Autor:innen: Regula Ehrliholzer, René Wäger, André Vladimir Heiz
Verlag: everyedition, Zürich
ISBN: 978-3-9524894-8-2
Mit einzelnen Gastbeiträgen von Daniel Frei, Michael Guggenheimer, Max Hofmänner, Martina Müller, Samo Štahler, Sylvia V. Clara Zellweger, Beatrice Ziörjen.
Aufnahmeorte u.a.: Aarau, Aigle, Baden, Bern, Biel/Bienne, Bischofszell, Cannobio, Dresden, Flüelapass, Fribourg, Friedrichshafen, La Chaux-de-Fonds, Görlitz, Lausanne, Le Locle, Lenzburg, Lenzerheide, Locarno, Luino, Luzern, Neuchâtel, Schlieren, Scuol-Tarasp, St. Gallen, Turgi, Unterägeri, Windisch, Zernez, Zürich.
Als im Jahr 1734 das kleine Büchlein Essai politique sur le commerce von Jean-François Melon (1675-1738) erschien, war die literarische Welt voller Lob für den Autor. Tatsächlich war die knappe Beschreibung der Grundzusammenhänge von Handel, Produktion und Geldwirtschaft die erste Gesamtdarstellung der volkswirtschaftlichen Zusammenhänge, die als gedrucktes Buch erschienen ist. Noch im Jahr der Erstveröffentlichung wurden drei Raubdrucke des Werkes veröffentlicht und bereits 1736 publizierte Melon eine deutlich erweiterte Neuausgabe des Buchs.

Abb. 1: Titelblatt der ersten Ausgabe.
Voltaire (1694-1778) schrieb über das Werk und seinen Autor: «L’Essai sur le commerce de M. Melon est l’ouvrage d’un homme d’esprit, d’un citoyen, d’un philosophe ; il se sent de l’esprit du siècle, et je ne crois pas que du temps même de M. Colbert il y eût en France deux hommes capables de composer un tel livre. ..., souffrez que je me livre au plaisir d’estimer tout ce qu’il dit sur la liberté du commerce, sur les denrées, sur le change et principalement sur le luxe.»[1] und das Journal des Sçavans lobte den Autor mit den Worten: «Il est peu de livre écrits avec tant de précisions que celui-ci, & qui contiennent auttant de choses en moins de mots.»[2]
Tatsächlich erschienen im 18. Jahrhundert insgesamt 20 Ausgaben des Buches. Darunter waren auch Übersetzungen in Englisch (1738), Deutsch (1740/1756), Schwedisch (1751), Italienisch (1754), Dänisch (1759), Russisch (1768) und Spanisch (1786).[3] Selbst wenn das zur gleichen Zeit geschriebene, aber erst 1755 veröffentlichte, Werk von Richard Cantillon (1680-1734) Essai sur la nature du commerce en general als das theoretisch reifere Werk gelten muss, ist damit der Einfluss von Melons Arbeit kaum zu überschätzen. Seine intellektuelle Leistung besticht durch die stark abstrahierende Methode und die Fähigkeit bislang als unverbunden betrachtete ökonomische Prozesse als vernetzt zu verstehen und einfach zu erklären.

Abb. 2: Titelblatt der zweiten Ausgabe.
Interessant an den beiden Frühwerken der volkswirtschaftlichen Betrachtung von Cantillon und Melon ist, dass beide als Reaktion auf den ersten grossangelegten Versuch der Einführung eines staatlichen Papiergeldes zu verstehen sind. Der Schotte John Law (1671-1729) hatte in den Jahren 1719/20 im Auftrag des Regenten Philipp von Orléans (1674-1723) versucht die grosse, von Ludwig XIV (1638-1715) verursachte Staatsverschuldung in den Griff zu bekommen. Mit der Ausgabe von gedrucktem Geld und den Privatisierungserlösen der staatlichen Aktiengesellschaft für den Monopolhandel mit der französischen Kolonie in Nordamerika wurden die Schulden weitgehend zurückbezahlt. Durch fortgesetztes Drucken von Geld entstand in der Folge allerdings eine spekulative Blase am Aktienmarkt, der erst durch rapide steigende Inflation ein Ende gesetzt wurde. Die darauffolgende Wirtschaftskrise, das Leid der durch die Inflation ausgelösten Verelendung der Massen und der Ruin der Spekulanten verlangten nach Erklärungen.

Abb. 3: Titelblatt der erweiterten Neuausgabe.
Melon hat diese Entwicklung als Beteiligter direkt miterlebt. Ist er doch zunächst Privatsekretär von Law gewesen und nach dessen Entlassung in den Diensten Philip von Orléans übergetreten. Nach dem Tod des Regenten im Jahr 1723 widmete er sich seinen literarischen Ambitionen. Als enger Freund von Montesquieu (1689-1755) und von Maupertius (1698-1759) war er regelmässiger Gast bei den Zusammenkünften der wichtigsten Intellektuellen seiner Zeit, so z.B. im Café Procope, im Gradot, im Café der Witwe Saint-Laurent oder im Salon der Marquise de Lambert. 1738 verstarb er im Kreis seiner Familie und Freunde.
Angesichts der aktuellen Entwicklung von Wirtschaft, Staatsverschuldung und Aktienmärkten gewinnt das Werk von Melon, aber auch die volkswirtschaftliche Debatte der frühen Aufklärung insgesamt, an neuer Brisanz. Tatsächlich entstand damals in der Folge des wirtschaftlichen Desasters Frankreichs die Grundlage der heutigen makroökonomischen Wissenschaft. Auch der bekannte schottische Moralphilosoph und Ökonom Adam Smith (1723-1790), der für viele Menschen fälschlicherweise als Begründer der Ökonomie gilt, verfügte in seiner Bibliothek über die Werke von Cantillon und Melon.
Klaus Wellershoff
[1] Voltaire (1738): Observations sur MM. Jean Law, Melon et Dutot. In: Thurneysen (1789): Oeuvres Complètes de Voltaire. Vol. 29, S. 145ff. Basel: Thurneysen.
[2] Journal des Sçavans (1736), August, S. 496. Paris: Chaubert.
[3] Carpenter (1975): Economic Bestsellers Before 1850. Harvard: Baker Library.
צאינה וראינה
Tseʾenah u-reʾenah: ʿal ḥamishah ḥumshe torah, ZEENOHURENOH, Lemberg, Pesel Balaban 1896
Von jeglichen Restaurationsvorhaben dieses Buches wurde mir abgeraten. Zu aufwendig und viel zu teuer wäre es, den Zerfall wegen seiner miserablen Qualität stoppen zu wollen. Das in unterschiedlichen Beige-Tönen gealterte Papier zerbröselte buchstäblich vor sich hin, auch wenn niemand darin blätterte. Dem Buch fehlten diverse Seiten und die noch vorhandenen vermochte die Bindung mit letzter Kraft kaum zusammenzuhalten. Wer in dem Band blättern wollte, musste wahrlich Sorgfalt walten lassen.
Meine Gegenüber, eine Buchrestauratorin oder ein Bibliothekar oder Ähnliches, waren jeweils sichtlich um Mitgefühl bemüht, wenn man mir empfahl, das Buch auf dem Friedhof würdig beerdigen zu lassen. Ein Ratschlag, den ich frühestens als etwa Zwanzigjährige erhalten haben dürfte. Das ist einige Jahrzehnte her. Wer mir die Empfehlung gab, wusste, dass im Judentum Bücher, die den Namen Gottes enthalten, um Himmels willen nicht entsorgt werden dürfen. Doch selbst die ehrenvollste Bestattung schien mir alles andere als opportun, und dies nicht bloss deshalb, weil das Buch aus dem Haus meiner Grosseltern stammte.

Abb. 1: Solch feines Dekor gibt es im Innern des Buches nicht mehr.
Unbeachtet hatte der Band stets auf einem Regal der Bücherwand bei meinen Eltern gelegen. Irgendwann entdeckte ich, dass meine Kenntnisse des hebräischen Alphabets – nicht aber der hebräischen Sprache! – ausreichten, um zumindest einen Teil des Textes zu verstehen: es war Jiddisch. Eine eigenartige Sympathie weckten die Widersprüche, die von diesem Buch ausgingen. Eingangs zeugen feinst ziselierte Schnörkel davon, dass die Herausgeberschaft auf Ästhetik achtete, während sowohl bei der Paginierung wie bei den Illustrationen immer wieder Fehler auffallen; Ziffern wurden verwechselt, wenn beispielsweise die Seite 332 mit der Zahl 232 versehen ist. Oder es findet sich ein und dieselbe Illustration an einer passenden und einer anderen, unpassenden Textstelle.

Abb. 2: Hier behauptet die Legende: Dos is wie die stat sdom brennt in faier. - Der umgebende Text thematisiert tatsächlich die Erzählung zu Sodom und Gomorra, nicht aber die Illustration, die viel eher der biblischen Szene über die Opfergaben entspricht, kurz bevor Kain seinen Bruder Abel erschlägt.
Meine Neugierde trieb mich dazu, 1981/82 bei Prof. Stefan Sonderegger ein Linguistik-Seminar zu Bibelübersetzungen zu besuchen und mich dabei eingehender mit meinem Erbstück zu befassen. Beinahe mystisch mutete an, dass just die Ausgabe auf meinem Schreibtisch in keiner der einschlägigen Bibliografien verzeichnet war.
Inzwischen ist die Zeenohurenoh mehrmals mit mir umgezogen. Im Jahr 2014 wollte die Bibliothek der Israelitischen Cultusgemeinde Zürich (ICZ), der das Bundesamt für Bevölkerungsschutz 2009 das Prädikat «Kulturgut von nationaler Bedeutung» verliehen hatte, ihr 75-jähriges Bestehen mit einem Sammelband über besondere Bücher feiern. «Die wertlose Bibel» hiess die Überschrift über meinem Beitrag zur Zeenohurenoh meiner Grosseltern.

Abb. 3: Meine Grosseltern Etta und Menasche (in Zürich nannte er sich Max. 1872-1947) Gablinger. Die beiden ersten Kinder hier wurden in Ustrzyki Dolne (Galizien, heute Polen) geboren, wo 1905 auch mein Vater als viertes Kind zur Welt kommen sollte.

Abb. 4: Meine Grossmutter Etta Gablinger (ca. 1873-1941).
Meine Recherchen für den Beitrag, für die diesmal mit dem Internet neue Möglichkeiten zur Verfügung standen, führten zu einem ähnlichen Ergebnis wie ehedem: Keine Spur gab es für eine Zeenohureno, gedruckt 1896 in Lemberg. Generell aber hält The Yivo Encyclopedia of Jews in Eastern Europe die Tsene-rene (die Schreibweisen aller bibliografischen Angaben variieren stark) für «eines der populärsten und einflussreichsten Bücher des osteuropäischen Judentums, allgemein bekannt als ‹Frauenbibel›». Als ihr Urheber gilt Rabbi Jakob ben Jitzchak Ashkenasi, der vielleicht von 1550 bis 1628 im polnischen Janow lebte. Ob seither zwei- oder mehr als dreihundert Ausgaben erschienen sind, darüber sind sich die Fachleute uneins. Fest steht, dass das Buch seit je biblische Geschichten enthielt, die weniger in wortgetreuer Übersetzung, sondern eher als freie Erzählungen präsentiert wurden. Denn auf diese Weise sollte der in kläglicher Armut lebenden jüdischen Bevölkerung Osteuropas die Grundkenntnisse der religiösen Schriften vermittelt werden. Üblicherweise unterschied sich jede Edition von den vorherigen in Typografie und Inhalt. Wurde in einer Ausgabe eine Passage detailreich ausgeschmückt, mochte eben diese in einer nächsten gänzlich entfallen. Ob der Titel, der sich im Hohelied (3,11) findet: «Kommt heraus und seht, Ihr Töchter Zions» von jeher ein weibliches Publikum ansprechen sollte, bleibt Interpretationssache.
Ein breites Publikum sollte zur Lektüre der Zeenohurenoh verleitet werden. Die Massnahmen, um dieses Ziel zu erreichen, präsentiert die Herausgeberschaft noch vor dem Vorwort:

Abb. 5: Hier werden die Vorzüge dieser Ausgabe und zusätzliche Inhalte aufgezählt; die Vokalpunkte dienen der besseren Lesbarkeit und es wurde die Geschichte von Purim und vom Chanukkawunder, sowie ein jüdischer Feiertagskalender hinzugefügt.

Abb. 6: Als wenig wertvoll galt das Buch offenbar in der Familie; die Innenseiten der Buchdeckels weisen Kritzeleien auf. Mein Grossvater Menasche/Max hat da wohl seine Unterschrift geübt.
Anspruchsvolle Druckerzeugnisse sind überdies ebenfalls im Verlag Balaban erschienen, den Pessels Schwiegervater Löb Balaban im 19. Jahrhundert gegründet hatte. Er starb 1851, worauf sein Sohn Pinchas die Verlagsleitung übernahm. Gemeinsam produzierten Pinchas und seine Frau Pessel zahlreiche jiddische Bücher und als er starb, führte die Witwe den Verlag, sodass Pesel Balaban (sic!) im Jewish Women´s Archive als berühmteste Verlegerin Lembergs jener Zeit genannt wird.
Es waren Jahre der politischen und gesellschaftlichen Umbrüche. Immer wieder waren gewaltsame Ausschreitungen gegen die jüdische Bevölkerung gerichtet, die ohnehin schon durch Restriktionen beim Wohn- und Arbeitsrecht eingeschränkt war.
Inwiefern dann die Geschichte der Zeenohurenoh mit jener meiner Grosseltern zusammenhängt, lässt sich nur in Vermutungen darstellen. Immerhin ist mir letzten Endes gelungen, eine geeignete Heimat für den Band zu finden. Nachdem angefragte Institutionen auf mein Mail-Angebot nicht eingegangen waren, erreichte mich die Nachricht der Judaistin Ute Simeon, damals Mitarbeiterin der grossartigen Judaica-Sammlung der Universitätsbibliothek Frankfurt a. M. Sie willigte ein, die Zeenohurenoh zu übernehmen und, wie die mehr als ein Dutzend älteren Ausgaben, kostenlos dauerhaft online zu stellen. Seit Mai 2015 ist der Band abrufbar, mit der Anmerkung:
Schenkung zur Digitalisierung von Vivianne Berg, Zürich (aus dem Nachlass des Vaters Isy Gablinger-Rosenberg 1905-1971). [...] Text in hebr. Schr., überw. in jidd., teilw. auch in hebr. Sprache Transliterationsvarianten: Zeenohurenoh. Zeenah u-reenah. Zennerenne. Zene rene. Tsene-Rene. Ṣe'enah u-Re'enah
Vivianne Berg
Literatur
Digitalisat:
Tseʾenah u-reʾenah: ʿal ḥamishah ḥumshe torah ... / fun Yitsḥaḳ mi-ḳ. ḳ. Yanoṿ. ʿIm Shelah ha-ḳadosh ṿe-ʿim Sefer ha-Yashar ṿe-Sefer Ohel Yaʿaḳov fun Yaʿaḳov mi-Dubno ...
https://sammlungen.ub.uni-frankfurt.de/judaicaffm/urn/urn:nbn:de:hebis:30:1-149211
Berg, Vivianne:
- Die wertlose Bibel. In: Quelle lebender Bücher: 75 Jahre Bibliothek der Israelitischen Cultusgemeinde Zürich. Yvonne Domhardt & Kerstin A. Paul (Hrsg.). Edition Clandestin, Biel 2014. ISBN 978-3-905297-58-4. S. 41-46.
- Zeenohurenoh, Lemberg 1896: eine jiddische Bibel. Zürich, Seminararbeit UZH WS 1981/82.
Cooper, Levy: Is there a secret history of Jewish women publishing Hebrew books? In: The Jerusalem Post. 26. Nov. 2021: https://www.jpost.com/judaism/is-there-a-secret-history-of-jewish-women-publishing-hebrew-books-687043
Breger, Jennifer: Printers. In.: Jewish Women´s Archive. https://jwa.org/encyclopedia/article/printers
Tsene-rene. In: The Yivo Encyclopedia of Jews in Eastern Europe. Jacob Elbaum, Chava Turniansky. https://yivoencyclopedia.org/article.aspx/Tsene-rene
Schuchardt, Konstantin: Eine Genisa ist ein verstecktes Depot zur Aufbewahrung unbrauchbar gewordener Schriften. Jüdische Allgemeine vom 23. 11. 2015: https://www.juedische-allgemeine.de/glossar/genisa/
Ein Mix aus Enzyklopädie und Emblembuch
Der Kupferstecher und Kunsthändler Christoph Weigel (1654–1725) gibt in seinem Verlag 1698 ein 676 Textseiten starkes, mit 212 Kupfertafeln bebildertes Buch heraus:
Abbildung Der Gemein-Nützlichen Haupt-Stände. Von denen Regenten Und ihren So in Friedens- als Kriegs-Zeiten zugeordneten Bedienten an/ biß auf alle Künstler Und Handwercker/ Nach Jedes Ambts- und Beruffs-Verrichtungen/ meist nach dem Leben gezeichnet und in Kupfer gebracht/ auch nach Dero Ursprung/ Nutzbar- und Denkwürdigkeiten/ kurtz/ doch gründlich beschrieben/ und ganz neu an den Tag geleget von Christoff Weigel/ in Regenspurg. Gedruckt im Jahr Christi 1698.
Das ist eine Enzyklopädie von 204 Berufen, in 24 Abteilungen ständisch geordnet; Weigel unterscheidet im Vorwort einen Regier-, einen Lehr- und einen Nehrstand. Das Buch ist demnach aufgebaut vom Regenten über ‹white collar jobs›, dann zu Handwerkern im engeren Sinne bis zu mühsame und schmutzige Arbeiten Verrichtenden, zuletzt zum Totengräber; wobei gesagt wird, dass diese Berufe zwar gering, aber dennoch notwendig sind. Man erkennt, wie ausgefächert und abgegrenzt das Handwerk im 17. Jahrhundert war. Beispielsweise werden bei der Eisen-Verarbeitung (XIV. Abtheilung) 17 Teil-Disziplinen unterschieden: Winden-Macher, Zirckelschmied, Feilenhauer, Ahlenschmied, Polierer, Nadler, Flaschner, Kettenschmied, Nagler u.a.m.
Die Artikel bestehen großenteils aus ausführlichen Erörterungen zur Geschichte des hergestellten Produkts von der heidnischen Antike und dem Alten Testament bis in die Gegenwart. Die soziale Stellung des Berufs, die benutzten Materialien und Werkzeuge, Hinweise zur Ausbildung werden nur kurz beschrieben; zuletzt wird jeweils auf die Nutzbarkeit und Nothwendigkeit der hergestellten Produkte eingegangen. Wie man die Werkzeuge handhabt, wird nicht gesagt; die Bilder geben spärliche Hinweise dazu; etwa wie man einen Hammer oder eine Feile hält. Das Buch taugt nicht als Anleitung, um ein Handwerk auszuüben; das ist Sache der Berufslehre und bleibt geheimes Wissen.
Frauen kommen fast gar nicht vor – das ist nicht einfach auszumachen, weil die männlichen Handwerker meist lange Schürzen oder Röcke tragen. Ausnahmen: Beim Dockenmacher von Trachant (VIII,9) scheint eine Frau Puppenköpfe zu bemalen; beim Ölschlager (XX,4) hilft eine Frau; beim Steinschneider (XI,1) scheint eine Frau das Antriebsrad der Fräse zu bewegen.
Jedem Beruf ist eine Kupfertafel beigegeben. Diese hat (abgesehen von der Berufsbezeichnung zuoberst) wie der Prototyp der Embleme (Andrea Alciato 1531) einen dreiteiligen Bau: Motto – Bild – Epigramm in Versform. Die Epigramme werden dem Nürnberger Samuel Faber (1657–1716) zugeschrieben.
Durch die Einfügung der Embleme in die Ausführungen zu den Berufsgeschichten wird das Buch zu einem seltsamen Kompositwesen.
Exkurs: Die Geschichte der Kupfertafeln
Vorbemerkung: Kupferstich ist im Buch selbst der Überbegriff für Stechen/Radiren und Schwartze Arbeit [Schabkunst, Mezzotinto] (S. 204f.); das Bild mit dem Titel Der Kupfferstecher zeigt einen Gesellen, der die Ätzflüssigkeit von der Platte in einen Behälter gießt.
• 87 der Bilder stammen aus der 1694 erschienenen Sammlung «He Menseleyk Bedryf» der Niederländer Jan (1649–1712) und Caspar Luyken (1672–1708). Die Bilder sind met Versen in niederländischer Sprache versehen, das heißt: Es sind Embleme. Ein die Berufe beschreibender Text existiert nicht. Die Bilder wurden für das «Ständebuch» (teils von Caspar Luyken selbst) neu gestochen; das war insofern nötig als die Texte nicht typografisch gesetzt, sondern auf dem Stich geschnitten waren und jetzt auf Deutsch erscheinen mussten.
• Die als Vorlagen für die neuen Kupfer im «Ständebuch» angefertigten Zeichnungen stammen von Georg Christoph Eimmart (1638–1705), der in Handwerksbetrieben realitätsgetreue Studien angefertigt hatte. Die auf diesen Zeichnungen beruhenden Bilder wurden dann von Weigel gestochen.
• Weigel hat die Bilder des Ständebuchs, ergänzt um 72 weitere, hier nicht abgedruckte, sodann in dem in seinem Verlag 1699 bis 1711 gedruckten Werk «Etwas für Alle» von Abraham a Sancta Clara verwendet. (Nur der Text des ersten der drei Bände wurde von Abraham verfasst.) Er hat gewissermaßen auf Vorrat gearbeitet.
Maße der Kupfer: Bilder 8 x 8,8 cm, Platte 9 x 13,2 cm.
Einige Beispiele
Der Tantzmeister (VII,3)

Das Bild mit dem Tänzer in graziler Positur ist signiert C.L., ist also von Caspar Luyken geschaffen. Das Motto mischt dem Charme gleich die Moral bei: Es schwebt auff leichtem Fuß der Eitelkeit Genuß. Und das Epigramm führt das allegorisch weiter aus: Man solle nicht nach den Saiten der Welt (man beachte die Musikanten im Hintergrund) tanzen, weil leicht ein Capriol geschicht, vom Wollust-Himmel zu der Höllen. Capriole ist doppeldeutig: einerseits eine Sprung-Pose aus dem Ballett, anderseits die Redensart für ›übermütig, närrisch sein‹.
Der Tanz ist nach Ansicht der Alten den Bewegungen der Himmelskörper abgeschaut. Die heidnischen Götter stellte man sich in der Antike als Tänzer vor. Ein berühmter Tänzer ist David, der vor der Bundeslade tanzte (2. Samuel 6,5). Bei den heidnischen Opfern war der Tanz eine übliche Zeremonie, und ist so noch bei den Indianern üblich. Usw. An Tanzformen werden genannt: die Laconische/ Troexenische/ Epiriphyrische/ Cretensische/ Ionische/ Gaditansiche – lauter Benennungen der alten Scribenten; uns Heutigen bekannte Tanzformen (z. Bsp.: Chaconne, Passacaglia, Allemande, Courante, Sarabande, Gigue) zu erwarten wäre ahistorisch; das entsprechende Buch von Raoul Auger Feuillet, »Recüeil de contredances mises en chorégraphie« erscheint erst 1706, und Gottfried Tauberts ebenfalls mit Figuren der Schrittfolgen ausgestattetes Buch »Rechtschaffener Tantzmeister« 1717. – Weigel spricht dagegen eher physiotherapeutisch von der Nutzbarkeit des Tantzens: Sie bestehe darin, dass dadurch der Cörper geschickt/ fertig und manierlich werde/ anbey auch einige Stärcke überkomme/ am meisten aber wegen der herrlichen Bewegungen zur Gesundheit beförderlich sey.
Der Windenmacher (XIV,2)

Das Bild (hier eindeutig ein Kupferstich im engeren Sinne) ist ein Beispiel für die Präzision der Vorzeichnungen von Christoph Eimmart, der die Einzelstudien dann zu einer Komposition zusammengefügt hat.
So unordentlich lagen die Feilen und Produkte wie Zahnräder, Klemmvorrichtungen u.a.m. natürlich nicht herum! Hergestellt wurden vom Windenmacher Heb-Zeuge und (im Vordergrund sichtbar) Pressen für Druckereien, Apotheken, Knopf-Fabrikanten.
Die Moral wird aus der Symbolik der vom Werkzeug (Winde) gehobenen Last abgeleitet: Die Ungeduld mehrt, was schwer ist durch schwere Sünde […] Es hebt allein nur diese Last | der Andacht starcke Seüffzer-Winde.
Der Zahnarzt (V,8)

In der fünften Abteilung sind die Medizinalberufe dargestellt: Der Medicus, Apothecker, Materialist [Gewürzkrämer], Wundarzt, Barbierer, Bader, Oculist, Zahn-Arzt.
Motto: Sünde will nicht scheiden, ohne Schmertz u. Leiden.
Die böse Lust hängt wie ein Zahn
sich in den Ader-Würtzeln an,
und machet im Gewissen Schmertzen.
Heraus mit ihr, sonst wächst die Pein.
Das Fleisch muß uns gekreutzigt seyn,
so wohnet Fried und Ruh im Hertzen.
In der Antike gab es bei den Griechen Odontoglypha, welche die Überbleibsel der Speisen zwischen den Zähnen entfernten, um so den übelriechenden Atem zu vermeiden. Die Zahnstocher habe man aus dem Holz des Mastix-Baums oder aus Silber verfertigt. Ferner wurden die Zähne gereinigt, wozu man gewisse Zahn-Pulver ersonnen habe, aus Hirschhorn-Asche, Mastix und Salmiak. Sodann verletzen Unfälle und Seuchen die Zähne, was zu Schmerzen führt, wogegen die Zahnärzte Mittel kennen. Beim Ausreißen eines Zahns durch einen Unerfahrenen können indessen üble Folgen resultieren. Jetzt werden die Erstaunen-eregenden Instrumente beschrieben, zuerst mit den antiken Begriffen, dann zu Teutsch Geißfuß/ Pelican/ etc., ferner schmerzstillende Mittel. Weil die zerbrochene Reyhe der Zähne/ bey Öffnung des Munds/ keine geringe Unförmlichkeit zeiget, hat man schon im Altertum elfenbeinernen Ersatz eingefügt.
Man fragt sich immer wieder, woher die unzähligen gebildeten Anspielungen im Text (dessen Autor nicht genannt wird) kommen. So wird beispielsweise (hier S. 149) Martial (Epigramm II,41) zitiert, wo die Buhlerin Maximina – keine puella, sondern ein altes Weib – aufgefordert wird, nicht mit einem Lächeln zu flirten, da sie nur noch drei pechschwarze und gelbliche Zähne (dentes plane piceique buxeique) aufweise. Man vermutet eine Enzyklopädie im Hintergrund. In Johann Jacob Hofmanns »Lexicon Universale« (1677) beispielsweise gibt es einen Artikel Dens, der mit diesem Martial-Zitat beginnt. Wegen der oft zitierten Martial-Stellen könnte man auch vermuten, dass hier die Enzyklopädie »Cornucopiae« (1489 und Neuauflagen) von Niccolò Perotti Zulieferer gewesen ist, die auf Martial beruht.
Der Bürstenbinder (XXI,10)

Hier wird nicht die handwerkliche Verrichtung gezeigt, sondern die Auslage der Produkte am Laden. Siebzehn Bürstenarten sind ausgestellt, die der Verkäufer anpreist. Die Frau probiert den Strich einer Bürste an ihrem Gewand aus. Im Hintergrund eine Stadtvedute. Das Bild stammt aus dem Buch von C. Luyken und ist für seine Darstellungsweise typisch (Nr. 8: De Schuyermaaker). Die Moral: Kehrt ab das Sünd-bestaubte Hertz, | das ihr in eurem Busen traget.
Der Uhrmacher (XI,7)

Das Lemma Seid bereit weil [solange als] es ist Zeit wird im Motto ausgeführt:
Last uns die güldne Stunden kauffen [ausnützen],
weil noch das Lebens-Uhrwerck geht,
eh die Gewigter schnell ablauffen,
und der bezirkte [im Kreis herumumgehende] Zeiger steht;
dann an dem letzten Blick der Zeit [kurze Zeitspanne]
hängt Wol und Weh der Ewigkeit.
Im Epigramm wird Bezug genommen auf die Gewichte, die an Ketten das Uhrwerk einer Standuhr antreiben – hinten an der Wand ist so eine Uhr zu sehen. In früheren Emblemen wurde das auch anders gedeutet: In Johann Arndts «Büchern vom Wahren Christenthum» (die Embleme seit 1678; 2. Buch, 47. Kapitel) bezieht sich das Motto: Die Last machts leicht. darauf, dass die schweren Gewichte das Uhrwerk zum Laufen bringen, so wie von Gott auferlegte Bürden den Menschen nur ermuntern. Und in den «Emblemata Politica» von Petrus Isselburg und Georg Rem (1617; Nr. 18) lautet das Motto Ubi onus, ibi sonus, d.h.: die Glocke läutet nur, wenn das Gewicht an der Kette zieht.
Der Artikel selbst befasst sich in historischer Perspektive zunächst mit den verschiedenen Einteilungen des Tages in gleich lange Tage und Nächte, der Einteilung in Stunden; mit der Frage, wann man den kalendarischen Tag beginnen lässt. Dazwischen kurz auch etwas Lokalkolorit: In Nürnberg werden die Stundenviertel auf vier Türmen ausgerufen. – Dann der technische Aspekt: Die Sonnenuhren soll nach Plinius Bericht Anaximenes erfunden haben (stimmt! Naturalis Historia II,78,187). Und bei den Sonnenuhren darf das Wunder nicht ungenannt bleiben, wo der HErr den Schatten der Sonnenuhr rückwärts gehen lässt, um König Hiskia anzudeuten, dass er gesund werde (2. Könige 20,11). Beschrieben wird die geniale Erfindung einer Wasseruhr, die nach dem Ablauf des Wassers einen Zeiger bewegt. Und schließlich die mechanische Räderuhr. Sollte ich von ein und andern herrlichen und künstlichen Uhr-Werken in Deutschland/ ich will nicht sagen in Europa/ Meldung thun wollen/ wie viel Zeit und Papier würde ich wol hierzu nöthig haben? Es folgen aber noch vier Seiten...
Anhang
Die Geschichte der Berufsenzyklopädien auszuführen würde zu weit führen. Aber dies sei erwähnt:
Im Werk von Polydorus Vergilius (ca. 1470–1555) «De Inventoribus Rerum» enthalten die ersten drei Bücher Kapitel zu Künsten und Handwerken (Poetik, Geometrie, Wundarznei, Schauspiele, Schmiedekunst, Haffner, Architektur, Zimmermannshandwerk usw.). Die deutsche Übersetzung «Von den erfyndern der dingen» (Augspurg: Heynrich Steyner 1537) enthält unter anderen Holzschnitte aus Petrarcas Glücksbuch (1532). Vgl. dazu: Librarium 2019/I, S. 26–39.
Ein bekannter Vorgänger ist das Buch «Eygentliche Beschreibung aller Stände auff Erden, hoher vnd nidriger, geistlicher vnd weltlicher, aller Künsten, Handwercken vnd Händeln &c.», Franckfurt am Mayn: bey Georg Raben, in Verlegung Sigmund Feyerabents, 1568. Das Buch ist ebenfalls ständisch geordnet vom Bapst bis zu den Narren. Schon hier sind den 114 Holzschnitten von Jost Amman moralisierende Verse von Hans Sachs beigegeben.
Hier der entsprechende Holzschnitt (6 x 7,8 cm) zum Zanbrecher:

Weigel gesteht im Vorwort, dass er sich nicht wenig bedient habe im 153 Kapitel umfassenden Buch von Tommaso Garzoni: «Piazza Universale. Das ist: Allgemeiner Schauplatz, Marckt und Zusammenkunfft aller Professionen, Künsten, Geschäfften, Händeln und Handwercken, […]», dessen letzte Ausgabe 1659 in Franckfurt im Verlag Matthæi Merians Sel. Erben erschien. Dieses Buch ist ausgestattet mit den Holzschnitten von Jost Amman aus dem Druck von 1568.
Der Onkel von Christoph Weigel, Erhard Weigel, hat 1672 eine «Vorstellung Der Kunst- und Handwercke» verfasst. Das Buch enthält nur zwei Kupferstiche und keine Embleme.
Später: Die elf Bände Planches der «Encyclopédie» (1762–1772) enthalten präzise Kupferstiche mit Ansichten der Werkstätten, der Werkzeuge und der Produkte; die Legenden verweisen mit ins Bild inserierten Buchstaben auf Details. Hier fehlen selbstverständlich die moralinsauren Auslegungen.
Literaturhinweise:
Digitalisat des Ständebuchs von Weigel:
http://digital.slub-dresden.de/ppn28062171X
Faksimile des Ständebuchs von Weigel, hg. von Michael Bauer, Verlag Dr. A. Uhl, Nördlingen 1987. – Im Anhang sind die 72 nicht ins «Ständebuch» aufgenommenen Kupferstiche reproduziert, die dann in den Werken von Abraham a Sancta Clara erscheinen.
Michael Bauer, Christoph Weigel (1654–1725), Kupferstecher und Kunsthändler in Augsburg und Nürnberg, in: Archiv für Geschichte des Buchwesens, Band 23 (1982), Sp. 693–1186.
Jan Luyken, Die Skizzen zum Ständebuch. Hundert Vorzeichnungen…, hg. von Margarete Wagner / Michiel Jonker, Freiburg / Br.: Herder 1987.
Reinhold Reith, Lexikon des alten Handwerks. Vom Spätmittelalter bis ins 20. Jahrhundert, München: Beck 1990.
Paul Michel, Zürich
Edward Bizub, Borges en dédale, Genève, Métis Presses, 2020.
Von allen Städten dieser Welt, von allen ureigenen Vaterländern, die ein Mensch sich im Lauf seiner Reisen zu verdienen versucht, erscheint mir Genf als die Stadt, die dem Glück am nächsten kommt. Diese Inschrift findet sich auf einem Gebäude der Grand Rue in der Altstadt von Genf, vor dem immer wieder andächtig Touristen aus Südamerika stehen bleiben, die in der Rhone-Stadt auf Spurensuche nach dem argentinischen Schriftsteller Jorge Luis Borges (1899-1986) unterwegs sind.
Ausgangspunkt dieser Reise durch Leben und Werk des argentinischen Klassikers ist ein Spaziergang über die Insel San Giorgio Maggiore in Venedig, deren gleichnamige Abtei den Blick freigibt auf ein seltsames Labyrinth, in dessen Zentrum der Name B-O-R-G-E-S auftaucht. Es ist eine Hommage der Fondazione Cini, die dem Buch den Titel verleiht. Auf 224 Seiten wird das Leben eines Dichters rekonstruiert, der zwischen zwei Kontinenten und ihren Kulturen unterwegs war. Geboren in Buenos Aires als Sohn einer anglo-argentinischen Familie der Oberschicht verbrachte «Georgie», wie sein Spitzname lautete, seine Jugend in der väterlichen Bibliothek, die fast nur aus englischen Büchern bestand. Gleichzeitig macht die Mutter, Leonor Acevedo, den schüchternen Jungen mit den militärischen Heldentaten seiner spanisch-kreolischen Vorfahren vertraut, die im Kampf gegen die spanische Kolonialmacht gekämpft haben. Eine Europareise gehört für die Angehörigen der argentinischen Oligarchie zum Prestigeprogramm. Die Wahl fällt auf Genf, nicht etwa Paris, wo die Familie die Zeit des Ersten Weltkriegs verbringt und Jorge Luis das von Calvin begründete Collège de Genève besuchen und seine liebe Not mir der französischen Sprache haben wird. Doch die Jahre in Genf (1914-1918) werden ihn entscheidend prägen. Borges lernt deutsch und liest Arthur Schopenhauer, Carl Gustav Jung und Franz Kafka, den er Jahre später ins Spanische übersetzen wird. Das Buch von Edward Bizub rekonstruiert diese Lektüren mit Hilfe der Archive der Bibliothèque municipale und diverser autobiografischer Notizen. Einen unauslöschlichen Eindruck hat dabei Die Welt als Wille und Vorstellung hinterlassen, schreibt Borges doch (1970): «Als ich in der Schweiz war, begann ich eines Tages, Schopenhauer zu lesen. Wenn ich mir heute einen einzigen Philosophen auswählen müsste, so würde meine Wahl auf ihn fallen».

Jorge Luis Borges im Hôtel de Beaux-Arts (Paris, 1969).
In seiner autobiografischen Erzählung «Der Andere» (1975) schildert der alternde Borges eine Begegnung am Ufer des Hudson River mit seinem jugendlichen Alter Ego, der vorgibt, am Ufer der Rhone in Genf zu sitzen und noch das ganze Leben vor sich zu haben. Der alte und der junge Borges unterhalten sich eine Weile, um sich schliesslich davon zu überzeugen, dass sie ein und dieselbe Person sind. Borges en dédale ist eine geglückte Synthese des argentinischen Klassikers zwischen Genf und Buenos Aires, Europa und Amerika.
Albert von Brunn
Bibliografie:
Balderston, Daniel, Borges: una enciclopedia. Buenos Aires: Grupo Editorial Norma, 1999.
Rogers, Sarah, Borges and Kafka: sons and writers. Oxford: Oxford University Press, 2017.
Borges, Jorge Luis, Spiegel und Maske: Erzählungen 1979-1983. Übersetzt von Curt Meyer-Clason. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag, 2003 (Werke; 13).
Schwartz, Jorge, Borges babilônico. São Paulo: Companhia das Letras, 2017.
Lebenserinnerungen von Alexander Tschirch (1856–1939)
Der Historischen Bibliothek der Schweizerischen Pharmazie (HBSP) ist es eine grosse Freude, der Schweizerischen Bibliophilen-Gesellschaft zu ihrem 100-jährigen Bestehen gratulieren zu dürfen. Was eignet sich dazu besser, als das Vorstellen eines Buches, das just in dem Jahr der Gründung der Schweizerischen Bibliophilen-Gesellschaft erschienen ist? Das Buch stammt aus der Feder eines der Gründerväter unserer Bibliothek, der darin einen Teil seines spannenden Lebens beschreibt. Es ermöglicht damit auch einen Blick auf den Alltag der Menschen und die Gesellschaft, die einen Menschen prägten, der die Anfangszeit der Schweizerischen Bibliophilen-Gesellschaft miterlebte.

Abb. 1: Goldprägung auf dem Buchdeckel.

Abb. 2: Goldprägung auf dem Buchrücken.
Wilhelm Oswald Alexander Tschirch wurde als Sohn des Stadtpfarrers Adolf Tschirch in Guben (Deutschland) geboren. Auf Anraten seines Onkels, des berühmten Apothekers und Chemikers Otto Ziurek (1821–1886), begann er eine Apothekerlehre mit dem Ziel, ebenfalls Chemiker zu werden. Im Oktober 1878 immatrikulierte er sich an der Berliner Universität, wo insbesondere sein botanisches Interesse geweckt wurde und er 1880 das pharmazeutische Examen bestand. Nach mehreren Zwischenstationen übersiedelte er 1890 nach Bern, wo er die Pharmakognosie sowie die pharmazeutische und gerichtliche Chemie vertrat. Über 20 Bücher und 400 Zeitschriftenaufsätze zeugen von seiner regen Forschertätigkeit.

Abb. 3: Foto von Tschirch, um 1921, von Fotograf Henn in Bern.
"[...] ich frage mich, ob die Allgemeinheit ein Interesse an meinem 'Lebensläufli' haben werde, das in den folgenden Blättern erzählt wird. Aber ich bin allmählich in ein Alter gekommen, in dem man gern zurückschaut und die Erinnerung, die Jean Paul 'das einzige Paradies nennt, woraus wir nicht vertrieben werden können', einen immer breiteren Raum in meinem Sinnen und Denken einnehmen. Und da finde ich denn: das meinige war doch ein recht merkwürdiges 'Lebensläufli', das mich mit vielen interessanten Menschen in Berührung brachte und nach gar vielen Gegenden dieser Erde führte."
Mit diesen Worten erklärt Alexander Tschirch im Vorwort, wieso er seine Biografie der Allgemeinheit zur Verfügung stellen möchte. Und in der Tat, das Werk ist auf jeden Fall sehr spannend, sehr informativ und unterhaltsam geschrieben. Zudem enthält es viel kulturgeschichtliches Material.

Abb. 4: Beginn der Biografie mit schön verzierter Initiale.
Die Beschreibung seiner Lehrzeit bei seinem Vetter in Loschwitz (Dresden) liefert viele spannende Eindrücke in die Lebensumstände der damaligen Zeit. Es lässt auch erkennen, wie anstrengend und zeitintensiv die Arbeit als Apotheker war. Die Apothekerlehrlinge lebten in einem Haushalt zusammen mit dem Lehrmeister. Über seinen ersten Abend in dieser für ihn neuen Hausgemeinschaft schreibt Tschirch:
"Einen Begriff von dem ruhelosen Dasein in der Apotheke bekam ich schon am ersten Abend. Denn gar oft ging die Klingel der Apothekentür nebenan, und immer sprang dann mein Vetter auf, um durch die Glastür in die Apotheke zu eilen, die Kunden zu bedienen. Oft blieb er auch selbst während des Abendessens längere Zeit fort, besonders wenn ein Rezept gekommen war. Dieser erste Abend war der letzte, an dem ich mein Abendessen in Ruhe verzehrte." (S. 4)
Gelernt wurde noch bei Kerzenschein:
"In diesem sogenannten Zimmer habe ich drei Jahre lang gehaust, habe dort nach dem manchmal ziemlich anstrengenden Dienste noch ein Viertelstündchen bei einer Kerze gelesen, oder in mein Tagebuch geschrieben – eine Lampe war mir nicht bewilligt worden – und habe in dem Bette auf meinen eigenen, von Guben mitgebrachten Kopfkissen stets ausgezeichnet geschlafen." (S. 5)
Und Freizeit war ein kostbares Gut:
"Mein armer Chef war nicht minder eingesperrt in die Apotheke wie ich, ja eigentlich noch viel mehr. Denn ich hatte doch wenigstens alle 14 Tage einen Sonntag frei. Er aber musste sich einen Vertreter besorgen, wenn er einmal fort wollte." (S. 11)
Einmal wagte es der Chef für eine halbe Stunde, den Lehrling alleine zu lassen, das endete jedoch nicht gut. Genau in dieser Zeit kam die Magd einer Familie und verlangte Beifuss für den Gänsebraten, was den jungen Tschirch nach erst sechs Wochen Lehrzeit überforderte:
"Beifuss, Beifuss – das war doch eine Artemisia? So viel hatte ich schon gelernt. Also wo waren die Kästen mit Herba artemisia – aha! hier waren sie. Herba artemisiae vulgaris, nein, das klang nicht sehr gut! Herba artemisiae absynthium, das sieht schon besser aus. – Na, geben wir das letztere. – Mündel kam zurück. Wir setzten uns zu Tisch. Auf einmal geht die Klingel, energischer wie sonst, schien mir. Wir stürzen heraus und prallen an den unglücklichen Besitzer der mit Herba absynthii gefüllten Gans. 'Was haben sie mir gegeben? Die Gans schmeckt nach Strychnin. Sie ist nicht zu geniessen. Ich werde Sie anzeigen und verlange Schadenersatz.' " (S. 11)
In der an die Apothekerlehre anschliessende Konditionszeit in verschiedenen Apotheken wanderte Tschirch oft und gerne. Bei einer Wanderung sah er die Alpen in der Ferne, was in ihm den Wunsch weckte, die Schweizer Berge besser kennenzulernen. Er durchsuchte den Inseratenteil der "Pharmaceutischen Zeitung" und fand eine Stelle in der Staatsapotheke (Abb. 5) in Bern ausgeschrieben, die er annahm:
"Ich nahm die Stelle in der Staatsapotheke in Bern an, und Ende September 1877 ging es über Basel und den Rheinfall zunächst nach Zürich und auf einem Umwege über die Rigi (Rigi ist wie alles Schöne weiblich!), nach Luzern und Bern." (S. 113)

Abb. 5: Oben das Gebäude der alten 1912 abgerissenen Staatsapotheke in Bern (Foto Oesterle), unten Bern um 1877.
Nach weiteren Zwischenstationen, ausgedehnten Studienreisen und der Heirat mit Elisa Ziurek kehrte Tschirch nach Bern zurück. Tschirchs "Lebensläufli" endet mit dem Umzug nach Bern, wo er 1890 die Stelle als Leiter des neu geschaffenen Pharmazeutischen Instituts antrat.

Abb. 6: Schlussvignette, Prof. F. A. Flückiger, nach einer Handzeichnung.
Als Schlussvignette (Abb. 6) wählte Tschirch eine Abbildung von Friedrich August Flückiger (1828–1894), der 1859 seine Arbeit als Staatsapotheker in Bern begann und 1870 zum ausserordentlichen Professor für Pharmazie an der Universität Bern ernannt wurde. Es ist der herausragenden Leistung Flückigers zu verdanken, dass die Pharmazie als universitäres Fach in Bern institutionalisiert wurde. Flückiger und Tschirch gaben zusammen die 2., überarbeitete Ausgabe der "Grundlagen der Pharmacognosie" von Flückiger heraus.
Die Geschichte unserer Bibliothek (HBSP) wurde stark von Flückiger und Tschirch geprägt und ist eng mit dem akademischen Unterricht in Bern verbunden. Flückiger und Tschirch waren beide stark wissenschaftlich und kulturell interessiert, weitgereist, Pharmaziehistoriker und Büchersammler. Viele der von ihnen erworbenen Werke befinden sich heute noch in unserer Bibliothek.
Weitere spannende Einblicke in Tschirchs Leben – auch nach dem Umzug nach Bern – liefern Briefe, die er mit einer guten Freundin austauschte, die in Triest lebte ("Es ist die Martha-Seele, die meiner Seele vermählt ist". Die Briefe von Alexander Tschirch an Martha Bernoulli 1896–1939).
Literatur:
Ledermann, François (Hrsg.): Schweizer Apotheker-Biographie. Festschrift zum 150jährigen Bestehen des Schweizerischen Apothekervereins. Bern 1993 (Veröffentlichungen der Schweizerischen Gesellschaft für Geschichte der Pharmazie; 12).
Ledermann, François: "Es ist die Martha-Seele, die meiner Seele vermählt ist". Die Briefe von Alexander Tschirch an Martha Bernoulli 1896–1939. Stuttgart 2015 (Veröffentlichungen zur Pharmaziegeschichte; 13).
Zulliger, H.: Lebenserinnerungen von Professor A. Tschirch, Bern. In: Die Berner Woche in Wort und Bild. Ein Blatt für heimatliche Art und Kunst 13 (1923), S. 278–280.
Ledermann, Ruppen, Burkhalter: Von Büchern und Menschen. Des livres et des hommes. Bern 2021.
Sara Ruppen, Baar
Tschirch, Alexander: Erlebtes und Erstrebtes. Lebenserinnerungen. Mit einem Titelbild, 14 Tafeln und 4 Bildern im Text. Erschienen 1921 im Verlag von Friedrich Cohen in Bonn.
Thomas More, Libellus de nova Insula Utopia, Louvain, Thierry Martin, 1516
La destinée de Thomas More (1478-1535), brillant esprit humaniste au service du roi d’Angleterre Henri VIII, connaît une issue tragique. En 1530, More (catholique, opposé au divorce) devient le nouveau lord chancelier et conseiller du roi alors que celui-ci se plaint de ne pas obtenir le divorce avec son épouse Catherine d’Aragon (le roi veut épouser Anne Boleyn). Lecteur d’Érasme, More est partisan de rester dans l’Église catholique et refuse le schisme. Henri VIII qui cherche un ecclésiastique favorable au divorce, le discrédite au profit de Cranmer, archevêque de Canterbury. En 1532, Henri VIII et Anne se marient. Hostile à une église anglicane indépendante de Rome, More démissionne et Henri VIII (excommunié par le pape) devient chef suprême de la nouvelle Église. More, hostile à ces désordres conjugaux-confessionnels, est condamné pour trahison et décapité le 6 juillet 1535 sur l’ordre de Henri VIII devant la tour de Londres.

L’ouvrage le plus célèbre de l’humaniste Thomas More est un canular rédigé en latin inspiré par les Histoires véritables (antiphrase !) de Lucien de Samosate reprenant de façon mi-sérieuse mi-moqueuse les dialogues de philosophie politique de Platon consacrés au « meilleur gouvernement » (République, Politique, Lois), dans le goût satirique d’Érasme. More décrit un régime républicain idéal découvert par des voyageurs sur l’île de… nulle part. D’abord nommée Nusquam, l’île est finalement appelée Utopie (« ou-topos », οὐ-τοπος, non-lieu). Un jeu de mots est remarquable du fait de la proximité phonique (paronomase) entre les termes grecs utopia et eutopia – ce dernier désignant « ce qui est bon ». More suggère qu’il s’agit aussi du lieu du « bien politique », de l’harmonie morale et du bonheur communautaire.
En 1516, More est âgé de trente-huit ans. Dans le récit, les voyageurs découvrent que les habitants d’Utopie vivent heureux grâce au gouvernement communautaire idéal. Le contraste est saisissant entre l’ordre, la concorde et l’harmonie présentés et les situations particulières éparpillées caractérisant le chaos européen dans la réalité historique. Utopie invente le genre des modèles politico-sociaux chimériques. Le Libellus vere aureus nec minus salutaris quam festivus de optimo reipublicae statu, deque nova Insula Utopia paraît une première fois en décembre 1516, à Louvain, confié par l’ami néerlandais de l’auteur, l’humaniste Érasme, à l’imprimeur humaniste Thierry Martin. Entre décembre 1516 et novembre 1518, quatre éditions de l'Utopie furent composées par Érasme et More. Ces quatre éditions sont toutes différentes. La quatrième (la dernière validée par More et Érasme de leur vivant, nov. 1518), dont l'impression fut suivie par Beatus Rhenanus auprès de l'imprimeur Johann Froben à Bâle, est considérée comme la version définitive. L’editio princeps est rarissime et l’exemplaire de la Fondation Martin Bodmer est remarquable. L’ouvrage, qui ne porte pas de date, a été imprimé à Louvain en décembre 1516 par Thierry Martins. Celui-ci (1446/7-1534 ; son nom non francisé est Dirk Martens), fut le premier imprimeur des Pays-Bas du sud. Il s’est formé à Trévise puis travaille dans son propre atelier successivement installé à Alost (1473-1492), à Anvers (1492-1497 et 1502-1512) et surtout à Louvain (1498-1501 et 1512-1529). Son coup d’essai coup de maître fut une édition de Denis le Chartreux, confesseur de Philippe le Bel, premier livre jamais réalisé avec des lettre métalliques mobiles réutilisables (1473). Sur l’exemplaire de l’Utopie, la grande marque de « Thierry Martins » occupe le dernier feuillet. Mesurant 19,8x13,5 cm, l’exemplaire est à grandes marges. Au verso du titre se trouve un grand bois pleine page. Dans l’édition princeps se trouve en effet une carte géographique qui est probablement d’un disciple d’Érasme de Nimègue, le peintre graveur humaniste et théologien Gerhard Geldenhauer (1482-1542). Souvent soustraite et manquante, parfois coloriée, elle représente l’île, « Utopiae Insulae figura ». En vis-à-vis, le recto qui suit le feuillet-titre comporte quant à lui le (tout fictif) « alphabet utopien ». L’ouvrage est composé de 54 feuillets non paginés par des chiffres. La reliure est en velin souple du XVe siècle.
Bibliographie
Renaud Adam, Alexandre Vanautgaerden, Thierry Martens et la figure de l'imprimeur humaniste : une nouvelle biographie, Turnhout, Brepols, 2009.
Jacques Berchtold, « Regards sur l’utopie », in Regards sur l'utopie, dir. J. Berchtold, Europe, année 89, no 985, 2011, p. 3-15.
Jacques Berchtold, Cologny
Das Behältnis der «Poets of Great Britain»
Vor bald zwei Jahren hat Alex Rübel auf dieser Seite den Katalog «Scheinbücher. Die Kunst der bibliophilen Täuschung. Die Sammlung Armin Müller Winterthur» (Benteli, 2020) besprochen (Rezensionen, Dez. 2020).
Eine Art von Scheinbuch ist in Müllers grosser Sammlung nur mit wenigen Beispielen vertreten: die Buchattrappe, die richtige Bücher enthält. Ein gewichtiges Beispiel dieser Sorte sind die Holzkisten in Form von zwei aufeinanderliegenden, verschieden dicken Folianten, die der Londoner Druckerverleger, Buchhändler, Leihbibliothekar und Schriftgiesser John Bell (1745–1831) zur Aufbewahrung und zum Transport seiner Edition «The Poets of Great Britain complete from Chaucer to Churchill», erschienen zwischen 1777 und 1787, anbot.

Abb. 1.
Die vollständige Reihe der «Poets of Great Britain» findet sich u. a. in der Stadtbibliothek Schaffhausen – samt den beiden der Aufbewahrung der 109 Bändchen dienenden Kisten (Signatur G*5, Abb. 1). Die Behältnisse im Format 44 x 33 x 11 Zentimeter sind (oder waren anfänglich) mit Leder bezogen. Auf dem Rücken der «Folianten» sind fünf Bünde angedeutet, auf dem Schild steht «Bell’s Edition British Poets». Aufgeklebtes Marmorpapier täuscht eingefärbte Schnitte vor. Das unterteilte Innere (Abb. 2) ist mit einem anderen Marmorpapier und im Deckel mit grünem Samt ausgekleidet.

Abb. 2.
Auf der Innenseite der einen Kiste ist ein Prospekt angebracht (Abb. 3). Darin werden die Behältnisse angepriesen als «[…] adapted for travelling, in the seat of a post-chaise, or for cabinet furniture». Gekostet haben dürften sie eine Guinee pro Stück, wie die weiter unten angebotene, ebenfalls foliantförmige Kiste zur Aufbewahrung der 21-bändigen Reihe «Bell’s British Theatre». Der Wert der Guinee, einer Goldmünze, entsprach 1 Pfund 1 Schilling. Die komplette Serie kostete je nach Ausstattung zwischen 8 Pfund 8 Schilling und 16 Pfund 16 Schilling.

Abb. 3.
Während die aus älteren Ausgaben übernommenen Texte philologisch offenbar nicht über jeden Zweifel erhaben sind,[1] sind die Bändchen vom Format 13 x 8,5 Zentimeter, insbesondere in der hier vorliegenden Ausführung in Leder, sehr hübsch anzusehen (Abb. 4).

Abb. 4.
Die Vorsätze weisen die gleiche Marmorierung auf wie das Innere der Kisten. Alle Bändchen enthalten einen vorgebundenen Kupfertitel auf festerem Papier (Abb. 5), manche zudem ein Autorenporträt. Bell «influenced later publishing practice by introducing into his books illustrations prepared by competent artists and related to the text».[2]

Abb. 5: Vorgebundener Kupfertitel zu Wentworth Dillon, Earl of Roscommon, The Poetical Works, [für John Bell gedruckt in] Edinburgh 1780 (The Poets of Great Britain complete from Chaucer to Churchill, Band 43). Entworfen wurde der Kupfertitel von Thomas Stothard (1755–1834), gestochen von Jean-Marie Delattre (1745–1840).
Der Frage, wie viele Exemplare der vollständigen Reihe samt Behältnissen sich erhalten haben, konnte nicht nachgegangen werden. Eines findet sich in den Special Collections des renommierten Amherst College (Massachusetts),[3] ein anderes ist derzeit für 12'500 Dollars beim New Yorker Antiquar James Cummins zu haben, «a rather rare and interesting survival».[4]

Abb. 6.
Laut dem auf dem Innendeckel angebrachten Exlibris (Abb. 6) stammt das Schaffhauser Exemplar aus der Bibliothek des Theologen und Pädagogen Johann Georg Müller (1759–1819), was jedoch nicht ganz richtig ist: «The Poets of Great Britain» sind bereits im handgeschriebenen Bandkatalog von 1812 – Müller stand damals selber der 1636 gegründeten Bürgerbibliothek vor – summarisch als «Bell Collection» verzeichnet. Die Edition stammt letztlich aus dem Besitz von Müllers älterem Bruder, dem Historiker und politischen Publizisten Johannes von Müller (1752–1809), dessen Privatbibliothek nach seinem Tod von der Stadt Schaffhausen erworben und in die Bürgerbibliothek integriert wurde.
Johannes erwähnt die Edition in einem Brief an den Bruder aus Mainz vom 25. Februar 1788, als Geschenk seines Londoner Freundes Thomas Boone Jr. (1768–1798).[5] Dieser hatte das Präsent am 3. Januar desselben Jahres angekündigt: «I have a trifling present which I mean immediately to send you and which I desire you will accept as a feeble mark of my Esteem and friendship, it is Bell’s Edition of the English Poets which I hope will meet with your approbation and be in some respect a Recreation and allay from hard study and Business».[6]
Die Abnutzung des Lederbezugs zeugt davon, dass die Kisten weit gereist sind. Johannes von Müller übersiedelte 1792 von Mainz nach Wien, 1804 von dort nach Berlin, 1807 schliesslich nach Kassel, wo er zwei Jahre später starb und seine letzte Ruhestätte fand. So abgenutzt die beiden Kisten von Müllers ständigen Umzügen sind: Die 109 Bändchen machen nicht den Eindruck, intensiv gelesen worden zu sein, weder vom grosszügig beschenkten Erstbesitzer, noch von seinem Bruder und Nachlassverwalter. Ausser handschriftlichen Besitzvermerken «Bibliothecae civium Scaphusianorum» sowie Stempeln und Signaturschildern des 20. Jahrhunderts weisen sie keine Spuren von Benutzung auf – Grund genug, sich mit der Edition näher zu befassen, wenn auch fürs erste nur mit dem Scheinbuch-Behältnis.
Für Hilfe bei den Recherchen danke ich Oliver Thiele, Stadtbibliothekar, Schaffhausen; die Aufnahmen machte der Fotograf Jürg Fausch, 372dpi GmbH, Schaffhausen.
René Specht, Schaffhausen
[1] Thomas F. Bonnell, John Bell’s «Poets of Great Britain». The «Little Trifling Edition» Revisited, in Modern Philology 85 (1987), S. 128–152; ders., The Most Disreputable Trade: Publishing the Classics of English Poetry, 1765–1810, Oxford 2008.
[2] Encyclopædia Britannica.
[3] Mike Kelly, British Poetry in a Box [Blog] https://consecratedeminence.wordpress.com/2012/07/13/british-poetry-in-a-box/ (Zugriff 23. September 2021).
[4] https://www.jamescumminsbookseller.com/pages/books/264104/travelling-library/bells-edition-of-the-poets-of-great-britain-complete-from-chaucer-to-churchill (Zugriff 23. September 2021).
[5] Johannes von Müller, Johann Georg Müller, Briefwechsel und Familienbriefe, hrsg. von André Weibel, Göttingen 2009–2011, Bd. 3, S. 266, Bd. 5, S. 382–383.
[6] Thomas Boone Jr. an Johannes von Müller, 3. Januar 1788, Stadtbibliothek Schaffhausen, Msc. Müll. 81/51.
In Basel entstand bekanntlich nicht nur die erste Gärtnerzunft, sondern – was indes eher unbekannt ist – auch das älteste gedruckte Gartenbuch:
Ein nüwes/ fast hüpsch/ vnd nutzliches Pflantzbuochlin/ Von mancherley artiger Pflantzunge[n]/ Jmpffu[n]g vnd Beltzung der böum
Es nennt sich Pflanzbüchlein und ist – wie sich aus dem Diminutiv und dem Umfang (lediglich 26 ungezählte Oktavblätter einschliesslich eines erbaulichen Vorworts) ergibt – eine kurze Anleitung über den Obstbau: Laut dem „Untertitel“ werden das Pflanzen, Impfen und Belzen, das heisst die Anpflanzung, Pflege und Veredelung von Obstbäumen behandelt.
Dieses praktische Gartenbuch des 16. Jahrhunderts erfuhr eine derartige Beliebtheit und Popularität, dass es bis ins 18. Jahrhundert an verschiedenen Druckorten aufgelegt wurde.

Titelseite der Basler Erstausgabe: Zentralbibliothek Zürich, 18.1991. Den Titelholzschnitt von Niklaus Manuel (?) verwendete Adam Petri bereits 1521 für den Karsthans-Nachdruck (VD16 K 132).
Die vorliegende, anonym verfasste Ausgabe ist weder firmiert noch datiert. Gemäss dem Kunsthistoriker Hans Koegler (1874-1950), der sich auch mit dem Titelholzschnitt befasste, stammt sie aus der Basler Offizin Adam Petris und ist frühestens auf das Jahr 1523 zu datieren.
Im Vorwort der späteren „Wittenberger Ausgabe“ von 1529 (VD16 D 2187), welche in der Fachliteratur bislang fälschlicherweise als Editio princeps angesehen wird, findet sich auch der Verfasser: Johann Domitzer. Unter diesem Namen figurierte 1504 der erste Prior des Augustinereremitenklosters in Wittenberg.
Je 1 Exemplar der Basler Erstausgabe von 1523 besitzen die Universitätsbibliothek Basel (Sign.: Lo X 5:2; siehe Hieronymus: Petri/Schwabe, Nr. 322a) und die Zentralbibliothek Zürich (Sign.: 18.1991; vollständiges Digitalisat: https://www.e-rara.ch/zuz/doi/10.3931/e-rara-88192).
Bibliographischer Nachweis im VD16 (seit Kurzem vorhanden):
http://gateway-bayern.de/VD16+ZV+32478

Kunsthistorische Angaben zum Titelholzschnitt:
https://www.niklaus-manuel.ch/Werke.aspx?id=13203775
Romano Zoccolan, Zürich

Abb. 1: Europa: Ortelius Europakarte von 1595 bezieht sich auf das keltische Europa. Welchen Zeitpunkt die Tafel wiedergibt, ist wegen der Gleichzeitigkeit dargestellter keltischer Gebiete wie Rätien und Noricum und vieler germanischer Stämme allerdings nicht zu bestimmen.
Die geografische Wahrheit: In der Welt von Abraham Ortelius
Am 20. Mai 1570 erschien in der Offizin von Christoph Plantin in Antwerpen die erste Auflage von Abraham Ortelius "Theatrum orbis terrarum", eine strukturierte Zusammenstellung verschiedener, großformatiger geografischer Karten in lateinischer Sprache. Einer der ersten Atlanten, unhandlich und schwer. Ihn käuflich zu erwerben war nur wenigen vergönnt: Seine Herstellung war teuer, nicht davon zu reden, wie viel Zeit in jede Karte, in das Auffinden und Sammeln des ganzen geografischen Wissens unterschiedlicher Kartografen geflossen war. Auf Wunsch gab es die Karten auch koloriert, mit Gold verziert und als Prachtband in Leder gebunden. Doch obwohl der Preis hoch war, leerten sich die Bestände des ersten "Theatrum" rasch. Durch die Übersetzung in die deutsche und niederländische Sprache nahm die Nachfrage noch weiter zu.
Abraham Ortelius (1527-1598) gilt als Begründer der niederländischen Kartographie. Nach Sebastian Münsters Tod in Basel 1552 schien sich das Zentrum für Geografie in Richtung Norden in die Niederlanden zu verschieben. Zunächst tritt Ortelius als begabter Illuminator hervor, von ihm kolorierte Karten und Druckwerke waren äußerst beliebt und nachgefragt. In alten Sprachen und Mathematik beschlagen, unternahm der flämische Cosmograph zahlreiche Reisen: Das Ziel seiner Sammlerjagd waren gute Karten, die er unter Angabe des jeweiligen Autors nachstechen ließ, und - wegen seiner Begeisterung für die Antike - alte Münzen. Die Reisen boten Ortelius überdies die Gelegenheit, ein Netzwerk von Gelehrten, Philologen und Historikern zu kultivieren, darunter der Flame Gerhard Mercator (eigentlich Gheert Cremer), der Ortelius für dessen "Sorgfalt und Eleganz" auszeichnete, "um die geographische Wahrheit zu zeigen, die so oft verzerrt wird". Auch der Geograf und Wissenschaftler Mercator gab der Kartografie wichtige Impulse: Eine Spezialität von ihm sind selbstgebastelte Erd- und Himmelsgloben, von denen heute noch rund ein Dutzend erhalten sind.

Abb. 2: Islandia: Einige Meermonster sind der Carta Marina von Olaus Magnus entlehnt, einer großformatigen Landkarte Nordeuropas aus dem Jahr 1539.

Abb. 3: Erläuterung der Fische: Vor jeder Karte konnte man sich eine kurze Erläuterung mit einer Vielzahl von Einzelinformationen zum Land oder Kontinent zu Gemüte führen. In der Einleitung zur Islandia-Karte erfährt der Leser etwas über den Narwal und über dessen langen Zahn, den man fälschlicherweise als Einhorn verkauft hatte, "um das Gift zu vertreiben". Weiter im Text findet sich ein Hinweis auf den Urheber des Meermonsters: "D. Hyena oder ein wunderMeerschwein dabei zu lesen ist bei Olao lib. 21".

Abb. 4: Amerika: Für Handelstreibende und Forschungsreisende waren große Teile Nordamerikas bis dahin noch nicht relevant; genauso war auch Australien Terra incognita.

Abb. 5: Abessinien und Arabien: Jahrelang sammelte Abraham Ortelius die besten und akkuratesten Karten. Amerika war entdeckt und die Welt umsegelt, doch das geografische Wissen zeigte noch Lücken. Dennoch, Ortelius und die anderen am "Theatrum" beteiligten Kartografen haben ihren Lesern ein Gefühl für Raum und Größe der Welt vermittelt.
"So geographers, in Africa maps, With savage pictures fill their gaps, And o’er uninhabitable downs Place elephants for want of towns." (Jonathan Swift)
Ortelius Heimatstadt Antwerpen war zu jener Zeit eine nicht länger durch Seehandel sondern durch Buchdruck und Diamantenhandel prosperierende Hafenstadt an der Schelde, ein infolge starker Immigration in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts kosmopolitischer Ort, der Ortelius zahlreiche Kontakte und Austausch ermöglichte. Es herrschte Krieg und das zu Spanien gehörende Antwerpen bildete den Mittelpunkt der politisch-religiösen Spannungen zwischen dem protestantischen Norden und dem katholischen Süden. Unter dem Joch der Inquisition musste Ortelius wie jeder andere Autor oder Verleger eine Druckgenehmigung für sein Buch einholen. Und natürlich die Zustimmung des in Spanien residierenden König Philipp II, der ihn im Jahr 1575 zum "Geographicus Regius" adelte.
Nicht allein für seinen Weltatlas sondern auch für seine Bibliothek, eine Art Museum, war Abraham Ortelius berühmt. Sie gilt als eine der größten privaten Sammlungen des 16. Jahrhunderts. Hochrangige Persönlichkeiten wie die Habsburger Ernst von Österreich und Albrecht VII machten ihm und seinem Museum ihre Aufwartung. Sein erster Biograf, Frans Sweerts, schrieb im Jahr 1601 von goldenen und silbernen Münzen aus der römischen und griechischen Antike, Muscheln aus Indien, Marmor in allen Farben.
Von Ortelius Wunderkammer ist nichts mehr erhalten. Es bleibt jedoch sein Verdienst, erstmals die besten geografischen Karten seiner Zeit in einem einheitlichen Format zusammengestellt und geordnet zu haben - ein Modell, das in modernen Atlanten noch immer Gültigkeit besitzt. Mehr als vierzig Ausgaben erschienen vom "Theatrum orbis terrarum". Durch die heutige teilweise Orientierungslosigkeit ohne Satelliten und Navigationssysteme kommt dem frühen Kartographen eine noch größere Wertschätzung zu.
Claudia Vogel, Überlingen
Literatur/Quellen
Büttner, Nils: Die Erfindung der Landschaft. Kosmographie und Landschaftskunst im Zeitalter Brueghels. Göttingen 2000.
Büttner, Nils: Abraham Ortelius comme collectionneur. Turnhout 1998 (S. 168-180).
Ortelius, Abraham: Theatrvm Orbis Terrarvm Abrahami Orteli[i]. Antwerpen 1601 (alle Abbildungen).
Schneider, Ute: Theatrum orbis terrarum: gedruckt zu Nuermberg durch Johann Koler Anno MDLXXII. Repr. der Ausgabe 1572, Nürnberg. Darmstadt 2006.
Essay von Gesa Schneider, aus: Bibliophilie – 33 Essays über die Faszination Buch. Im Auftrag der Schweizerischen Bibliophilen-Gesellschaft zum Anlass ihres 100-jährigen Bestehens (1921-2021) herausgegeben von Wolfram Schneider-Lastin, Weinfelden 2021 (ISBN 978-3-033-08479-7).
Lesen, Denken, Staunen. Über Das Große Lalula und andere Gedichte und Geschichten von morgens bis abends für Kinder
Das grosse Lalula – welch fantastischer Titel für ein Kinderbuch. Für ein Buch, das sich vorlesen lässt. Es ist rot, es glänzt, es ist leicht, und es regt, auf allen Ebenen, die Fantasie an. Der Titel bezieht sich natürlich auf das gleichnamige Lautgedicht von Christian Morgenstern – aber dazu später mehr.
Ich kann mich erinnern, wie mein Vater uns regelmäßig am Abend, vor dem Schlafengehen, aus diesem Buch vorgelesen hat. Die Geschichten und Gedichte sind sehr kurz. Sie sind nicht unbedingt für Kinder geschrieben. Sie vereinen Schalk, Witz und Ungehorsam, der Gesellschaft und den Konventionen der Literatur gegenüber, sie überraschen und bringen zum Nachdenken.
«Warum auf der Suche nach Geschichte, Gedichten für Kinder vor der Erwachsenenliteratur haltmachen? Es gibt eine Sprache, aus der man nicht herauswächst, die dem Kind wie dem Erwachsenen Poesie und Information, Verschwenderisches und Notwendiges bewahrt. Es gibt Bücher, denen es lästig wäre, an eine Altersstufe gebunden zu sein», schreibt die Herausgeberin Elisabeth Borchers in ihrer Einführung. Natürlich haben wir die damals gar nicht gelesen, die Metaebene hat uns nicht interessiert, das große Kind (meinen Vater) so wenig wie uns, meine Schwester und mich.
Erschienen ist das Buch 1971, zwei Jahre vor meiner Geburt, und ich glaube, dass wir es ab 1979 regelmäßig gemeinsam gelesen haben. Es enthält Texte von Christian Morgenstern, von Ernst Jandl, von Franz Hohler, von Elisabeth Borchers, Oscar Wilde, aber auch von vielen vergessenen und unbekannten Autorinnen und Autoren, wie Irina Piwowarowa, Hermynia zur Mühlen oder Clara Fechner.
Die Texte sind nicht thematisch verknüpft, stattdessen spielt die Lesezeit eine zentrale Rolle: «Die Sammlung von Märchen, Geschichten, Gedichten, Reimen, Liedern, Zitaten werden von zwölf großen Zahlen unterbrochen. Es sind die Stunden des Tages. Dann kommt schon die Nacht.» So hört die Einführung auf. Man kann sich tatsächlich fragen, ob die Geschichten in der Nacht weiterleben, ihre Spuren hinterlassen – und einen dann nachhaltig verwirren: «Denn ich bin einmal im Traum in eine Glasscherbe getreten. So habe ich im Schlaf solche Schmerzen davon empfunden, daß ich um keinen Preis mehr barfuß schlafen möchte», heißt es beispielsweise in dem wunderbaren Text Der vorsichtige Träumer von Johann Peter Hebel.
Das wohl wichtigste Gedicht des Buches – für mich zumindest – war damals ottos mops, von Ernst Jandl. Wenige Gedichtzeilen können Kinder so glücklich machen wie: «ottos mops kotzt / otto: ogottogott.» Ich meine zu wissen, dass es das erste Gedicht überhaupt war, das ich auswendig gelernt habe. Die schiere Freude am Klang der Worte und natürlich an dem damit verbundenen Sinn - «otto holt koks / otto holt obst […] otto: komm mops komm» - hat meine Schwester und mich dazu gebracht, es immer und immer wieder zu rezitieren, am besten sehr laut und am besten so, dass es meiner Mutter - bei aller Liebe für österreichische Dichter im Allgemeinen und Ernst Jandl im Besonderen - irgendwann doch zu viel wurde.

Ein anderes Gedicht von Jandl, das ich jetzt wiederentdeckt habe, heißt familienfoto, und es geht so:
familienfoto
der vater hält sich gerade
die mutter hält sich gerade
der sohn hält sich gerade
der sohn hält sich gerade
der sohn hält sich gerade
der sohn hält sich gerade
der sohn hält sich gerade
die tochter hält sich gerade
die tochter hält sich gerade
Dass die Beschreibung eines Fotos – und noch dazu eine so minimalistische, repetitive, ein Gedicht sein kann, und dass ich mir dieses Bild wiederum genau vorstellen kann, zeugt für mich von der Wirksamkeit und der Verspieltheit dieser Lyrik. Ich kann mich noch über meine Verwunderung erinnern, dass es so große Familien gab. Und dass sie alle so unbeweglich standen, was etwas über die Familie aussagt, aber auch über das Medium der Fotografie, nämlich einen Moment einzufangen, aber auch bezeichnend ist für das Medium der Schrift, diesen Moment wieder zu dynamisieren, über das Schreiben, das Schriftbild, und – immer wieder – über das Lesen.
Und natürlich ist da das titelgebende Gedicht von Christian Morgenstern, Das große Lalula, das mir zum ersten Mal klar gemacht hat, was Onomatopoesie ist, Lautgedichte, die Bilder erzeugen, ohne an einen festen Sinn gebunden zu sein. Auch den Texten von Peter Bichsel oder Franz Hohler (Der Granitblock im Kino) bin ich in diesem Buch zum ersten Mal begegnet.
Und das Buch weckt ein Gefühl für die große weite Welt und die Sehnsucht nach ihr. Geschichten und Märchen aus Russland, aus Afrika, aus dem arabischen Raum, die alle von der Sehnsucht erzählen, sodass diese weite Welt immer woanders ist, und gleichzeitig immer schon hier, im Buch, wo sie für uns neu entsteht.
Ich habe erst jetzt recherchiert, wer die Herausgeberin dieser Textsammlung ist. Elisabeth Borchers war wohl eine der wichtigsten Literaturvermittlerinnen im Nachkriegsdeutschland. Sie hat geschrieben, übersetzt, herausgegeben, sie war Lektorin, erst bei Luchterhand, dann bei Suhrkamp, und immer hatte sie den Anspruch, Kinder als Lesende ernst zu nehmen und Erwachsenen das kindliche Staunen nicht auszutreiben.
Für mich als Kind hieß Lesen Vorlesen, es galt das gesprochene Wort, in meinem Ohr, gleichzeitig der Blick in das Buch, das der Vater uns vorlas, das Wahrnehmen der Typografie auf der Seite, als Bildschrift. Und dann waren da natürlich die Farben und die Illustrationen. Dass Text nicht unbedingt Schwarz auf Weiß sein muss, dass er, wie in diesem Fall, auch rot sein darf, und mal groß, mal klein, mal wie mit einer Schreibmaschine geschrieben, mal experimentell gesetzt – es kann sein, dass mein Interesse an der Gestaltung von Büchern und wie wichtig diese sein kann, um Sinn zu transportieren, schon damals geweckt wurde.

Als die Hausaufgabe irgendwann Anfang der 80er-Jahre in Berlin lautete, ein Lieblingsgedicht auswendig zu lernen und vorzutragen, habe ich – wen überrascht’s? – ottos mops gewählt. Und mit viel Verve und Einfühlvermögen vorgetragen. Dass die Lehrerin dann tatsächlich meine Eltern anrief, um sich über meine Wahl zu beschweren, habe ich damals gar nicht verstanden, mir war nicht bewusst, dass dieses Gedicht anecken könnte. Im Nachhinein jedoch steht fest, dass dieser Moment wohl den Grundstein gelegt hat für das Bewusstsein, dass Literatur das Potenzial zur Störung der gegebenen Ordnung haben kann.

Deshalb bin ich fest davon überzeugt, dass Bücher und Texte magisch sind, sie enthalten Schlüssel für das Nachdenken über die Welt, sie geben einem die Kraft und die Erlaubnis für unangepasstes Denken, sie stellen sich sogar im Nachhinein als etwas heraus, das die Welt im Kleinen erschüttern kann. Und sie erweitern die Grenzen dessen, was unter Sprache und Welt verstanden wird, immer von Neuem.
Gesa Schneider, Zürich
Das große Lalula und andere Gedichte und Geschichten von morgens bis abends für Kinder, Hamburg 1971.

Abb. 1: Alchemische Sammelhandschrift, Ms.184, um 1578, 81 Bl., 19,5 x 15cm.
Drei Jahre nach Gründung der Leopold-Sophien-Bibliothek im Jahr 1832 entschloss sich ihr Begründer, der Überlinger Stadtpfarrer Franz Sales Wocheler (1778-1848), eine Sammlung alchemistischer Handschriften und Druckwerke käuflich zu erwerben. Sie entsprang dem Nachlass des Juristen, Johann Baptist Sebastian Freiherr von Sonnenthal (1759-1834), dessen 143 Manuskripte aus dem 15. bis 19. Jahrhundert den Grundstock der Überlinger Alchemica bildeten. Mittlerweile beherbergt das spätgotische "Steinhaus" in Überlingen, wo die Leopold-Sophien-Bibliothek mit insgesamt rund 57.000 Bänden und 600 Handschriften untergebracht ist, einige Hundert Buchtitel zu Alchemie, Geheimgesellschaften (Freimaurerei und Rosenkreuzertum), Magie und Hermeneutik, darunter Werke von Geber, Raimundus Lullus, Paracelsus, Johann Becher, Salomon Trismosin sowie Basilius Valentinus, Andreas Libavius und Pierre Joseph Macquer - Letztere bereits Wegbereiter der modernen Chemie.
"Die Alchemie war eine naturphilosophische Bewegung, die technologisches Wissen orientalischer Herkunft mit antiker Philosophie und Astrologie verband." (Horchler)
Der Ausgangspunkt der alchemistischen Lehre war die Umwandelbarkeit von Stoffen und ihre Reaktionen. Alchemisten ersehnten die Transmutation von einem einfachen Basismetall zu edleren Metallen, besonders zu Gold und Silber - mit Hilfe des "Lapis philosophorum", dem Stein der Weisen, der eigentlich eine rote Substanz war und alle Krankheiten heilen sollte. Die ersten lateinischen Übersetzungen alchemistischer Texte aus dem Griechischen und Arabischen stammen aus dem 12. Jahrhundert, im 13. Jahrhundert taucht alchemistisches Wissen vereinzelt in Enzyklopädien auf, wie im "Liber de natura rerum" von Thomas von Cantimpré; die Blütezeit der Alchemie wird auf das 14. Jahrhundert angesetzt. Gedruckte Alchemica haben handschriftliche Aufzeichnungen nie abgelöst - schon allein aufgrund der zu hohen Kosten und fehlender Verleger und aus Angst vor Profanation: Die "Aura von Einzigartigkeit und Geheimwissen" (Schaudeck) sollte geschützt bleiben. Mit der Mess- und Prüfbarkeit der Naturwissenschaften wurde indessen das Ende alchemistischer Experimente eingeläutet, womit Alchemisten ursprünglich auch die Natur erforschen und ein Verständnis der Welt und ihrer Zusammenhänge bekommen wollten.

Abb. 2: Bernhart Fasnacht, "Liber Alchimie", Ms. 161, 1526, 189 Bl., 16x12cm, kolorierte praktische Darstellungen.
Ein Merkmal alchemistischer Literatur sind ihre anschaulich und bisweilen skurril gestalteten Illustrationen und Buchmalereien. Die Schriften, teils religiös-spirituell, teils chemisch-technisch, gliedern sich in fünf Untergruppen: wissenschaftstheoretische Schriften, die Alchemia technica und ihre Gerätschaften und technischen Praktiken, die Alchemia medica mit Medizin und Arzneimittelzubereitungen, die Alchemia mystica mit hermetischen und theosophischen Schriften und Symbolen und die Alchemia transmutatoria metallorum, die sich der Umwandlung der Metalle und der Goldherstellung widmet. Im Bild ein Beispiel für die Alchemia technica und einer gemalten Abbildung eines Ofens.

Abb. 3 und 4: Splendor Solis oder der Sonnenglanz, Ms. 237, 18./19. Jahrhundert, 62 Bl., 36,5x22cm, kolorierter 22-teiliger Bilderzyklus des Splendor Solis.

Die kolorierten Federzeichnungen entspringen einem Manuskript aus dem 18./19. Jahrhundert. Das Original Text-Bild-Traktat "Splendor Solis" datiert vermutlich vor 1500 und entstand im deutschen Kulturraum. Auf den Abbildungen sieht man einen Hermaphroditen und die Figur eines Alchemisten, der eine Glasphiole hält, in der Elixiere zusammengebraut, destilliert und kalziniert werden - in der also mittels alchemistischer Prozesse Edelmetalle und das Allheilmittel hergestellt werden: "Es ist auch der Phylososphen: distillacion, oder Clarificirung, Welliches nichts anders ist, Dan ein Rainmachung eines dings, mit seiner wesentlichen Feichtigkait."
„In der von aufklärerischen Positionen geprägten Geschichtsschreibung fanden sich Alchemiker als ‚Narren‘, ‚Scharlatane‘ und ‚Betrüger‘ geächtet. Heute hingegen werden sie gelegentlich zu Partisanen der ‚Wissenschaftlichen Revolution‘ stilisiert.“ (Telle)
Durch ihre Nähe zu Okkultismus, Esoterik und Zauberei weckt(e) die Lehre der Alchemie immer auch Bedenken hinsichtlich ihrer Seriosität. Im Jahr 1317 erließ Papst XXII ein Dekret gegen Goldmacher und Falschmünzer. 1610 wurde Ben Jonsons Komödie "The Alchemist" uraufgeführt, einer satirehaften Charakterstudie eines Alchemisten.
Die Alchemie stand indes mit allen anderen Künsten und Wissenschaften des Mittelalters in Beziehung und blieb viele Hundert Jahre lang ein wichtiger Zweig der Naturwissenschaften und der Naturphilosophie, der erst im Laufe des 18. Jahrhunderts allmählich in moderne Wissenschaften wie Chemie und Pharmakologie aufging und damit auch seinen geheimen Charakter verlor. Naturwissenschaftler, Philosophen und Theologen der Aufklärung nutzten die Erkenntnisse der Alchemie im damals neuen Kontext der Wissenschaft. Auch Isaac Newton zeigte ein unverhohlenes Interesse für Alchemie. Selbst noch als Präsident der Royal Society befasste sich der unermüdlich forschende Newton mit Versuchen, die den Boden der Rationalität verlassen hatten. Es ist daher nicht verwunderlich, dass selbst Schuldekan und Stadtpfarrer Franz Sales Wocheler ein paar Bücher zu Geheimgesellschaften besaß, die er der Leopold-Sophien-Bibliothek vermachte.
Die Überlinger Alchemica als ein kulturhistorisches Zeugnis ihrer Zeit
Bis heute wirft der Umstand, dass alchemistische Bücher und Handschriften in eine von einem Pfarrer für pädagogische und kulturelle Ziele konzipierte Bibliothek am Bodensee Einzug gehalten haben, Fragen auf - zu einer Zeit zwischen französischer Revolution und Moderne. Vielleicht war die Alchemie ein Ausgleich zu der nun vernunftgeleiteten Wirklichkeit. Eine Art Hochkonjunktur erlebten auch arkane Gesellschaften. Die alchemistischen Handschriften und Drucke von Freiherr von Sonnenthal, dem keine Mitgliedschaft in einer Geheimgesellschaft nachgewiesen werden kann, sind tendenziell mit einem Fundus an geheimgesellschaftlichen Inhalten ausgestattet. Sie dienten in erster Linie weniger bibliophilen Zwecken, sondern wurden benutzt und gelesen, wofür auch die handschriftlichen Kommentare an den Rändern sprechen (Schaudeck).

Abb. 5: Heinrich Khunrath: Amphitheatrum sapientiae aeterna solus verae Christiano-kabbalisticum. Hanau 1609.
Seine detailreichen, erzählerischen Kupferstiche haben den Arzt und Alchemisten Heinrich Khunrath bekannt gemacht. Die Abbildung präsentiert eine Szene aus einem alchemistischen Laboratorium: Die linke Bildseite, mit der Figur des Alchemisten, der vor einem Altar kniet, steht für den innerlichen Bereich, für Religion und Meditation. Auf der rechten Seite ist der rational-analytische Bereich in Form von Experimenten und Forschen; Musikinstrumente in der Bildmitte symbolisieren die (vermittelnden) Bereiche Kreativität und Kunst. Auf den architektonischen Elemente im Bild deuten Sinnsprüche ("Festina lente" - Beeile Dich langsam, "Dormiens vigila" - Wache im Schlaf) auf unterschiedliche Bewusstseinszustände hin. In der Abbildung verschmelzen Theorie und Praxis miteinander: Analog zum Motto 'aus Blei wird Gold' weist die Buchillustration auf die seelische Umwandlung des Menschen hin - die Alchemie als Weg und als Kunst, sich in Gott zu verwirklichen.
"Eine Bibliothek besitzt das Potenzial einer kritischen oder wohlwollenden Prüfung der Bücher durch Folgegenerationen." (Schaudeck)
Offensichtlich nahm sich die Alchemie die Freiheit, scheinbar grenzenlos und spielerisch Ungewöhnliches zu erproben. Die Ästhetik alchemistischer Symbole, Geheimschriften und Bilder und ihre magische Aura sind bis heute nicht ohne Reiz geblieben. Wohl weniger, weil man sich Antworten auf große Fragen der Natur erhofft, sondern mehr aus der Lust am Unergründlichen. Auch wissenschaftlich bleibt die Alchemie ein in Teilen noch immer unerforschtes Gebiet, allerdings wirkt sich zum Beispiel die oft unverständliche Fachsprache alchemistischer Texte auf ihre nähere sprachliche Untersuchung erschwerend aus (Horchler). Wer sich mit Alchemie beschäftigt, stößt auf ein großes kreatives Potenzial und ungewohnte Denkmodelle. Viele Künstler, nicht nur im Surrealismus, haben sich davon inspirieren lassen.
Claudia Vogel, Überlingen
Literatur:
Eliade, Mircea: Schmiede und Alchemisten. Stuttgart 1980
Horchler, Michael: Die Alchemie in der deutschen Literatur des Mittelalters. Baden-Baden 2005
Schaudeck, Franziska: Die alchemische Handschriftensammlung der Leopold-Sophien-Bibliothek in Überlingen am Bodensee. Freiburg 2020
Telle, Joachim: Alchemie und Poesie. Deutsche Alchemikerdichtungen des 15. bis 17. Jahrhunderts. Berlin 2013
Die Titelbilder der «Margarita Philosophica» (1503 und 1508)
Die «Margarita Philosophica» (lat. margarita = Perle, Schatz, vgl. Matthäus-Evangelium 7,6 und 13,46) ist ein systematisch geordnetes Kompendium des Grundwissens für Studenten. Gespiesen ist es aus der Wissensliteratur der klassischen Antike, der Spätantike (Boethius, Cassiodor), der Kirchenväter und des Mittelalters (Thomas von Aquin, Albertus Magnus) sowie von Spezialliteratur. Anhand der «Margarita» lässt sich ersehen, was man an einer Universität am Ende des Spätmittelalters wissen konnte und sollte. Der Text ist als Dialog zwischen Schüler und Lehrer disponiert. Es ist eine der frühesten bebilderten Enzyklopädien Europas im Printmedium. Umfang (Ausgabe 1517): 292 Fol. = 583 Seiten im Oktav-Format.
Der Verfasser ist Gregor Reisch (sein Name erscheint bloß im Widmungsgedicht von Adam Werner), geboren ca. 1470 – 1487 an der Universität Freiburg/Br. immatrikuliert – 1489 Magister artium – 1494 an der Universität Ingolstadt – Einritt in den Kartäuserorden, wo er in Freiburg 1502 Prior wird – 1503 erster Druck der «Margarita» – seit 1509 Beichtvater von Kaiser Maximilian I. – 1517 erscheint die Ausgabe letzter Hand. – Gestorben ist Gregor Reisch am 9. Mai 1525.
Die «Margarita» ist bebildert. Es lassen sich verschiedene Visualisierungs-Typen erkennen: Mimetische Bilder (z.B. die monströsen Menschen in der fernen Welt), allegorische Bilder und Personifikationen (z.B. die Logik), Diagramme (z.B. das Logische Quadrat) u.a.m. Die Bilder haben verschiedene Funktionen: Einige bilden real existierende Objekte ab (z.B. Anatomie); andere veranschaulichen ein abstraktes Konzept (z.B. das Aderlassmännchen); andere dienen als Blickfang für ein neu beginnendes Kapitel. Hier konzentrieren wir uns auf den Buchtitel.
Das Titelbild der Erstausgabe 1503

Abb. 1: Titel der Erstausgabe 1503.
MARGARITA PHILOSOPHICA totius Philosophiæ Rationalis / Naturalis & Moralis principia dialogice duedecim libris complectens, Freiburg/Br.: Johannes Schott 1503.
Digitalisat: http://dl.ub.uni-freiburg.de/diglit/reisch1503
Die Personifikationen der Philosophie und der Sieben freien Künste (Artes) sind durch einen Kreis eingeschlossen, was die Ganzheit, Einheit und Vollkommenheit des Wissens repräsentieren mag. Am oberen Bildrand befindet sich eine Darstellung der Philosophia divina, repräsentiert durch die lateinischen Kirchenväter. Am unteren Rand sitzen schreibend Aristoteles und Seneca als Vertreter der Philosophia naturalis bzw. moralis. Es kommen mithin nur zwei Typen von menschlichen Gestalten vor: Personifikationen und historische Personen. Der Bildaufbau ähnelt der Darstellung im «Hortus deliciarum» der Herrad von Landsberg (Handschrift um 1180) – hat Reisch dieses Bild im Prämonstratenser-Kloster Hohenburg im Elsass zu Gesicht bekommen?
-
Die geflügelte, dreiköpfige Philosophie trägt eine einzige Krone über den drei Köpfen. Als Attribute hält sie Buch und Szepter in Händen. Auf ihrem Kleid ist eine Leiter eingezeichnet, die vom unteren Pi (als griechisches Minuskel-Pi geschreiben) nach oben zum (lateinischen) T führt. Der Aufstieg über Stufen ist eine Idee von Boethius, «Consolatio Philosophiae», prosa 1: Auf dem Kleid der Philosophie war im untersten Saum der griechische Buchstabe P, im obersten ein Th eingewirkt zu lesen, und zwischen beiden wurden in Form einer Treppe angeordnete Stufen sichtbar, mittelst deren, wie es schien, ein Aufstieg von dem unteren zu dem oberen Buchstaben stattfinden sollte. Dazu gab es immer wieder neue Deutungen und Visualisierungen, beispielsweise das π als practica vita – das θ als theoretica vita.
-
Die Allegorien der Septem artes liberales stehen oder sitzen im Halbkreis um die große, zentrale Figur der Philosophie herum und halten charakteristische Attribute in Händen: die Astronomie eine Armillarsphäre, die Geometrie einen Zirkel, die Musik eine Harfe usw. Die Sieben freien Künste (Grammatik, Rhetorik, Dialektik; Arithmetik, Musik, Geometrie, Astronomie) als Basis des Wissens sind ein Konzept der Spätantike und des Mittelalters; ihr Studium diente als Vorbereitung für dasjenige der Theologie, Jurisprudenz und Medizin.
-
Die für die göttliche Philosophie zuständigen lateinischen Kirchenväter sind mit Spruchbändern angeschrieben und tragen die ihnen zukommenden Kopfbedeckungen (von links nach rechts): Augustinus mit Mitra, Gregor der Große mit der päpstlichen Tiara, Hieronymus mit Kardinalshut und Ambrosius mit Mitra.
-
Unten links steht Aristoteles für die Philosophia naturae. Gemeint ist Aristoteles insbesondere als Verfasser der Tierkunde, die in lateinischen Übersetzungen von Albertus Magnus und von Theodor Gaza (1497 gedruckt) bekannt war. Rechts unten: Seneca steht vor allem wegen seinen «Epistulae morales» für die (heidnisch-antike) Ethik.
Die bildliche Darstellung entspricht seltsamerweise nicht dem Aufbau des Werks. Die «Margarita» geht über die Sieben freien Künste hinaus: Die weiteren fünf Bücher umfassen: De principiis rerum naturalium; De origine rerum naturalium; De anima et potentiis eiusdem; De natura, origine ac immortalitate animae intellectivae; De principiis philosophiae moralis. (Über die Grundstoffe der natürlichen Dinge; Über den Ursprung der natürlichen Dinge; Über die Seele und ihre Vermögen; Über das Wesen, den Ursprung und die Unsterblichkeit der erkennenden Seele; Über die Grundlagen der Moralphilosophie.) Ferner: Die durch die drei Häupter der personifizierten Philosophie repräsentierten Gebiete der Naturkunde / Logik / Ethik bilden ebenfalls nicht den inhaltlichen Aufbau des Buches ab. Buch II behandelt die Logik; die Bücher VIII und IX behandeln Naturdinge; Buch XII behandelt die moralischen Prinzipien.
Das Titelbild der Ausgabe 1508
In der Erstausgabe 1503 steht vor dem ersten Buch eine Einteilung der Philosophie in Form eines taxonomischen Diagramms. Solche Baum-Grafiken, die zeigen sollen, dass und wie das gesamte Wissen systematisch zusammenhängt, wurden bis zum Système figuré des Connaissances Humaines in der «Encyclopédie» von Diderot 1751 immer wieder dargestellt.

Abb. 2: Diagramm der philosophischen Disziplinen 1503.
Diese Grafik dürfte das Titelbild der Ausgabe 1508 angeregt haben, wo es dem Bildtypus der im Mittelalter häufigen Darstellung der Wurzel-Jesse (Jesaias 11,1; vgl. Römerbrief 15,12) überlagert wurde. Auch die Schedelsche Weltchronik (1493) stellt Stammbäume gerne so dar:

Abb. 3: Die Familie von Japhet in der Schedelschen Weltchronik, fol. XVIr.
So erklärt sich das Titelbild der Neuauflage:

Abb. 4: Titel der Ausgabe 1508.
Margarita Philosophica cum additionibus novis; ab auctore suo studiosissima revisione tertio superadditis, Basel: Michael Furter & Johannes Schott 1508.
Digitalisat: http://dl.ub.uni-freiburg.de/diglit/reisch1508/0009/
Aus dem Schoß der Philosophie entspringt ein baumartiges Gewächs. Die drei Sparten der Philosophie und die Sieben freien Künste sind durch das organische Geäst miteinander verbunden. Über der Szene schweben links oben Maria im Strahlenkranz und in der Mitte die Trinität – auf letztere sind die vier Kirchenväter ausgerichtet. Das Bild enthält mehrere Ebenen (a) – (d).
(a) Die personifizierte Philosophie (wie schon 1503) hält Buch und Szepter in Händen; sie ist gekrönt, ist indessen nicht mehr dreiköpfig. Das Hündchen beim Stuhl und das Gras rechts unten sind Kolorit. Die Turba philosophorum (eine Schar von Philosophen, darunter auch eine Frau!) liest in dem ihnen von der Philosophie hingehaltenen Buch.
(b1) Aus ihrem Schoß wachsen hervor die Unterabteilungen der Philosophie (rationalis, moralis, naturalis), die als allegorische Figuren in Blütenranken dargestellt sind. Die Philosophia naturalis betrachtet mit einem Astrolab den Himmel, wie es der Bildtradition der personifizierten Astronomie entspricht; die Philosophia moralis wird durch ein Figurenpaar (Lehrer und Schüler) verkörpert
(b2) Die Septem Artes sitzen – mit ihren Attributen versehen – in geschwungenen Blättern. Die Astronomie hält wiederum eine Armillarsphäre; die Geometrie ein Winkelmaß usw.
(c1) Links oben im Bild erscheint die ‹apokalyptische Madonna›: eine Darstellung der Maria auf der Mondsichel mit Strahlen- und Sternenkranz (vgl. Apokalypse 12,1), unter ihr die Schlange/der Drache. Das ist – wie auch (c2) – ein anderer Himmel als der von der Naturphilosophie betrachtete (b1).
(c2) Am oberen Bildrand in der Mitte ist die Trinität im Himmel dargestellt, umgeben von einem Wolkenkranz: Gott Vater und Sohn als Personen, der Heilige Geist als Taube.
(d) Oben rechts die Kirchenväter, als Gruppe angeschrieben (Doctores ecclesiastici) und durch ihre Kopfbedeckungen charakterisiert wie im Druck 1503.
Aristoteles und Seneca fehlen hier.
Warum wurde das Titelblatt ausgewechselt?
Man könnte vermuten, ein Stilwandel habe dazu angeregt, ein derart verschiedenartiges Titelbild zu gestalten. Das mag mitspielen. Der Grund ist indessen wohl weniger ein ästhetischer als ein kommerzieller.
Während Schreibstuben in Klöstern Bücher nach Bedarf handschriftlich unikal kopierten, konnte man mit dem Buchdruck Bücher auf Vorrat produzieren; auch gab es bald mehrere Buchdrucker/Verleger, das heißt: Es entstand ein Markt, und damit Konkurrenz und das Bedürfnis, die eigenen Erzeugnisse als solche hervorzuheben. Das konnte unterstützt werden mit einem einprägsamen Titelblatt, das – etwa an Buchmessen – als Blickfang fungierte und das Buch als attraktiv auszeichnete.
Nun hatte im Jahr nach der Erstpublikation der «Margarita» (1503) der erfolgreiche Verleger Johannes Grüninger in Straßburg einen Raubdruck auf den Markt gebracht. Den Holzschnitt des Titelbilds ließ er 1504 genau kopieren. Der Verleger Schott seinerseits druckte im selben Jahr eine Neuauflage und warnte seine Käufer in lateinischen Versen am Schluss des Buchs vor dem Kauf einer Ausgabe, die nicht mit seinem Buchdrucker-Zeichen versehen sei. Grüninger druckte unbeeindruckt 1508 wieder eine «Margarita» mit dem ersten Titelbild; Reisch veranlasste im selben Jahr im Verlag von Michael Furter und Johannes Schott in Basel einen Druck mit dem neuen Titelbild. Auch die Ausgabe letzter Hand 1517 enthält dieses neue Bild nach dem Haupttitel.
Literaturangaben:
Reprint der Ausgabe Basel 1517, mit einem Vorwort, einer Einleitung und einem neu gesetzten Inhaltsverzeichnis von Lutz Geldsetzer, Düsseldorf: Stern-Verlag Janssen & Co. 1973.
Englische Teil-Übersetzung mit Einleitung: Sachiko Kusukawa / Andrew R. Cunningham, Natural philosophy epitomised: Books 8-11 of Gregor Reisch’s Philosophical Pearl (1503). Aldershot: Ashgate 2010.
Deutsche [Gesamt-]Übersetzung von Otto und Eva Schönberger: Margarita Philosophica (Basel 1517), Würzburg: Königshausen & Neumann 2016.
Weitere Titelbilder von Enzyklopädien sind zusammengestellt auf meiner Website: http://www.enzyklopaedie.ch/fronti/frontispizien_hauptseite.html
Paul Michel, Zürich
Hölderlin — Ausgewählte Gedichte הלדרלין – שירים נבחרים
übersetzt von G. Liebes תרגם ג. ליבס
Tarshish Verlag. Jerusalem, 1945 תרשיש. ירושלים,

Abb. 1: Titelseite des Buches. Druckschrift von Franziska Baruch.
«Am Nest kann man sehen, was für ein Vogel darin wohnt»
Nur über mich selbst kann ich erzählen und als solchen, der glaubt, dass seine Bibliothek sein Selbst widerspiegelt, erlaube ich mir, über eines meiner Bücher zu schreiben. Und obwohl ich möglicherweise über jedes einzelne meiner Bücher schreiben könnte, gehört das Buch, das ich wähle, zu einer Sammlung von Büchern, die ich besitze, einem speziellen Subgenre, vielleicht einzigartig, die mehr als alle eine einzigartige condicio humana bedeuten.
Ein komischer Vogel
Ein zweisprachiges Buch ist schon ein seltsames Wesen. Es erfordert viel Mühe, spricht aber nur sehr wenige Menschen an. Es lässt auch den Albtraum eines jeden Übersetzers wahr werden und bringt seinen Versuch buchstäblich zum Vergleich mit dem Original. Wenn es um zweisprachige deutsch-hebräische Bücher geht, ist die Sache noch komplizierter. Die beiden Sprachen stammen aus völlig unterschiedlichen Wurzeln, sind mit anderen Alphabeten konstruiert und werden sogar in völlig entgegengesetzten Richtungen gelesen. Dies ist, bevor wir überhaupt anfangen damit, die problematische Geschichte, zwischen den beiden Sprachen, zu erwähnen. Eine Geschichte, die für viele, die deutsche Sprache, zu einem Tabu macht.

Abb. 2: Letzte Seite des Buches. Das Tarshish-Logo und darunter der Text: "Dieses Buch, das achte der Tarshish-Druckserie, wurde im Tarhish-Verlag in Jerusalem arrangiert und repariert und im Jahr 5705 [1945 im hebräischen Kalender] in einer limitierten Auflage von dreihundertdreißig Formen in der Lichenheim und Sohn Druckerei in Jerusalem gedruckt . Das Buch und die Dekoration wurden von Franzisca Baruch angefertigt."
Weder Fisch noch Vogel
Und doch findet man in meiner Buchsammlung zwei volle Regale mit zweisprachigen hebräisch-deutschen Büchern. Für mich gibt es nichts Schöneres als ein gut gemachtes zweisprachiges hebräisch-deutsches Buch zu sehen. Und nur um das zu verdeutlichen, zähle ich ein Buch nur dann als solches, wenn es die beiden Sprachen auf derselben Seite zusammenbringt und gegenüberstellt.
Hebräisch und Deutsch sind trotz und wegen ihrer tragischen Geschichte zwei Sprachen, die miteinander verbunden sind. Das moderne Hebräisch wurde hauptsächlich in deutschsprachigen Ländern von deutschsprachigen Menschen geschaffen. Man kann immer noch viele Wörter finden, die von einer Sprache in die andere übernommen wurden. Und natürlich sollte man die jiddische Sprache nicht vergessen, die hauptsächlich aus Hebräisch und Deutsch aufgebaut ist und als Liebeskind dieser beiden Sprachen angesehen wird. Während in anderen zweisprachigen Büchern die Sprachen einander nachjagen, treffen sich, wenn es um zweisprachige deutsch-hebräische Bücher geht, wenn diese der Norm entsprechend gemacht werden, diese beiden Sprachen poetisch in der Mitte.
All dies macht das Buch nicht nur zweisprachig, sondern auch zu einem Buch als Mittel für Zwiegespräche.

Abb. 3: Einband des Buches.
Die Dornenvögel
Das Buch, das ich aus dem Regal ziehe, ist gebunden und grob mit dunkel- und hellbrauner Farbe versehen. Wenn das Licht auf das Buch fällt, zeigt sich ein kleines silbernes Schiff im braunen Meer. Dies ist das berühmte Logo des Tarshish Verlags.
Der Tarshish Verlag wurde in Jerusalem von Moshe Spitzer (1900-1982), einem Buchdesigner, Typographen, Schriftdesigner, Bibliophilen und Verleger, gegründet. Spitzer, zuvor Manager des Schocken Verlags in Berlin, wanderte 1939 gerade noch rechtzeitig nach Jerusalem aus, um dort seinen eigenen Verlag zu gründen. Tarshish war und ist bekannt als einer der wichtigsten Verlage in Israel (damals noch Palästina), ein bahnbrechendes Institut, das den Bibliophilismus aus Deutschland nach Israel brachte.
Dieses Buch ist eines von 330 Exemplaren, die 1945 in der Druckerei Lichenheim und Sohn gedruckt wurden. Es enthält die wunderschöne Schrift von Franziska Baruch (1901-1989), einer weiteren Schocken-Mitarbeiterin, die 1933 nach Palästina floh, um eine der bekanntesten Kalligraphinnen und Typografinnen für hebräische Schrift zu werden.
Das Buch selbst ist eine Gedichtauswahl von Friedrich Hölderlin, übersetzt von Joseph Gerhard Liebes (1910-1988), einem der bekanntesten Übersetzer der hebräischen Sprache, der vor allem für seine Übersetzungen von Platon, Shakespeare und Wolfskehl bekannt ist. Auch er floh 1933 vor dem nationalsozialistischen Terror aus Deutschland.
Einsamer Vogel
Dieses Buch kann hauptsächlich als Versuch angesehen werden: ein Versuch, Hölderlin den deutschen Einwanderern in Palästina wieder vorzustellen. Ein Versuch, durch Hölderlin - den grossen Humanisten und Tröster der Einsamen - die einstige Muttersprache wieder "mütterlich" zu machen; ein Versuch, um zu zeigen, dass die Ideen und Werte von Hölderlin auch auf Hebräisch, die neue Stiefmuttersprache, angepasst werden können.
Das erste Gedicht in diesem Buch trägt den Titel "Die Liebe" oder auf Hebräisch "ha'Ahava". Dieses Thema, das keine Grenzen der Sprache kennt, wird hier in Inhalt und Form wunderschön dargestellt. Seite an Seite wird es in der Mitte von zwei sehr weit entfernten und doch sehr nahen Sprachen getroffen.

Abb. 4: Erstes Gedicht des Buches - "Die Liebe" von Hölderlin in hebräischer und deutscher Sprache.
Oded Fluss, Zürich
Zur Geschichte eines gedruckten Predigtbandes
Schön anzusehen ist es nicht, das Buch, von dem hier die Rede ist. Der Pappeinband mit Kleisterpapierumschlag ist stark abgegriffen, berieben und defekt; das bedruckte Papier durchgehend stark stockfleckig. Und auch sein muffiger Geruch lädt nicht gerade ein, im Buch zu verweilen und darin zu lesen. Was das vor einiger Zeit antiquarisch erworbene Buch trotzdem attraktiv macht, ist seine Geschichte, die anhand von gedruckten und handgeschriebenen Hinweisen weitgehend nachgezeichnet werden kann.

Abb. 1: Einband vorne
Verlegt und verteilt wurde das 104 Seiten umfassende, an einem nicht bekannten Ort gedruckte und gebundene Buch im Oktavformat durch den Winterthurer Verlagsbuchhändler Johann Heinrich Steiner im Jahr 1787. Es enthält die Niederschrift von drei Pfingstpredigten, die der Zürcher Pfarrer Johann Caspar Lavater (1741–1801) im selben Jahr am Pfingstsonntag, am Pfingstmontag und am darauffolgenden Sonntag über die ersten 47 Verse des zweiten Kapitels der Apostelgeschichte in seiner Kirche St. Peter in Zürich gehalten hatte.
Laut Vermerk von Lavater auf dem Titelblatt schenkte dieser das Büchlein am 11. November 1787 einem Hans Jacob Urner. Es muss sich beim Erstbesitzer nach weiteren Einträgen um Johann Jacob Urner von Hirzel gehandelt haben, der auf Empfehlung von Lavater 1788 Adjunkt im Waisenhaus Zürich wurde, wo Lavater von 1769 bis 1775 als Diakon und danach bis 1778 als Pfarrer tätig war.

Abb. 2: Titelblatt recto
Zwei Jahre nachdem das Buch erschienen und verschenkt worden war, hat 1789 eine unbekannte Person auf dem vorderen Vorsatzblatt vermerkt, dass sie die Predigten über die Pfingsten gelesen habe. Zu diesem Zeitpunkt befand sich das Büchlein noch im Besitz Urners, der nach mehreren Jahren als Hauptlehrer im Waisenhaus Zürich 1795 die Stelle als Schulmeister an der Töchterschule in Stäfa antrat. Am 7. Februar 1797 heiratete Johann Jacob Urner in Kilchberg die Lyrikerin Anna Barbara Welti. Die Trauungspredigt hielt der befreundete Lavater, mit dem sowohl Anna Barbara Welti als auch Johann Jacob Urner bereits vor ihrer Ehe in Briefkontakt standen. Kurz darauf wechselte das Büchlein seinen Besitzer. Gemäss einem längeren Eintrag auf dem Vorsatzblatt übergab Urner es anlässlich seines Abschieds aus Stäfa am 3. Juni desselben Jahres einer nicht näher bestimmbaren Anna Barbara Rÿffel.

Abb. 3: Vorsatzblatt recto
Nicht mehr einzuordnen ist der Name Jacob R. auf der Rückseite des Vorsatzblattes und nicht mehr lesbar ist ein schwacher Bleistifteintrag auf der Rückseite des Titelblattes; Einträge, die die Geschichte des Büchleins möglicherweise bis in die Gegenwart fortgesetzt und die Vernetzung mit weiteren Personen fortgeführt hätten ...
Diese Funktion des Buches als Netzwerkträger sowie die Möglichkeit, über den Inhalt hinaus auch dessen eigene Geschichte kennenzulernen, verleiht dem äusserlich schlecht erhaltenen Buch eine persönliche Note und macht es besonders wertvoll und «liebenswert» – nicht nur dem Bibliophilen.
Richard Fasching, Winterthur
Publiés pour la première fois à Venise par Alde Manuce en 1502 et 1503
I
[Sophocle, 497/6 – 406/5 av. JC], Sophoclis Tragaediae [sic] Septem cum Commentariis, Venise, Alde Manuce, août 1502, in-8. Editio princeps en grec
Première édition imprimée de sept tragédies de Sphocle en grec : Sept Tragédies avec commentaires ; Ajax, Électre, Œdipe Roi, Antigone, Œdipe à Colonne, Les Trachiniennes, Philoctète y figurent. Sophocle compose ses tragédies au siècle de Périclès dans le cadre des concours de tragédies des Dionysies. En 468, il remporte une première fois le Prix, devant Eschyle. Rival de ce dernier, puis d’Euripide son cadet, Sophocle créateur endurant, remporte un record de 18 victoires. Des 123 tragédies qu’il a rédigées, l’immense majorité est perdue. 114 titres sont parvenus jusqu’à nous, mais seulement les textes de sept pièces. Antigone (Ἀντιγόνη, 442-1 av. JC) est la première des quatre pièces que Sophocle consacre au cycle thébain (à l’inverse, dans la chronologie de l’intrigue, elle se range en dernier). Une fatalité sanglante frappe les descendants du roi Œdipe. Bravant l’interdit de Créon de donner une sépulture à son frère, Antigone se dresse contre la tyrannie au nom des devoirs familiaux et de valeurs démocratiques. Elle, ses deux frères Étéocle et Polynice, son prétendant Hémon, la mère de celui-ci, Eurydice (reine épouse de Créon), meurent ! Et le Coryphée tire leçon de cet « entêtement qui tue », se lamentant de l’intransigeance obstinée d’un roi et du mal porté à par l’homme à l’homme, de surcroît jouet des dieux. Le chœur collectif de l’« orchestra » perd en importance ; en proportion inverse, chez les protagonistes, psychologie humaine individualisée et interactions interpersonnelles sont approfondies sur la « scène ». Antigone, protagoniste seule, abandonnée, rejetée, en annonce d’autres : Ajax, Électre, Philoctète, Œdipe (dans Œdipe à Colone).

Le défi consistant à réduire et miniaturiser les caractères de typographie grecs des sept grandes tragédies de Sophocle afin de fabriquer un ouvrage au format des « libelli portatile » imposa à l’éditeur imprimeur Alde Manuce (1449-1515) et au maître de taille des poinçons et créateur et fondeur de caractères Francesco Griffo (1450-1518) une prouesse typographique. Venu de Padoue, le maître artisan Griffo avait rejoint l’imprimeur Alde Manuce à Venise dès 1495. La taille des caractères grecs miniaturisés rendait la composition des plus complexes, et le coût de fabrication d’un tel ouvrage était dédoublé par rapport à un ouvrage latin. Il s’agit d’ailleurs du tout premier « libelli portatile » en grec. Établi d'après deux bons manuscrits (l'un provenant de Lesbos, peut-être apporté d'Orient par l’érudit grec Janus Lascaris (éditeur d’Euripide), l'autre de Georgios Korinthios (1485-1555), neveu d'Aristobule Apostolis, collaborateur d'Alde Manuce), le texte a bénéficié des soins d'Alde Manuce lui-même et de ses collaborateurs Johannes Gregoropoulos (le Crétois Ἰωάννης Γρηγορόπουλος) et Scipion Cartéromarque. Il a fait autorité jusqu'au XIXe s. Des manuscrits utilisés par Alde Manuce sont aujourd’hui conservés à Saint Petersbourg (Bibl. pub., Gr. 731) et Vienne (ÖNB, philos-philol. Graec 48). En ouverture de son ouvrage ouvrage, Alde Manuce publie sa « Dédicace à Jean Lascaris » La préface est la première à faire mention à Jean Lascaris et (colophon) à l’Académie créée par Alde, destinée à faire revivre, sous forme conviviale et érudite, culture et langue grecques. Les membres parlaient grec entre eux. La préface décrit les académiciens réunis au coin du feu : Marcus Musurus (Mousouros 1470-1517) fait l'éloge de son maître Janus Lascaris (1445-1535) et exprime sa joie devant les productions d'Alde Manuce diffusées en été 1501 à Padoue et Milan.
II
[Euripide, 480 – 406 av. JC], Euripidis tragoediae septendecim ex quibus quaedam habent commentaria et sunt hae Hecuba, Orestes, Phoenisse, Medea, Hippolytus, Alcestis, Andromache, Supplices, Iphigenia in Aulide, Iphigenia in Tauris, Rhesus, Troades, Bacchae, Cyclops, Heraclidae, Helena, Ion, Venise, Alde, février 1503, 2 vol. in-8. Editio princeps [en grec]

La publication de cet ouvrage représente une avancée décisive dans la renaissance d’Euripide. Les œuvres publiées par Alde Manuce (1449-1515) ont un objectif humaniste et non pas lucratif. Dix-sept tragédies d’Euripide en grec ! Alopa n’avait précédemment publié que quatre tragédies (Florence, 1496). Cette fois-ci, seule Électre manque encore ; tandis que, présente, Rhesus (tragédie consacrée à l’expédition d’Ulysse et Diomède au cœur de Troie) est aujourd’hui considérée comme apocryphe. Le fin helléniste Johannes Gregoropoulos, qui avait déjà supervisée l'édition de Sophocle parue un an avant, s'en occupe également. Artisan exceptionnel, Alde Manuce ouvrit son imprimerie et librairie à Venise en 1494. Il a joué un rôle fondamental dans la diffusion de la culture humaniste en Italie, particulièrement de la littérature de l’Antiquité grecque. Il utilise dans sa carrière quatre fontes typographiques grecques successives (1495, 1496, 1499, 1502), que crée et fond pour lui Francesco Griffo (1450-1518), qui utilise comme modèles les écritures d'érudits grecs réfugiés. Ces caractères cursifs furent imités et supplantèrent des styles d'écriture copiés sur les manuscrits byzantins. Dix-sept tragédies d’Euripide en grec, événement éditorial d’importance exceptionnel, est donc aussi célèbre pour l’élégance de ses caractères aldins gravés en petit italique grec, avec de grands bords blancs dans la mise en page. En ouverture de son ouvrage ouvrage (considéré comme l’une de ses plus belles réussites), Alde Manuce publie sa « Dédicace à Demetrios Chalkokondyles » : il l’adresse et le dédie au professeur d’université, philologue érudit, Démétrios Chalcondyle (1423-1511), l’un des Athéniens qui a le plus contribué à répandre en Italie et en Europe la connaissance et le goût de l’hellénisme littéraire ; il avait supervisé la 1ère édition jamais imprimée d’Homère en 1488-1489.
Jacques Berchtold, Cologny
Andreas Vesal (1514-1564) – Begründer der modernen Anatomie
Er war enttäuscht: Bei diesem Spektakel lerne man weniger als bei einem Metzger: Anatomie-Unterricht hiess im 16. Jh., der Professor trägt von einem erhöhten Platz aus die Schriften des römischen Arztes Claudius Galenus (um 128 – um 200) vor und weist einen Assistenten an, das entsprechende Organ an einer Leiche freizulegen. Vesal übte im Werk Kritik an Galen, der selbst nie ein Hehl daraus gemacht hatte, nur Tierkadaver seziert zu haben. Da Vesal sich selbst Gewissheit über anatomische Einzelheiten verschaffen wollte, holte er sich die Leiche eines Hingerichteten und präparierte das Skelett. In Padua konnte er 1537 seine erste öffentliche Leichenöffnung (Sektion) vornehmen. Wer nahe dabei sein wollte, zahlte ein höheres Entgelt.
Andreas Vesal, lat. Vesalius (eigentlich Andries Witting van Wesel, einer alten Weseler Familie), geboren 1514 in Brüssel, studierte ab 1531 an der Universität Löwen Medizin. Anders als seine Lehrer beschäftigte er für die Sektionen keine Assistenten, sondern legte selbst Hand an; er schnitt die Leichen nicht in der üblichen Weise auf, um an ein Organ zu gelangen, er legte Schicht um Schicht frei.
1543 erschien in Basel (Vesal war erst 28 Jahre alt) bei Johannes Oporinus – einem der berühmtesten und gelehrtesten Buchdrucker und Verleger seiner Zeit – sein Hauptwerk: „De humani corporis fabrica libri septem“ („Sieben Bücher über den Aufbau des menschlichen Körpers“); der Zusatz „libri septem“ weist auf sieben Buchteile hin. Ein monumentales Werk, im Folioformat (319 x 456 mm), mit etwa 663 Seiten und prachtvollen, zum Teil ganzseitigen 239 Tafeln, die neue technische Qualitätsmassstäbe für anatomische Illustrationen, ja für die Buchillustration überhaupt aufstellten, unter anderem drei ganzseitige Skelettdarstellungen; 14 Holzschnitte von Muskeln usw. Viele dieser Holzschnitte wie auch Initialen sind koloriert. Der Text ist in einer Antiqua gesetzt; mitunter werden auch griechische sowie hebräische Typen verwendet.
Darin fasst Vesal seine Erkenntnisse über den menschlichen Körper zusammen, zollt Galen Respekt, weist ihm aber zahlreiche Fehler nach. Da er annimmt, das Werk sei für eine grosse Leserschaft zu umfangreich, publizierte er wenig später eine Kurzfassung („Epitome“ ["Auszug“]); es wurde in kurzer Zeit zum Standardwerk von Studenten und Medizinern. Nach Erscheinen der „Fabrica“ 1543 wurde Vesal Leibarzt von Karl V., dem er das Werk gewidmet hatte.
Die Holzschnitte, von denen man heute annimmt, dass Tizian deren 17 ganzseitige gestaltete, wurden in Venedig geschnitten und dann über die Alpen, zusammen mit den Probeabzügen, nach Basel transportiert. Die Zeichner und Holzschneider waren damals nicht personengleich: Es bestand eine Arbeitsteilung, indem der Zeichner auf den Holzstock die Zeichnung aufriss und der Holzschneider anschliessend den Schnitt ausführte.
Vesal kam 1543 nach Basel und hielt ein anatomisches Kolloquium ab. Das dabei von ihm präparierte sog. „Vesalsche Skelett“ eines geköpften Verbrechers ist erhalten und bildet das älteste Stück der anatomischen Sammlung der Universität Basel.
In der grossen Anzahl anatomischer Abhandlungen des 16. Jhs. war Vesalius‘ Werk das prächtigste und umfassendste. Die 2. Auflage von 1555 verwendete die gleichen Tafeln wie die erste, enthielt jedoch geringfügige textliche Abweichungen; typographisch gestaltet nach einem Entwurf des berühmten französischen Schriftsetzers Claude Garamond. Das Werk wurde immer wieder übersetzt, neu herausgegeben, kopiert und plagiiert, und seine Illustrationen wurden bis zum Ende des 18. Jhs. in anderen medizinischen Publikationen verwendet oder nachgeahmt.
Der Leibarzt von Kaiser Karl V. und Philipp II. von Spanien unternahm 1564 eine Pilgerreise nach Jerusalem; auf der Rückreise erkrankte er und starb. Legenden um seinen frühen Tod brachten ihn mit der Inquisition in Verbindung; er soll aus Versehen einen Menschen bei lebendigem Leib seziert haben und sei zur Strafe verpflichtet worden, ins Heilige Land zu reisen.
Nach dem Tod von Oporinus 1568 sind die Stöcke vermutlich in den Besitz des Verlegers Froben in Basel gelangt. Was nachher geschah, ist unklar. Um das Jahr 1933 entdeckte man die Holzstöcke in einem Speicher der Universitätsbibliothek München. 1934 erfolgte ein Druck mit den Originalholzstöcken bei der Bremer Presse („Die Königin der deutschen Privatpressen“) in München in einer Auflage von rund 700 Exemplaren. Die Werkstätten der Bremer Presse wurden im Juli 1944 bei einem alliierten Bomberangriff zerstört und damit auch die Holzstöcke.
Andreas Vesalius: „De Humani Corporis Fabrica Libri Septem“. Johannes Oporinus, Basel 1543.
Auf der Plattform https: www.e-rara.ch ist die Erstausgabe von 1543, die in der Universitätsbibliothek Basel liegt, digitalisiert vorhanden und kann aufgerufen werden. Das Exemplar ist in guter Verfassung und enthält viele kolorierte Tafeln sowie zusätzliche Blumen-Darstellungen und Ornamente. Die diesem Text beigefügten Illustrationen stammen von dieser Plattform. Die Legenden stützen sich auf den elektronischen Katalog „De Humani Corporis Fabrica“ der Universitätsbibliothek Klagenfurt.
Eduard R. Fueter, Au ZH
Abbildungen

Abb.1: Das Titelblatt zeigt eine gut besuchte öffentliche Anatomiestunde. Die architektonische Kulisse erinnert an die „anatomischen Theater“ der medizinischen Hörsäle der Zeit. Oben das Familienwappen mit den drei Wieseln. Auf einem schmalen Podest steht Vesal in der Bildmitte neben einem weiblichen Leichnam. Er erläutert den Uterus, die linke Hand dozierend erhoben, die rechte fährt mit einem Skalpell in die eröffnete Bauchhöhle. Auf dem Tisch Stift, Tintenfass, Schwamm, Skalpell, Rasiermesser und eine Kerze. Die Zuschauer, u.a. Kleriker, drängen sich dicht heran, zwei mit Brille und Monokel bewehrt. Den Ehrenplatz in der Mitte nimmt nicht ein dozierender Professor ein, sondern ein auf der Brüstung sitzendes Skelett: Vesals Hinweis auf die Bedeutung der Osteologie als Grundlage der Anatomie.

Abb. 2: Porträt von Andreas Vesal beim Sezieren. Die Muskeln des Präparates sind ab etwa der Hälfte des Oberarms freigelegt; auf dem Tisch ein Rasiermesser, ein Skalpell, ein Tintenfass und ein Schriftstück mit dem Text „De musculis…“ Die Inschriften am Tischrand weisen auf Vesals Alter AN[NO] AET[ATIS] XXVIII und die Datierung M.D.XLII: mit 28 Jahren, im Jahr 1542. Die Zeile darunter zitiert das Motto des Asklepios, wie Patienten zu behandeln seien: OCYUS, IUCUNDE ET TUTO: schnell, freundlich und sicher.

Abb. 3: Vorwort, S. A1, mit Initiale „O“: Decoction: Auskochen eines Schädels und eines Oberschenkelknochens; eingerahmt von Ranken und Drachen.

Abb. 4: Diese Darstellung (S. 184) ist in der Folge häufig übernommen worden: Das Skelett, einen Schädel in der Hand haltend, sinniert über den Tod. Die Haltung wie auch die Inschrift auf dem Grabstein „VIVITVR INGENIO, CAETERA MORTIS ERVNT“ (Der Geist wird leben, das Übrige ist des Todes) und die Landschaften im Hintergrund schaffen insgesamt eine Memento-Mori-Allegorie.

Abb. 5: Nach Vorlagen von Vesal schuf Jan Stephan van Calcar (1499 – 1546) die mehr als 300 Illustrationen. Der Detailreichtum, die Proportionen des menschlichen Körpers und die oft allegorische Darstellung auf landschaftlichen Hintergründen weisen auf die Tizian-Schule hin. Die Muskelmänner-Holzschnitte wurden massenhaft plagiiert, was in der Folge zur Kanonisierung der Bilder führte. 200 Jahre lang galten die Vesalschen Anatomiedarstellungen als Referenzgrössen. Die originalen Druckstöcke wurden immer wieder eingesetzt, zum letzten Mal 1934 in München.

Abb. 6: Schluss der Handschrift.
mit Illustrationen von Hansjörg Brunner
«Wer kennt sie nicht, die «Schwarze Spinne» von Jeremias Gotthelf. Nirgends hat Gotthelf mit solcher Wucht menschliche Überhebung und ihre Bändigung durch Gottes Hand dargestellt wie in der «Schwarzen Spinne». Die Fabel ragt als gewaltiges Gemälde von Masslosigkeit und Frevel, Angst und Versagen, Glaubenskampf und Kultur aus der ein ländliches Tauffest schildernden Rahmenerzählung. Da sind der gewissenslose Komtur, der von seinen leibeigenen Bauern unerhörten Frondienst fordert, das verwegene Weib, das Abhilfe schaffen will und vor dem Pakt mit dem Teufel nicht zurückschreckt, der glaubensstarke Priester, der dem Bösen seine Beute entreisst, die verblendeten Bauern, die in kurzsichtigem Übermut erst über den geprellten «Grünen» triumphieren, dann in schändlichem Einverständnis dem Teufel eine Kinderseele überantworten, um ihr eigen erbärmlich Leben zu retten. Und da ist die schwarze Spinne, das Böse, das schwelend Böses zeugt und zur verheerenden Heimsuchung wird, bis eine gläubige Opfertat reiner Nächstenliebe den Urfeind bannt.»
So führte mein Vater 1968 in die Fabel ein, die 1968 im Schaer Verlag in Thun, wunderbar illustriert mit 36 Linolschnitten von Hansjürg Brunner, erschien.

Linoldruck: Spinne mitten in der Menge.
Gerade in einer solch ruhigen Zeit lohnt sich, diesen Klassiker wieder einmal zur Hand zu nehmen und sich in die Sprache Gotthelfs zu vertiefen. Dazu kommen die eindrücklichen, sehr expressiven Linolschnitte von Hansjürg Brunner, welche die Stimmung der Fabel in wunderbarer Weise aufnehmen und uns in Bann ziehen. Kaum ein Schweizer Künstler hat die Druckkunst in verschiedenen Medien so beherrscht wie Hansjürg Brunner (1942 -1999). In seinem Atelier in Jegenstorf lehrte er seinen Schülern den Umgang mit den verschiedenen Drucktechniken und es entstanden Künstlerdrucke von Berner Künstlern, so Kaltnadelradierungen von Bernhard Luginbühl oder Jean Tinguely. Zusammen mit Eberhard W. Kornfeld, dem Berner Galeristen und besten zeitgenössischen Kenner Rembrandts, druckte er jahrhundertealte Platten in hervorragender Qualität. Sein früher Tod verhinderte eine internationale Karriere, für die er prädestiniert gewesen wäre. Das Buch ist ein Genuss für jeden Freund einer schön illustrierten und gestalteten literarischen Kostbarkeit.
Alex Rübel, Zürich
Jeremias Gotthelf „Die Schwarze Spinne». Mit 36 Illustrationen von Hansjörg Brunner. Signierte Vorzugsausgabe mit einem Linolschnitt in den ersten 100 Exemplaren der Auflage von 1'500. Erschienen im Mai 1968 im Schaer Verlag Thun.
Ernst Kreidolf (1863 Bern - 1956 Bern) ist in der Schweiz, aber auch in Deutschland, wo er mehr als dreissig Jahre lang lebte und arbeitete, als Maler und vor allem als Bilderbuchkünstler bis heute bekannt und beliebt. Mit seiner an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert erschienenen Büchern Blumen-Märchen (1898), Die schlafenden Bäume (1901) und Gartentraum (1911) setzte er neue, wegweisende Massstäbe in der Bilderbuchgestaltung. Aber auch später entstandene Werke, unter anderem Blumen. Ritornelle (1920), Alpenblumenmärchen (1922), Lenzgesind (1926), Bei den Gnomen und Elfen oder Die 12 Blumen-Monate (beide 1929), in denen primär personifizierte Pflanzen die Hauptrolle spielen, zählen zu den unvergessenen Bilderbuchklassikern. Aus seinen Illustrationen des Berner Schullesebuches Röti Rösli im Garte das erstmals 1925 erschien und zwei weitere Auflagen erlebte, sollten sich seine phantasievollen Schöpfungen dem Bildgedächtnis von Generationen Schweizer Kinder nachhaltig einprägen.
Zwischen Naturbeobachtung und Fantastik
Ernst Kreidolf lebte seit 1868 auf dem Hof seiner Grosseltern in Tägerwilen, Thurgau und war daher von Kindheit an mit der heimischen Flora und Fauna vertraut. Bereits seine Jugendzeichnungen zeugen von genauer Beobachtungsgabe und seinem Einfühlungsvermögen in das jeweilige Wesen einer Pflanze. Dieses Wissen war der Ausgangspunkt für die spätere «Vermenschlichung» seiner Bilderbuchgestalten. Daneben bildete das akribische Studium der Natur stets die Grundlage von Ernst Kreidolfs vielseitigem künstlerischen Schaffen. Gärten und Wiesen, Berge und Wälder, die Kreidolf zeitlebens gern durchwanderte, bilden die Hintergrundkulisse für das fantastische Treiben von Elfen, Zwergen und Insekten.
Kreidolfs Kleinode im Kunstmuseum
Im begleitenden, reich bebilderten Band zur Ausstellung «Wachsen – Blühen – Welken. Ernst Kreidolf und die Pflanzen» nehmen die Beiträge nun die Pflanzendarstellungen des Künstlers in unterschiedlichen Formaten unter die Lupe. Dabei orientieren sich die Beiträge primär an Kreidolfs Bilderbüchern, seinen Blumen-Gedichten, Mappenwerken und Schulbuchillustrationen wodurch sich nicht nur eine zeitliche Abfolge ergibt, sondern auch die sich im Laufe der Zeit vollziehenden stilistischen Veränderungen anschaulich werden.
Die Ausstellung entstand in Zusammenarbeit von Verein und der Stiftung Ernst Kreidolf mit dem Kunstmuseum Bern sowie der Städtischen Wessenberg-Galerie Konstanz, wo sie nach dem Kunstmuseum Bern (bis 10. Januar 2021) von 29. Januar bis 11. April 2021 zu sehen sein wird.
Anna Lehninger, Zürich
Wachsen – Blühen – Welken. Ernst Kreidolf und die Pflanzen, hrsg. von Barbara Stark für den Verein Ernst Kreidolf, mit Texten von Marisa Fadoni-Strik, Anna Lehninger, Barbara Stark, Roland Stark, Marianne Wackernagel, Sibylle Walther, Ausstellungskatalog Kunstmuseum Bern / Städtische Wessenberg-Galerie, Konstanz, Petersberg: Michael Imhof Verlag, 2020.
ISBN 978-3-7319-1025-1.
120 Seiten, zahlreiche Abbildungen, Hardcover
An der Museumskasse 28 CHF bzw. 20 Euro
Im Buchhandel ca. 29,95 Euro (D), ca. 30,80 Euro (A), ca. 34,40 CHF
Weitere Informationen
https://www.imhofverlag.de/buecher/ernst-kreidolf-und-die-pflanzen/
In dieser bemerkenswerten Handschrift mit zahlreichen Wappenmalereien sind mehr als 900 Sponsoren und rund 3300 Geschenke verzeichnet. Gelehrte, Politiker, Händler, Flüchtlinge und Diplomaten schenkten der 1629 gegründeten Stadtbibliothek Zürich Objekte, Geld und vor allem Bücher. Als Dankeschön wurden die Sponsoren mit einem Eintrag im Donatorenbuch verewigt. Die Einträge, meistens mit einem Hinweis auf den Stand des Donators und oft auch mit dem Familienwappen, reichen von 1629 bis ins Jahr 1772. Der erste Hauptteil enthält die Schenkungen von 215 ausländischen Donatoren in chronologischer Ordnung, gefolgt vom umfangreicheren zweiten Hauptteil mit mehr als 700 Zürcher Donatoren in alphabetischer Reihenfolge.

Abb. 1
An erster Stelle und mit einem prächtigen Adelswappen verziert steht der Eintrag des französischen Sondergesandten und hugenottischen Militärführers Henri de Rohan (1579–1638), welcher der Stadtbibliothek im September 1632 eine hebräische Bibelhandschrift zukommen liess. Nicht nur französische, sondern auch englische, venezianische, holländische und schwedische Diplomaten sind mit ihren Buchgeschenken im Donatorenbuch verzeichnet. Geschenke waren in der frühneuzeitlichen Diplomatie keine freiwillige Geste, sondern gehörten zu den Pflichten der Gesandten.

Abb. 2
Auch bei den Zürcher Donatoren sprechen zahlreiche Hinweise dafür, dass die Geschenke nicht so sehr freiwillige Gaben waren, sondern allgemein als eine Pflicht verstanden wurden. Ganz offensichtlich ist dies der Fall bei den Geschenken, welche die ehrenamtlich tätigen Mitglieder des Bibliothekskollegs bei einer Beförderung im Staats- oder Kirchendienst machten, denn die Statuten verlangten in solchen Fällen ausdrücklich eine Gabe. Der Staatsmann Hans Jakob Haab (1601–1682) zum Beispiel engagierte sich als Kurator und später als Beisitzer (Consiliarius) für die Stadtbibliothek und schenkte wiederholt bei Antritt einer neuen Amtsstelle Bücher oder Geld.
Auch Zürcher, die nicht diesem Gremium angehörten, machten der Stadtbibliothek Geschenke. Johannes Volmar (1613-1676) etwa gab 1634 einen Geldbetrag und eine grosse Sanduhr. Volmar entstammte einem alten Henkergeschlecht, arbeitete jedoch nicht im Beruf seiner Familie, sondern als Wundarzt. Da er 1634 von den Makeln des unehrlichen Berufs seiner Familie offiziell befreit wurde, kann sein Geschenk als eine Erkenntlichkeit für die erfolgte Liberation gedeutet werden. Als ihm später die Namensänderung zu Steinfels bewilligt wurde, passte der Bibliothekssekretär auch noch den alten Eintrag im Donatorenbuch an.

Abb. 3
Viele Buchgeschenke können im Rahmen einer „Ökonomie des Gabentauschs“ betrachtet werden. Denn die Donatoren drückten mit ihren Geschenken oft ihre Dankbarkeit gegenüber dem Staatswesen aus, von dem sie selbst profitierten. Sie nahmen die Stadtbibliothek als einen Teil des Staatswesens war. Die Devise »Arte et Marte« im Bibliothekswappen bringt zum Ausdruck, dass die Stadtbibliothek eine wichtige Schutzfunktion hatte: durch Wissenschaft und Waffen sollte das reformierte Gemeinwesen verteidigt werden.
Das Donatorenbuch ist digitalisiert und als elektronische Edition auf der Plattform e-manuscripta zugänglich: http://doi.org/10.7891/e-manuscripta-45784. Die elektronische Edition enthält biographische Angaben zu den Donatoren, die geschenkten Titel sind bibliographisch identifiziert und die überlieferten Exemplare sind mit dem aktuellen Standort in der Zentralbibliothek Zürich nachgewiesen. Das prachtvolle Buch ist heute eine interessante Quelle für die Bibliotheks- und Museumsgeschichte sowie für die Provenienzforschung.
Christian Scheidegger, Zürich
Literaturhinweis:
Christian Scheidegger, Das Donatorenbuch der Stadtbibliothek Zürich, in: Librarium 60/1 (2017), S. 2-22.
Otto van Veen, geboren 1556 in Leiden, reiste und studierte fünf Jahre lang in Italien und ließ sich 1592 in Antwerpen als Maler nieder. Einer seiner Schüler war niemand geringerer als Rubens. Allmählich wandte er sich mehr der grafischen Technik zu. Von 1615 bis zu seinem Tode 1629 lebte er in Brüssel. Van Veen war humanistisch gebildet, und die Kenntnisse der antiken Autoren flossen in seine Werke ein.
Berühmt sind seine Emblembücher: »Amorum emblemata« (1608) und »Amoris divini emblemata« (1615). Die Kupfer in diesen Werken stammen von Cornelis Boel (ca. 1576 – ca. 1621). Hier sei kurz ein weiteres vorgestellt:
Q. Horatii Flacci emblemata. Imaginibus in æs incisis, notisque illustrata, studio Othonis Vænii, Batauolugdunensis. Antverpiæ ex officina Hieronymi Verdussen 1607.
Hat die Kupfer sein Bruder Gijsbert van Veen (1558–1628) verfertigt? Jedem Bild (auf der rechten Seite) sind mehrere Zitate aus der antiken Literatur (neben Horaz auch Ovid, Seneca, Sallust, Terenz, Juvenal, Cicero, Valerius Maximus und weitere) links gegenübergestellt.
Einer Ausgabe mit lateinischen Texten folgte eine, in der französische und niederländische Übersetzungen beigegeben waren; 1612 wurden sie mit spanischen und italienischen Versen ergänzt.
Dann erschien eine französische Ausgabe mit ausführlichen Prosakommentaren und Vers-Zugaben von Marin Le Roy sieur de Gomberville (1600–1674): La doctrine des moevrs, tiree de la philosophie des stoiques, representee en cent tableavx et expliqvee en cent discovrs pour l’instruction de la ieunesse, Paris, Imprimerie de Lovys Sevestre 1646. Im Gegensatz zu den früheren Auflagen sind hier die lateinischen Zitat-Stellen auf zwei bis drei reduziert, und die Reihenfolge der Kapitel ist umgestellt. – Die Kupfer sind (gekonnte!) seitenverkehrte Kopien derjenigen von 1607.
1656 erschien dann eine Ausgabe, die der zeitgenössisch viel beachtete Dichter Philipp von Zesen (1619–1689) mit kurzen Gedichten (vierzeilige Alexandriner und achtzeilige vierfüßige Jamben) und dem ins Deutsche übersetzten französischen Kommentar versah. Die Reihenfolge der Ausgabe 1646 ist übernommen.
Moralia Horatiana: Das ist Die Horatzische Sitten-Lehre / Aus der Ernst‑sittigen Geselschaft der alten Weise-meister gezogen / und mit 113 in kupfer gestochenen Sinn‑bildern / und ebenso viel erklärungen und andern anmärkungen vorgestellet: Itzund aber mit neuen reim‑bänden gezieret / und in reiner Hochdeutschen sprache zu lichte gebracht durch Filip von Zesen. Gedrukt zu Amsterdam/ Auf kosten Kornelis Dankers / durch Kornelis de Bruyn / im 1656 Heil–jahre.
Winzige Details lassen vermuten, dass nicht die Platten von 1646 übernommen, sondern neue Kopien der Bilder von 1607 angefertigt wurden. Die Platten sind auch unten größer und enthalten dort eingraviert den lateinischen Motto-Text. Hier sind zwei Kupferstiche (Erster Teil, Nr. 21; 23) mit A[rnold] Loemans sculp Amstel[odami] (südniederländ. Kupferstecher; fl. 1632–1656) signiert; einer mit A: Seil sculp: (Zweiter Teil, Nr. 2). Über diese Künstler weiß die gängige Fachliteratur (Thieme / Becker u.a.) nichts Genaues.
Der Aufbau einer Doppelseite jeweils: Links die lateinischen Zitate; darunter in Prosa die Erklährung der entsprechenden Bild‑ und lehr‑tafel. Rechts das Bild (Größe 9 bis 10 x 11 bis 13 cm), und darüber (typographisch gesetzt) das deutsche ›Motto‹ (auch ›Lemma‹ in der Terminologie der modernen Emblemforschung); das Kupfer enthält das Motto auf lateinisch; darunter das ›Epigramm‹ (auch: ›Subscriptio‹) auf deutsch in Versform.
Erstes Beispiel (Erster Teil, Nr. 29)
Grande malum invidia — Mißgunst ist der liebe tod.
Gezeigt ist die Personifikation der Invidia (des Neids): eine abgezehrte, beinah nackte Frau mit Schlangenhaaren, die ihr eigenes Herz isst. Als Vorbild kommen in Frage: der Holzschnitt des Petrarcameisters aus dem Buch »Von der Artzney bayder Glück / des guten vnd widerwertigen«, Augsburg: Steiner MDXXXII (2.Buch, Kapitel CVI) oder die Beschreibung bei Cesare Ripa, »Iconologia«, Rom 1593: INVIDIA: Donna, vecchia, brutta, e pallida, il corpo sia asciutto, con gli occhi biechi, vestita del colore della ruggine, sarà scapigliata, e frà i capelli vi saranno mescolati alcuni Serpi, stia mangiando il proprio cuore, il quale terrà in mano.
Im Hintergrund ist die (in der antiken Literatur oft erwähnte) Szene dargestellt, wo Perillus in den glühenden Stier gesteckt wird: Perillus, der für den Tyrannen Phalaris in Agrigent einen ehernen Stier mit hohlem Leibe ausheckte und verfertigte, in den Verbrecher gesteckt und durch untergelegtes Feuer gebraten werden sollten. Der Künstler wurde vom Tyrannen genötigt, zur Probe selbst in den Stier zu kriechen, und kam so ums Leben.

Der Horazvers stammt aus Epistel Lib. I, epist. 2, Vers 57f: Invidus alterius macrescit rebus opimis […]: Der Neidische magert angesichts der fetten Güter eines anderen ab. Die grausamste der Martern, die ein Phalaris erfand, reicht an die Pein des Neides nicht heran. So versteht man die Verse von Zesen:
[…] Wer seines freundes glük mit neides‑augen siehet /
der fühelt größre pein / als den die gluth alhier
verzehrt und brüllen macht im selbst-erfundnen stier.
Aus der Erklärhung: Wan man aber dieses so abscheuliche/ so fressende misgünstige ungeheuer ansiehet/ das aus angebohrner feindlichen unart und unmenschligkeit ihm selbsten das hertz naget/ wan es sonsten mit nichts anders sein wühten ersättigen kan; so mus man bekennen/ daß es die allergrausamste und erschröklichste unter allen straffen sei.
Zweites Beispiel (Erster Teil, Nr. 49)
Das Kapitel steht in einer Reihe zum Thema ›Geld beherrscht alles‹. Motto: Wo es gold regnet / ist kein dach zu dichte.
Das Horaz-Zitat stammt aus dem 3. Buch der Oden, Nr. 16: Inclusam Danaen turris aenea […] munierant satis, si non […]: Die eingesperrte Danaë hätten der Turm aus Erz, ein kräftiges Tor und das grimmige Lauern wachsamer Hunde ausreichend vor nächtlichen Liebhabern verwahrt, hätten nicht Venus und Jupiter den Acrisius [das ist der Vater von Danaë, der sie eingesperrt hat] genarrt: Sie wussten, dass dem Gott der Zugang frei werde, wenn er sich in Gold verwandle. [Jupiter schwängert Danaë bekanntlich in Gestalt eines Goldregens.] Aurum per medios ire satellites et perrumpere amat saxa: Gold pflegt mitten durch jede Leibwache zu gelangen und Steine zur durchdringen.

Im Hintergrund ist Danaë im Goldregen zu sehen; die Hauptszene ist eine allegorische Umsetzung des Gedankens, der im Epigramm formuliert ist:
Gold dringt durch stahl und eisen hin /
schlägt mauren / wall und turn zu trümmern;
das schlos springt auf nach unsrem sin /
wan güldne schlüssel vor ihm schimmern.
Gold macht / daß niemand stand-fest ist /
ein weiser die vernunft vergisst /
das Recht die pflicht / der mensch die lehre
die wacht ihr amt / die frau ihr’ ehre.
Drittes Beispiel (Zweiter Teil, Nr. 19)
Otto von Veen ist keineswegs moralinsauer. Als humanistisch Gebildeter kennt er auch die freudvollen Seiten des Lebens. Dass der Wein Kraft spendet und das Leid abwendet, belegt er aus drei Horaz-Stellen – manchmal vermutet man, er habe eine Anthologie verwendet:
Oden Buch, I, Nr. 8, Verse 15ff.: So wie oft der Südwind (Notus) die Wolken wieder vom verdüsterten Himmel fegt und nicht Regen bringt für alle Zeit, so sei auch du vernünftig und setze deinem Kummer und dem Leid mit mildem Wein (molli mero) ein Ende.
Oden I,18: Für den Nüchternen hat der Gott alles Harte bestimmt […]. Wer schwatzt nach dem Weingenuss vom harten Waffendienst oder von der Armut?
Epoden Nr. 13.: omne malum vino cantuque levato – Lindere alles Übel mit Wein und Gesang!

Der wein behertzt des Weisen hertz — Ex vino sapienti virtus.
Im Bild bläst der Südwind; Minerva selbst kredenzt dem Weisen den Wein, der die Sorge (mit umgedrehter Fackel mit erlöschender Flamme, vgl. Schiller, »Der Genius mit der umgekehrten Fackel«) beiseite schiebt.
Viertes Beispiel (Zweiter Teil, Nr. 31)
Das Buch schließt mit einer Reihe von Emblemen zum Thema ›Der Tod herrscht über alles‹. Mitten in den Warnungen vor der flüchtigen Zeit bekommen die Senioren noch eine Chance: Das alter hat mancherlei nutzen.

Der bärtige Greis mit Brille kann von Chronos mit der Sichel nicht recht bedroht werden, weil er sie falsch hält; die Lustbarkeiten der Jugend fliehen; Temperantia zeigt ihm zwar das Zaumzeug, aber er hat wohl keinen Bedarf mehr, seine Triebe zu zügeln, auch wenn er von einer jungen Dame liebevoll betastet wird.
Wan leibes-augen alt und dunkel /
fängt des gemühtes aug’ erst licht /
und strahlet gleich als ein karfunkel.
dan wird am schärfsten fein gesicht.
Als dan erkännt man in der taht
was bös’ und guht / was schand und tugend.
so giebt das alter uns den raht /
den uns zuvor versagt die jugend.
Die Techniken der Bebilderung
Otto van Veen geht in seinen Ausführungen auch über die in den Zitaten angelegten Gedanken hinaus. Einiges versteht man nur, wenn man auf die ganzen Texte zurückgreift; sodann verwendet er immer wieder weitere Elemente aus der antiken Literatur und Ikonographie.
In der Emblematik wurden (insbesondere seit dem grundlegenden Buch von Andrea Alciato 1531) verschiedene Techniken verwendet, um Aussagen in Bilder zu transformieren bzw. diese lesbar zu machen. Im Buch von van Veen fällt auf, dass er keine Allegoresen von Naturdingen (z. Bsp. Tiere, Pflanzen, Mineralien) verwendet und keine Allegorien artifiziell konstruiert. Einige Techniken seien hier angedeutet:
- Personifikation, d.h. die Eigenschaften eines abstrakten Begriffs (hier das Beispiel der Invidia I,29) werden an einem menschlichen Wesen demonstriert; vgl. auch das böse Gewissen (II,12).
- Exemplum, d.h. ein historisches Geschehen wird als Beispiel für das zu Erläuternde genommen (hier das Beispiel des Perillus I,29); weitere Beispiele: Damokles I,41; Aeschylus wird von der Schildkröte erschlagen (II,33); Diogenes im Fass (I,14); der geduldige Sokrates (II,11).
- Allegorische Weiterführung einer Metapher (hier: das Gold [des Jupiter] durchbricht die Mauer I,49); weitere Beispiele: die Seele ist zu reinigen wie das Weinfass, bevor man es füllt (I,4); Gleichnis von Splitter und Balken (Lukasevangelium 6,41 in I,27).
- Der Typus eines charakteristischen Menschen (hier der Greis II,31); weitere Beispiele: der glückliche pflügende Bauer (I,33); die Wollüstigen (I,36).
- Mythologische Erzählungen; Beispiel: Philemon und Baucis (I,32).
Es wäre ein interessantes Forschungsvorhaben, dies im Detail auszuführen.
Weiterführende Überlegungen und Literaturhinweise zur Emblematik hier: www.symbolforschung.ch/Embleme.html
Digitalisate des Werks
Das Werk ist digitalisiert mehrfach zugänglich.
Die Ausgabe 1607:
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/veen1607
Die fünfsprachige Ausgabe von 1612:
https://archive.org/details/quintihoratiifla12veen
https://emblems.hum.uu.nl/va1612.html
Doctrine des mœurs 1646:
https://archive.org/details/ladoctrinedesmur00gomb
Die beiden Bände der Zesen-Fassung von 1656:
http://diglib.hab.de/wdb.php?dir=drucke/lo-8306-1
http://diglib.hab.de/wdb.php?dir=drucke/lo-8306-2
Paul Michel, Zürich
«Erschröckliche newe Zeitungen» und «unerhörte Wunderzaichen» — Die Einblattdrucke der «Wickiana» der Graphischen Sammlung der Zentralbibliothek Zürich
Allerlei Wundersames und Schreckliches weiss die Bildersammlung des Johann Jakob Wick (1522-1588), «Wickiana» genannt, über Ereignisse des 16. Jahrhunderts in ganz Europa zu berichten: Himmelserscheinungen, die als göttliche Zeichen gedeutet wurden, «Wundergeburten», Fehlbildungen bei Pflanzen, Tieren und Menschen sowie grausame Verbrechen und deren nicht minder grausame Bestrafung – um nur einige Themen zu nennen – sind hier nachzulesen und im reichen Bildschmuck der Einblattdrucke farbenprächtig anzusehen. Über Jahrzehnte hinweg hat der Zürcher Chorherr Wick in 24 Folianten (heute in der Handschriftensammlung) unermüdlich zusammengetragen und -geschrieben, was in den Flugblättern seiner Zeit an Neuigkeiten verfügbar war und ihm aus allen Richtungen zugetragen wurde. Diese Blätter, die später wieder aus den Bänden herausgelöst wurden, erfüllten ganz unterschiedliche Zwecke: Sie informierten über aussergewöhnliche Himmelserscheinungen, die einerseits fantastischen Ursprungs scheinen, wie kämpfende Rosse (Abb. 1) oder über andere seltsame Wolkenformationen. Andererseits berichteten sie von wissenschaftlich nachweisbaren Phänomenen, wie Lichterscheinungen, die heute als Nordlichter erklärbar sind, oder von dem 1577 erschienenen Grossen Kometen, den auch Tycho Brahe beobachtete und beschrieb (Abb. 2). Sie bedienten die Sensationslust, wenn über Mord und Totschlag berichtet wurde und im selben Bild auch – oftmals die Leserichtung umher wendend – die blutige Sühnung von Verbrechen ausgiebig geschildert wurde.

Abb. 1 (alle Legenden siehe unten)

Abb. 2
Eine reiche und mannigfaltige Wunderchronik
Der Historiker Franz Mauelshagen nannte Wicks Sammlung «die größte Wunderchronik des sechzehnten Jahrhunderts, vielleicht die umfangreichste im ganzen frühneuzeitlichen Europa.» (Franz Mauelshagen, Wunderkammer auf Papier. Die «Wickiana» zwischen Reformation und Volksglaube, Tübingen 2011, S. 13.) Ricarda Huch hatte bereits 1895 im Neujahrsblatt der Stadtbibliothek Zürich und viele Jahre später in einem postum veröffentlichten Beitrag in der Kulturzeitschrift Atlantis auf ihre Einzigartigkeit hingewiesen. «Wenn die am meisten den eigentlichen Zeitungen vergleichbaren, von den grossen Handelsmetropolen aus verbreiteten Tagesnachrichten kurze, trockene Mitteilungen des Geschehenen sind, so tragen dagegen die Wickschen Blätter den Charakter des Persönlichen.» (Ricarda Huch. S. 580: Die Wicksche Sammlung von Flugblättern und Zeitungsnachrichten in der Stadtbibliothek Zürich, in: Atlantis. Länder – Völker – Reisen, Heft 12, 1960, S. 580-587, hier S. 583) Mit diesen zwei Stimmen sind nur zwei Eckpunkte der reichen Fachliteratur markiert, die es bereits zu der Wickiana gibt, doch längst nicht alle Aspekte dieser «reich(en) und mannigfaltig(en)» Bildersammlung (Huch 1960, S. 580) sind erforscht. Die umfängliche elektronische Verfügbarkeit der Bilder macht noch vieles möglich.
Beten gegen den Papst
Die Bandbreite der enthaltenen Themen der Wickiana lässt sich kaum fassen, bestenfalls umreissen: So wurde die reformierte Leserschaft zu festem Glauben und Bussfertigkeit angehalten. In ausführlichen Pamphleten wurde die reformierte Leserschaft gegen den Papst zu festem Glauben und Bussfertigkeit angehalten und in heute noch bekannten Porträts wurden die Helden der Reformation gefeiert, von Jan Hus und Martin Luther über Ulrich Zwingli, bis zu Heinrich Bullinger, mit dem Wick wohl in sehr engem Kontakt stand, da er als Zweiter Archidiakon einer seiner Stellvertreter war. Auch half Bullinger Wick durch seine internationalen Kontakte entscheidend beim Aufbau der Einblattdruck-Sammlung und zeichnete auch für die eine oder andere handschriftliche Notiz auf einem Blatt verantwortlich.

Abb. 3
Besonders eindrücklich wird das Eindringen der Wissenschaft in die Alltagswelt nachgezeichnet: Naturwunder, vor allem bei Pflanzen, die übermässig Früchte trugen (Abb. 3), oder Fehlbildungen an Mensch und Tier wurden je nach darstellerischem Können detailliert abgebildet und im Begleittext beschrieben. Gestrandete Pottwale aus Flandern überliefern, einer gedruckten Wunderkammer gleich, den damals aktuellen Wissensstand über diese Tiere (Abb. 4) und Darstellungen fremder Völker wie der Inuit erweiterten den mitteleuropäischen Bild- und Geisteshorizont bis weit in den Norden (Abb. 5).

Abb. 4

Abb. 5
Fastenwunder und Mordkomplotte
Heute in ganz anderem Licht wie damals erscheinen die zahlreichen Hexenverbrennungen und der unterschwellige bis direkte Antijudaismus, der aus einigen Blättern spricht. Die Berichte von «Fastenwundern» junger Mädchen würde man heute eher als Formen der Magersucht deuten und die grauenvollen Bestrafungen von Mördern, Seeräubern und anderen Verbrechern jagen wahre Schauer über den Rücken. Gleichzeitig beeindruckt die künstlerische Qualität der Bilder, wobei aus der allgemein meist schlichten Holzschnittkunst mit oftmals grober Schablonenkolorierung einzelne besonders hervorstechen. Künstler wie Tobias Stimmer schufen ikonische Darstellungen wie das bekannte Porträt von Heinrich Bullinger (Abb. 6). Anonym gebliebene Meister beeindrucken aber ebenso durch ihre Kunst, wenn beispielsweise in einer äusserst dynamischen Bildkomposition gleichzeitig eine Wöchnerin als Anstifterin zum Mord an ihrem schlafenden Gatten der die Tat ausführenden Magd die Kerze hält, während im Hintergrund in einem Bild eine Richtstätte dargestellt wird, wobei offen bleibt, ob hier die Sühnung des Verbrechens als sinnbildliches Gemälde an der Wand vorweggenommen wird oder als Blick aus einem Fenster schon im Sinne einer simultanen Bilderzählung die tatsächliche Richtstätte der beiden Frauen zu sehen ist. In dieser aufwendigen Bildkomposition und dem «Bild im Bild» wird die Meisterschaft des unbekannten Künstlers deutlich (Abb. 7).

Abb. 6

Abb. 7
Digitalisate in neuem Glanz und eine Zusammenführung auf e-manuscripta
Mit der im Frühjahr 2020 abgeschlossenen Rekatalogisierung der «Wickiana» der Graphischen Sammlung wird das digitale Bildangebot der Zentralbibliothek Zürich um einen wichtigen Bestandteil bereichert. Neue Digitalisate der Blätter erlauben ein detailliertes Studium von Bild und Text direkt am Bildschirm, durch die Anreicherung des Schlagwortkataloges wird auch die thematische Suche besser gefiltert. Literaturverweise ermöglichen die vertiefte Lektüre in der reichen Fachliteratur zu diesem Bestand.
Mit der Verfügbarkeit auf der Plattform e-manuscripta werden die Einblattdrucke – zumindest virtuell – in die Nähe ihres ursprünglichen Aufbewahrungsort gebracht: jene 24 Folianten, in die sie Wick im 16. Jahrhundert eingeklebt hatte und aus denen sie 1925 herausgelöst wurden und die sich schon seit einiger Zeit auf der Plattform befinden. Nun können die Einblattdrucke, die sich seither in der Graphischen Sammlung befinden, mittels der sorgsam verzeichneten Angaben, wo genau sie damals entfernt wurden, mit den Folianten in Zusammenhang gebracht werden (Abb. 8-10).

Abb. 8

Abb. 9

Abb. 10
Der im 16. Jahrhundert umgehenden Angst vor dem Weltende kann man in diesem wort- und bildgewaltigen Konvolut nun ebenso nachspüren, wie der unterschwellig wahrnehmbaren Hoffnung auf bessere Zeiten, wenn auch diese vor allem mittels Fasten und Beten und mit Gottes Gnade und Barmherzigkeit im Himmel erwartet wurden. Dass die Welt auch bald 500 Jahre später ebenso noch vorhanden ist wie seine Chronik, mag dem Sammler zum Wohlgefallen sein.
Anna Lehninger, Kunsthistorikerin, Zürich
Bildlegenden
Abb. 1: «UNerhörte greůliche/ vnd erschröckliche/ Newe Zeytung vnd gesiecht», 1587, PAS II 24/1, Zentralbibliothek Zürich, Graphische Sammlung und Fotoarchiv.
Abb. 2: «Von einem Schrecklichen vnd Wunderbarlichen Cometen», 1577, PAS II 15/5-6 G, Zentralbibliothek Zürich, Graphische Sammlung und Fotoarchiv.
Abb. 3: «Seltzame vnd zuvor unerhörte Wunderzaichen», 1580, PAS II 17/12, Zentralbibliothek Zürich, Graphische Sammlung und Fotoarchiv.
Abb. 4: «Warhafftige Contrafactur/ Eines seer grosse Wallfischs», 1577, PAS II 15/34, Zentralbibliothek Zürich, Graphische Sammlung und Fotoarchiv.
Abb. 5: «Merckliche Beschreibung/ sampt eygenlicher Abbildung eynes frembden vnbekanten Volcks», 1578, PAS II 15/32, Zentralbibliothek Zürich, Graphische Sammlung und Fotoarchiv.
Abb. 6: «Eigentliche Conterfehtung Heinrichen Bullingers», 1571, PAS II 12/11, Zentralbibliothek Zürich, Graphische Sammlung und Fotoarchiv.
Abb. 7: «Eygentliche vnd Warhafftige anzeigung/ welcher massen der beschehen Mordt zů Ober Hasel im Breüschthale», 1557, PAS II 12/58, Zentralbibliothek Zürich, Graphische Sammlung und Fotoarchiv.
Abb. 8: Seite aus einem Folianten der Sammlung Wick, Ms F 14, (7) 2r, Zentralbibliothek Zürich, Handschriftensammlung.
Abb. 9: Seite aus einem Folianten der Sammlung Wick, Ms F 26 (294) 142r, Zentralbibliothek Zürich, Handschriftensammlung.
Abb. 10: Seite aus einem Folianten der Sammlung Wick, Ms F 26 (294) 142v, Zentralbibliothek Zürich, Handschriftensammlung.
Das Geheimnis der Asphaltkopien
Beinahe wäre die Erfindung in den USA geschehen: Der Steindrucker Hans Jakob Schmid (1856-1924) wollte eigentlich dorthin auswandern, doch ein Schiffszusammenstoss im Atlantik machte die Absicht des methodistischen Selfmademans zunichte; der Brief mit der Zusage an die amerikanische Firma ging unter. So blieb er der Firma Artistische Anstalt Orell Füssli in Zürich erhalten. Dort entwickelte er in den 1880er-Jahren in z.T. langwieriger Nachtarbeit den innovativen Photochromdruck.
Das Verfahren grenzte an ein Wunder: Nun liess sich farblich abbilden, was die Photographen bisher nur als Schwarz-Weiss-Aufnahmen von ihren vielfach exotischen Reisen mitgebracht hatten. Mithilfe dieser Drucktechnik, die Photographie und Lithographie verband, wurde der Wald nun erst richtig grün, der Fes des türkischen Wasserpfeifenrauchers stach als signalrote Mondsichel empor. Und Orell Füssli gewann damit einen ersten Preis an der Weltausstellung 1900 in Paris.
Der Photochromdruck ist ein Flachdruckverfahren für die Reproduktion von Fotografien mit manuell hergestelltem Farbauszug im rasterlosen Mehrfarbendruck. Die Druckform ist ein gekörnter Lithostein mit einer lichtempfindlichen Schicht von gelöstem syrischem Asphalt, auf dem ein Halbtonnegativ belichtet wird. Jede zu druckende Farbe wird vom Lithografen eigens ausgearbeitet und retuschiert, die Steine dann vor dem Druck geätzt. Die Farbe kommt also nicht von der Natur, sondern aus dem Kopf des Photochromoperateurs.

Der Photochromdruck blieb bis in die 1960er-Jahre das leistungsfähigste Druckverfahren zur Herstellung von hochwertigen Farbreproduktionen; ist aber heute aus der Druckindustrie verschwunden.
Bedeutende grafische Anstalten, neben Orell Füssli die Firmen Bender in Zollikon, Vontobel in Feldmeilen, Wolfensberger in Zürich und die Lichtdruck AG in Dielsdorf, erlangten dank der Photochrom-Qualität im Kunstdruck und in der Produktion von Ansichtskarten, im Plakatschaffen und im Faksimiledruck fast ein Jahrhundert lang Weltruf.
Wie erfolgreich diese Technik war, wird mit der Zahl von etwa 11000 Photochroms belegt, die Orell Füssli vor dem Ersten Weltkrieg der Stadtbibliothek (später Zentralbibliothek) Zürich übergab. Sie stellen etwa drei Viertel der Gesamtproduktion von OF dar. Die hohe Qualität dieser Drucke brachte selbst erfahrene Fachleute dazu, sie für frühe Farbfotografien zu halten.

Kaum jemand kannte allerdings die Details der Herstellung dieser Photochromdrucke. Orell Füssli verwendete das vom griechisch „photos (Licht) und „chroma“ (Farbe) abgeleitete Kunstwort für die von ihr produzierten Bilder und benutzte bewusst unpräzise Bezeichnungen für die jahrzehntelang geheim gehaltene Technik (und wollte bei der Patentierung nicht bekanntgeben, dass Asphalt verwendet wird).
Der Photochromdruck wurde von Dr. Bruno Weber (bis 2002 Leiter der Graphischen Sammlung der Zentralbibliothek Zürich) 1979 erstmals publik gemacht und mit einer Ausstellung in den Museen Burg Maur am Greifensee 2002/03 der Öffentlichkeit vorgestellt.
Dank diesem Ereignis wurde bekannt, dass der Zürcher Fotolithograf Peter Kunz (2008 verstorben), einer der Letzten, der diese Technik beherrschte, 1977 eine Anleitung zum Photochromdruck verfasste, die bisher unveröffentlicht geblieben war.
In dem 2006 veröffentlichten Buch „Der Photochromdruck vom Lithostein“ wird die Geschichte wie auch das Verfahren umfassend dargestellt. Die 22 Abbildungen darin dokumentieren die Komplexität des Verfahrens, das reiche handwerkliche Wissen und Können des Druckers und die notwendige Sorgfalt. Der besondere Reiz dieser Abbildungen liegt darin, dass sie den Druck der beiden Originale zeigen, die in dem Buch enthalten sind: Sie sind wohl die letzten mit dieser Technik hergestellten Blätter.
Eduard R. Fueter, Au ZH
Peter Kunz: „Der Photochromdruck vom Lithostein“. Hrsg. von Dr. Bruno Weber. 96 S. mit 2 Original-Photochromdrucken sowie zahlreichen farbigen und s/w Abb. Mit einem Gespräch über Photochrom und einem Glossar der Fachbegriffe. Limitierte Aufl. von 400 Ex. Edition Gilde Gutenberg Küsnacht/Zürich 2006. Ln., 4°. ISBN 978-3-9523176-0-0.
2017 erschien im Darmstädter Justus von Liebig Verlag ein ausgesprochen aufwendig und bibliophil gestaltetes Buch, das seines Inhalts vollkommen würdig ist. Es handelt sich um die Festschrift «450 Jahre Wissen Sammeln Vermitteln. Von der Hof- zur Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt». Der Band enthält auf 376 Seiten wissenschaftliche Beiträge von zahlreichen Forschern zu verschiedenen Aspekten der wechselvollen Geschichte dieser Institution und ihrer Vorgänger. Ziel bei der Erstellung war es nicht, eine lineare Nachzeichnung der historischen Entwicklung zu liefern, sondern in einzelnen Schlaglichtern charakteristische Etappen, Figuren und Bestände des Hauses anhand des neuesten Forschungsstands zu untersuchen. Damit schließt das Buch aber durchaus an das Konzept der Festschrift zum vierhundertjährigen Jubiläum von 1967 an, die ihrerseits noch vergleichsweise bescheiden daherkam und eine kleinere Sammlung von Beiträgen vereinigte («Durch der Jahrhunderte Strom. Beiträge zur Geschichte der hessischen Landes- und Hochschulbibliothek Darmstadt», Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 1967).

Abb. 1
Die Festschrift von 2017 im Format 24,5 x 17,5 cm sticht aus der heutigen Massenbuchproduktion wohltuend heraus. Die kreative und sehr geschmackvolle Ausstattung ist dem Darmstädter Büro für Gestaltung Polynox geschuldet, das hier alle Register ziehen konnte. Charakteristisches Leitmotiv ist dabei der einheitliche Farbakkord aus Schwarz und Gold, der schon den Einband kennzeichnet. Der schwarze Leinenrücken trägt den Haupttitel und das Verlagssignet in Goldprägung, während der mit mattschwarzem Papier bezogene Vorderdeckel die im Laufe der Jahrhunderte verwendeten Bibliotheksstempel mit gummierter Druckerfarbe im Relief wiedergibt, die sich um den in Goldschrift geprägten Titel herum gruppieren (Abb. 1). Der Klappentext auf dem schwarzen Rückdeckel ist ebenfalls in Goldschrift gedruckt. Die Vorsätze sind aus schwarzem Papier, das Lesebändchen goldfarben.
Das Grunddesign kommt auch in der Innengestaltung zum Tragen: Titel, Zwischentitel, Randtitel neben dem Text, längere Zitate und Anmerkungen sind in Goldbraun gedruckt, der Rest in Schwarz (Abb. 2). Der Inhalt gliedert sich entsprechend den grossen Epochen der Bibliotheksgeschichte in vier auf mattes Papier gedruckte Abschnitte namens «Bibliotheksgeschichte in Texten», die jeweils von einem goldenen Vorsatzblatt mit einem Bildausschnitt in Kartusche und dem entsprechenden Zeitabschnitt eingeleitet werden (Abb. 3). Analog dazu haben die einzelnen Kapitel auch ein entsprechend gestaltetes Titelblatt, nun auf weissem Papier, aber in beiden Schriftfarben. Die vier Textteile werden jeweils von einem farbigen Bildteil auf Hochglanzpapier namens «Bibliotheksgeschichte in Bildern» abgeschlossen. Diese umfangreichen Bildabschnitte enthalten jeweils in der Mitte eine ausklappbare chronologische, bebilderte Übersicht über die jeweilige Bibliotheksepoche sowie die Nachweise für die stets ganzseitigen Abbildungen auf den anderen Tafeln (Abb. 4). Die hier gezeigten bibliophilen Schätze des Hauses illustrieren dessen Geschichte, ergänzt durch die Wiedergabe von Archivalien, Gemälden, Graphiken und Fotografien.

Abb. 4
Verbindendes Element des ganzen Buches ist ein durchgehender Zeitstrahl, der sich durch die Titelblätter und die Falttafeln der Illustrationen hindurchzieht. Die Titelvignetten zeigen jeweils ein für das Thema charakteristischen Bildausschnitt in einer runden Kartusche. Die historische Entwicklung der Landgräflichen und später Grossherzoglichen Hofbibliothek, der Landesbibliothek und der Bibliothek der Technischen Hochschule bis hin zur heutigen Universitäts- und Landesbibliothek wird in Einzelkapiteln recht unterschiedlicher Länge von 19 Verfasserinnen und Verfassern dargestellt. Einerseits wird so die Verflechtung der Bibliothek mit der dynastischen und politischen Geschichte verdeutlicht, andererseits werden einzelne Bestände oder besondere Objekte vorgestellt. Der letzte Abschnitt erlaubt auch Einblicke in die aktuelle Arbeit der Bibliothek, da auch Kapitel zur hauseigenen Bestandserhaltung und zum Digitalisierungszentrum vorhanden sind. Dem kundigen Herausgeber- und dem kreativen Gestaltungsteam gebührt das Verdienst, die Vielfalt an methodischen Ansätzen in einen einheitlichen und übersichtlichen Rahmen gebettet zu haben. Der Anhang enthält neben einem Ausstellungs- und Literaturverzeichnis der Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt nicht nur ein durch alphabetische Reiter am Rand sehr gut gegliedertes Literaturverzeichnis, sondern auch Kurzporträts der Autorinnen und Autoren.
Die Festschrift «450 Jahre Wissen Sammeln Vermitteln. Von der Hof- zur Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt» ist ein absolut bibliophiles Buch, das sich mit bibliophilen Themen beschäftigt und in einer heute selten anzutreffenden Qualität produziert wurde.
Nicola Schneider, Zürich
450 Jahre Wissen – Sammeln – Vermitteln. Von der Hof- zur Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt: 1567–2017 / herausgegeben von der Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt; Redaktion: Björn Gebert, Andreas Göller, Thomas Hahn, Helge Svenshon, Silvia Uhlemann. Darmstadt, Justus von Liebig Verlag. Der Darmstädter Kunst- und Kulturverlag, 2017, 376 Seiten. ISBN 978-3-87390-402-6. Halbleinen, Hardcover, Heissfolienprägung, Lesebändchen.
Paul Klee (1879–1940) und Hans Bloesch (1978–1945) freundeten sich im Gymnasium an, legten 1898 gemeinsam die Matura ab und blieben sich ein Leben lang eng verbunden. In der Schulzeit beginnt ein gemeinsames Vorhaben, an dem sie bis 1905 arbeiten. Unter dem lapidaren Titel „Das Buch“ verfassten Klee und Bloesch Gedichte und essayistische Texte, Klee trug zusätzlich Skizzen und Zeichnungen zum Projekt bei. Entstanden ist eine Art Ideensammlung, ein Experimentierfeld und Laboratorium, das assoziativ und unsystematisch in der Reihenfolge der Beiträge, also ganz das Gegenteil eines strukturiert aufgebauten Buches war. Welches Ziel die beiden damit verfolgten oder ob je eine Publikation angedacht war, bleibt letztlich unklar. Dennoch ist „Das Buch“ ein wichtiges Dokument, welches die künstlerischen Ambitionen und Entwicklungen der beiden jugendlichen Verfasser aufzeigt und ihre spätere Berufswahl klar vorzeichnet. Gleichzeitig zeigt es ihre jugendliche Unbekümmertheit, ihr Leiden am Leben und der Liebe, ihren Witz, ihr Talent zur Karikatur und ihr Selbstbewusstsein.
Gerade die Arbeiten von Paul Klee im „Buch“ lassen zum Teil ganz unbekannte Aspekte seiner künstlerischen Selbstfindung erkennen. Im „Buch“ experimentiert Klee mit neuen Techniken, etwa dem Zerteilen und neu Kombinieren mit Messer und Schere, und mit Motiven wie dem Körper, den er in Bewegung bringt oder ins Satirisch-Karikative verformt. Sehr uneinheitlich sind Klees Textbeiträge, die sich zwischen sachlichen Kommentaren zu den Zeichnungen, anspruchsloser Gelegenheitsdichtung und ambitionierter Lyrik bewegen. In allen Texten erkennbar ist Klees witzig-poetisches Talent. Die Idee eines Schriftstellerlebens gab Klee um 1902 auf. Inwieweit „Das Buch“ Einfluss darauf hatte, muss offen bleiben.

Burgerbibliothek Bern, FA Bloesch, Das Buch, fol. 46v/47r.
Ein großer Teil der Textbeiträge stammt aus der Feder von Hans Bloesch, der zunächst Gymnasiallehrer, dann als Journalist und Redaktor und ab 1927 als Oberbibliothekar der damaligen Stadt- und Hochschulbibliothek wirkte. Seine Verse sind in der Regel recht konventionell aufgebaut, inhaltlich immer mit satirischem Unterton und aktuellen Bezügen oder Kritik etwa an der Vereinsmeierei, dem saturierten Bürger oder der Frau als Dichterin. Daneben finden sich aber wiederum wie bei Klee ernsthafte Versuche von Liebeslyrik.

Burgerbibliothek Bern, FA Bloesch, Das Buch, fol. 65v/66r.
Bei der Sichtung von „Das Buch“ ist ein unmittelbarer Bezug von Text und Bild meist nicht erkennbar. Doch das Zusammenspiel von Text und Bild, wenn auch nicht im illustrierenden Sinn, war gleichwohl Teil des Konzepts. Doch die Struktur erinnert mehr an die collagenartige Ästhetik und den Aufbau von Zeitschriften wie den Kladderadatsch oder den Simplicissimus, welche die beiden sehr wohl kannten.
Spätestens 1905 verloren Klee und Bloesch das Interesse am „Buch“, das damit Fragment blieb. Sie verfolgten stattdessen ab 1903 das Projekt des illustrierten Versepos „Der Musterbürger“ weiter, das sie 1908 auch abschlossen. 2003 fanden die beiden Klee-Forscher Osamu Okuda und Reto Sorg im Familienarchiv der Familie Bloesch, das sich heute in der Burgerbibliothek Bern befindet, ein gebundenes Kontorbuch im Folio-Format. Die Überraschung war groß, als sich der unscheinbare Band als „Das Buch“ erwies und damit eine interessante Lücke – mit „Pubertätsergüssen“, wie Bloesch selbst urteilte – im Lebenswerk der beiden Künstlerfreunde füllen ließ.
Claudia Engler, Bern
Osamu Okuda, Reto Sorg (Hg.). Hans Bloesch, Paul Klee, «Das Buch». Zweisprachige Faksimile-Edition mit Transkription. Erschien 2019 in Kooperation mit dem Zentrum Paul Klee, Bern, in der Schriftenreihe der Burgerbibliothek Bern (Nimbus-Verlag, Wädenswil 2019; ISBN 978-3-03850-065-0, 180 Seiten, als broschierte Studienausgabe und als Vorzugsausgabe in Leineneinband).
Am 28. August 1555 besteigt Conrad Gessner den Pilatus. Sein Ziel ist es, einmal im Jahr den Kopf "über die Wolken" zu heben, den häuslichen Alltag hinter sich zu lassen und die Schönheiten der Natur zu bewundern. Er schrieb, unsere Schweizer Berge seien deshalb so interessant, weil sie höher und reicher an Pflanzen seien als solche in anderen Regionen.
Die Legende besagt, dass Pontius Pilatus hier gewesen sei und im Sumpf am Berg ertrunken. Wenn jemand etwas in diesen Sumpf werfe, komme es zu Unwettern oder Überschwemmungen. Gessner lehnt die Sage als Irrglauben ab – "es sei denn, ein anderer würde mich eines Besseren belehren".
Die Beschreibung seiner Besteigung des Pilatus - Descriptio Montis Fracti sive Montis Pilati - erschien als Beilage in seinem Büchlein Conradi Gesneri Medici De Raris et Admirandis Herbis 1555 bei den Brüdern Andreas und Jakob Gessner in Zürich.

Er schätzt die frische Luft, klare Wasserquellen, Ruhe und Frieden. Besonders interessiert er sich für die Produkte der Alpen, Milch, Käse, Quark, Butter und Molke, und veröffentlicht dazu ein eigenes kleines Büchlein Libellus lacte et Operibus lactariis philologus parritr ac medicus, Froschauer, Tiguri 1541. Er hält in der Beschreibung alles fest, was er an Pflanzen und Tieren auf dem Weg beobachtet, er beschreibt den allersüssesten Gesang der Vögel, die Gerüche der Kräuter, die Kristalle und im Speziellen die Schneekristalle, wie diese in seinen Fingern zerrinnen. Er stellt fest, dass sich die Pflanzen in unterschiedlichen Höhen anders entwickeln, eine Beobachtung, die später zur Begründung der Wissenschaften der Geobotanik und der Ökologie führt. So verbindet Gessner seine Freude an Bergwanderungen mit seinem Interesse an den Pflanzen, war er doch gerade dabei, Material für sein Pflanzenbuch zu sammeln, das aber nicht mehr zu seinen Lebzeiten erscheinen sollte.
Das Buch gilt als Beginn eines neuen Enthusiasmus für die Berge, wie sie später Albrecht von Haller in seinem Gedicht Die Alpen aufnahm, und als Begründung des Alpinismus schlechthin.
Auf dem Berg schreibt Gessner: "Hier gibt es nichts, was unsere Ohren stört, nichts was nicht hierhin gehört, keinen Stadtlärm, keine Konflikte unter Menschen. Hier, umgeben von der tiefsten heiligen Stille der höchsten Bergspitzen kannst du die himmlische Harmonie spüren, wenn diese irgendwo existiert."
Alex Rübel, Zürich
Dieser wunderbare Prachtband stillt die Italiensehnsucht und entfacht sie zugleich! Goethe auf dem Markusplatz, Goethe vor dem Forum Romanum, Goethe im Amphitheater von Taormina – solche Sternstunden der Menschheit vergegenwärtigt diese «Italienische Reise» in Schwarz-Weiß (Duotone) auf kongeniale Weise. Auf den Spuren des berühmtesten Italienreisenden aller Zeiten führt diese fotografische Grand Tour einmal der Länge nach durch das Land, «wo die Zitronen blühn»: zu Vicenzas steingewordener Pracht, mitten hinein in Venedigs morbiden Charme, übers stolze Florenz weiter zur Grandezza der ewigen Stadt oder in das zum Sterben schöne Neapel ... 125 Fotografien zeigen Landschaften, Plätze, Gebäude und Kunstwerke, die seit Jahrhunderten der Inbegriff Italiens sind. Eine stilvollere Hommage hätte selbst Goethe sich kaum wünschen können.
Im September 1786 hat Goethe keine Lust mehr auf die Last des Alltags: Die Verlage fordern seine immer noch unfertigen Manuskripte zum Druck an, die Arbeit als Minister in Weimar geht ihm auf die Nerven. Auch mag er sich nicht entscheiden, welche seiner geliebten Frauen er zu ehelichen gedenkt. Von einem Tag auf den anderen nimmt er Reißaus und besteigt die nächste Kutsche gen Italien.
Erst im Mai 1788 wird er aus dem Land, wo die Zitronen blühen, nach Deutschland zurückkehren. Einige Jahre später verfasst er ein Buch über seine "Italienische Reise" und wird damit allen Nachgeborenen eine fatale und nie zu stillende Italien-Sehnsucht einpflanzen. Jetzt ist im Manesse Verlag die "Italienische Reise" neu aufbereitet worden. Neben dem Reisebericht von Goethe finden sich "ein fotografisches Abenteuer von Helmut Schlaiß" sowie ein Nachwort von Dennis Scheck.
Verlag Manesse, 2019, 336 Seiten, 125 s/w-Abb., Preis: 49,80 Euro
ISBN 978-3-7175-2490-8

Frank Dietschreit, rbbKultur:
Italien-Sehnsucht
Helmut Schlaiß, Jahrgang 1953, hat sich einen Namen als Mode-, Werbe- und Industrie-Fotograf gemacht. Gelegentlich lebt er seine künstlerischen Ambitionen aus und erprobt sein Können auf längeren Fotoreportagen zu einem speziellen Thema. Sein Herzenswunsch war es lange schon, seine Liebe zu Italien, seine Vorliebe für italienische Küche, seine Bewunderung für die italienische Lebensart und die Kunst der römischen Antike künstlerisch zu gestalten. Und wie ginge das besser als mit Goethes "Italienischer Reise", die einst seine Italien-Sehnsucht angezettelt, die er immer im Gepäck und unzählige Male gelesen hat. Jahrelang ist er deshalb mit seiner Fotokamera auf den Spuren von Goethe unterwegs gewesen, ist ihm von Karlsbad aus über Regensburg und München, über Bozen und Verona, Florenz und Roman, Neapel und Sizilien nachgereist und hat alle Stationen und Orte, Paläste und Ruinen, die auch Goethe gesehen und beschrieben hat, aufgesucht, hat versucht, die Landschaften, Städte und Menschen, von denen Goethe fasziniert war, mit den Augen von Goethe noch einmal neu zu sehen und alles so zu fotografieren, wie Goethe es auch gesehen und beschrieben hat: zur selben Jahreszeit, bei ähnlichem Licht und vom selben Stadtpunkt aus schaut Schlaiß mit seiner Fotokamera auf Goethes "Arkadien", auf die Traumlandschaft, die einst für Goethe und nun auch für Schlaiß zur realen Utopie wird.
Wie Goethe ...
Er stiehlt sich, wie Goethe, mitten in der Nacht aus Karlsbad fort, denn von dort aus hat Goethe einst seine Flucht nach Italien gestartet, und Schlaiß blickt mit seiner Kamera auf eine nur spärlich vom Mond beleuchtete Hausfassade im nächtlichen Karlsbad. In Malcesine am Gardasee lichtet er das Kastell aus derselben Position ab, wie Goethe es in seiner Beschreibung und in einer überlieferten Zeichen-Skizze getan hat. Weil Goethe in Verona die Arena besucht hat und von den oberen Rängen hinab auf den Vorplatz auf die vorbeieilenden Menschen schaut, dann steht genau dort oben auch der Fotograf mit seiner Kamera und schaut auf das Menschengewimmel hinunter. Wenn Goethe in Padua in der Kirche der Heiligen Justine auf harten Holzbänken verweilt und in den sakralen Raum schaut, dann sitzt auch Schlaiß auf harten Holzbänken und lässt den Foto-Blick schweifen. Wenn Goethe auf dem Lido von Venedig den Strand, die Muscheln und das Meer sieht, dann sieht die Kamera genau das: Strand, Muscheln, Meer. Wenn Goethe auf das Dach des Petersdoms in Rom steigt und auf die ewige Stadt hinabblickt, dann steigt auch der Fotograf auf das Dach und blickt über Rom. Wenn Goethe auf der Überfahrt von Neapel nach Palermo in die Weite des leeren Horizonts schaut, schaut auch die Kamera in die weite es leeren Horizonts. Und wenn Goethe in Grigenti am Tempel des Herkules die symmetrischen Säulenreihen abschreitet, schreitet auch die Kamera die Säulenreihen ab.
230 Jahre dazwischen
Zwischen Goethes alter Reise und seinen aktuellen Bildern liegen gut 230 Jahre. Der Fotograf versucht nicht, die zeitliche Lücke weg zu retuschieren, aber er hält sie so dezent wie möglich, die Gegenwart ist präsent, aber nicht übermächtig: Schlaiß fotografiert mit einer einfachen alten Kamera, mit Normalobjektiv, er fotografiert in schwarz-weiß, was die Konzentration aufs Motiv und den Eindruck erhöht, die Fotos hätten schon einige Jahrzehnte auf dem Buckel. Er hat oft stunden- und tagelang ausgeharrt, bis das Licht und die Stimmung stimmte, bis die Landschaft, der Tempel, die Kirche von möglichst vielen Zeichen der Moderne befreit war und keine Autos und keine Handys mehr zu sehen waren. Beim Blick von Torbole aus über den Gardasee hat er gewartet, bis die Surfbretter und Segelboote verschwunden waren, beim Besuch von Pompeji, bis kaum noch Touristen durch die Ruinen geisterten; das Kolosseum in Rom steht verlassen unter düstrem Himmel, als wäre es von der Zeit völlig vergessen worden; die Via Appia brütet mit ihrem alten Kopfsteinpflaster in der Sonne: man könnte glauben, hinter der nächsten Kurve wartet ein alter römischer Streitwagen oder Goethe in seiner Kutsche, gerade auf dem Weg von Rom nach Neapel. Um Authentizität und Wahrhaftigkeit zu steigern, hat Schlaiß immer ein paar passende Sätze aus Goethes Reisenotizen zu seinen Fotos gestellt: Wem das nicht reicht, kann im zweiten Teil des Buches die "Italienische Reise" noch einmal in Gänze nachlesen.
Dennis Scheck
Literaturpapst Dennis Scheck flaniert in seinem Nachwort kurzweilig durch Goethes Leben und Werk, bekränzt – mit leicht ironischem Unterton – das zeitlose Genie des wohl größten deutschen Dichters, betont, dass Goethe weder ein Aussteiger war noch eine klassische Bildungsreise im Sinn hatte, sondern sich selbst suchte, seine Bestimmung und sein Schicksal; dass er keinen Müßiggang pflegte, sondern unterwegs schuftete wie ein Pferd und viele seine unsterbliche Manuskripte endlich fertig stellte; dass er, der so gerne Maler geworden wäre, in Italien erkannte, dass nur im Schreiben seine wahre Berufung liegt. Dass auch Dennis Scheck eine unstillbare Sehnsucht hat nach dem Land, wo die Zitronen blühen, dass sie von Goethes "Italienischer Reise" herrührt und er das Buch immer wieder liest, versteht sich von selbst: Als Schlaiß ihn bei einer Lesung ansprach und mit seinem Foto-Projekt bekannt machte, war Scheck sofort Feuer und Flamme und wollte dringend etwas beitragen: Das einzigartige Resultat dieser wunderbaren Liaison aus neuen Fotos und altem Text halten wir jetzt zufrieden und beglückt in der Hand.
Zusammengestellt von Wolfram Schneider-Lastin, Zürich
Les cadets de Gascogne n’ont pas le privilège d’être les seuls «bretteurs et menteurs sans vergogne» de la littérature. En fait, le principal rival à la hâblerie méridionale d’un Tartarin de Tarascon ou d’un Cyrano de Bergerac est un junker allemand: le baron de Münchhausen. L’invention et l’évolution de ce personnage universellement connu constituent à elles seules une aventure, puisque c’est d’un aristocrate bien réel que naquit cette figure pittoresque.
Plus fort que le Provençal Tartarin, plus audacieux que le Gascon Cyrano, le roi de la calembredaine est peut-être bien allemand: il a pour nom Münchhausen. Redécouvrez son histoire et méfiez-vous de son syndrome!
Aux origines du mythe: le «vrai» Münchhausen
Comme souvent, à la source de la légende, se niche un personnage bien réel: Karl Friedrich Hieronymus, Freiherr von Münchhausen (1720–1797). Fils désargenté d’un officier de cavalerie, cet aristocrate allemand (dont le titre de « Freiherr » équivaut à celui de baron) chercha fortune, comme beaucoup de ses homologues, en louant son épée à l’Empire russe, suivant l’exemple de son premier maître, le prince de Brunswick-Wolfenbüttel. Il combattit notamment contre les armées turques en Crimée (durant la guerre de 1736–1739), puis participa à la campagne contre les Suédois (1741–1743). Arrivé au grade (assez modeste) de capitaine de cavalerie en 1750, il prit alors sa retraite pour revenir en Allemagne. Menant l’existence d’un modeste hobereau, il s’attira vite une réputation de conteur plaisant et inventif, « améliorant » pour ses auditeurs ravis des épisodes et anecdotes vécus durant ses années de service en Russie.

Photo 1: Portrait fantaisiste du baron de Münchhausen par Gustave Doré (1862). La devise barrant l’écu familial est «Mendace veritas», soit «Dans le mensonge, la vérité».
La naissance en deux temps d’un personnage littéraire
Quelques-unes de ces histoires se répandirent et donnèrent l’idée à un auteur facétieux de leur donner plus d’écho. Le genre des «Lügengeschichten» avait toujours eu bonne presse en Allemagne et les récits de Münchhausen perpétuaient cette tradition. En 1785, l’écrivain et archéologue Rudolf Erich Raspe (1736–1794) les recueillit et les publia, en anglais, sous le titre de Baron Münchhausen's Narrative of his marvellous Travels and Campaigns in Russia.
Dès l’année suivante, inspiré par cette manne, le poète Gottfried August Bürger (1747–1794) prétendit donner une traduction allemande de l’ouvrage de Raspe («Aus dem Englischen nach der neuesten Ausgabe übersezt»). Il livrait en réalité une version totalement remaniée, augmentée, poétisée et politisée des historiettes du vrai Münchhausen, devenu sous sa plume un être fantastique: le personnage du tartarinesque baron tel qu’on se le représente aujourd’hui vit donc bien le jour dans ces Wundebare Reisen zu Wasser und Lande, Feldzüge und lustige Abentheuer des Freiherrn von Münchhausen. Si cette édition originale (ouvrage aujourd’hui des plus rares) affichait (pour parachever l’illusion anglaise) l’adresse de Londres sur sa page de titre, elle sortait en réalité des presses de J. Ch. Dieterich, sises à Göttingen (où vivait Bürger). Conscient des soucis que pouvait lui attirer la veine satirique de l’ouvrage, l’auteur s’était dissimulé derrière un prudent anonymat.

Photo 2: Page de titre de l’édition originale des Wunderbare Reisen … des Freiherrn von Münchhausen de G. A. Bürger (1786)
Représenter l’impossible
En dépit de la modestie inhérente à ce type de publications populaires, le mince volume de Bürger était orné de neuf gravures sur cuivre, œuvres de l’artiste E. Riepenhausen (1765–1840). Elles venaient illustrer certains des plus célèbres épisodes du livre. Ainsi figure à pleine page le superbe huit-cors que le baron, quelques années après lui avoir tiré, faute de balle, un noyau de cerise dans la tête, retrouve couronné d’un « arbre haut de dix pieds », chargé de fruits : abattant sa proie, il gagna d’un coup «le rôti et le dessert».

Photo 3: L’aventure du cerf au cerisier dans l’édition de 1786
Autre épisode fameux, celui du demi-cheval. S’abreuvant à une fontaine après une chevauchée guerrière, le lituanien du baron ne parvenait pas à étancher sa soif. Et pour cause: au terme d’une sortie contre les assiégeants turcs, alors que le cavalier et sa monture rentraient dans la ville, une lourde herse s’était abattue sur le cheval, le coupant net juste derrière la selle. Toute l’eau bue ressortait donc directement du corps de l’animal pour tomber sur le pavé!

Photo 4 : L’épisode du demi-cheval dans l’édition de 1786
Une figure de l’imaginaire collectif
Le personnage de Münchhausen dépassa vite les frontières allemandes pour s’imposer, au fil du XIXe siècle, comme l’un de ces quelques héros ou types littéraires universels, connus et aimés à travers le monde entier: le texte est aujourd’hui traduit dans plus de cent langues et a connu de très nombreuses adaptations à l’écran, la première étant celle de Georges Méliès dès 1911. La nature polémique du récit s’estompant peu à peu au profit de la veine burlesque, l’ouvrage est devenu l’un des classiques de la littérature enfantine. Il connut de nombreuses reprises ou pastiches, comme le baron de Krack ou Crac, variante française de Münchhausen (et Gascon comme de juste).
En France, les aventures du baron trouvèrent pour traducteur Théophile Gautier fils (1836–1904), sous-préfet et secrétaire du ministre Rouher, mais aussi homme de presse et de lettres, auteur de plusieurs traductions depuis l’allemand (Von Armin, Goethe, …) et collaborateur occasionnel de son père à la fin de sa vie. Cette version française, parue pour la première fois en 1862, est également demeurée fameuse pour sa somptueuse illustration par le talentueux Gustave Doré.

Photo 5 : Page de titre de la première édition de la traduction par Gautier fils (1862)
Ce dernier laissa libre cours à son imagination débridant, croquant un junker efflanqué, en grand uniforme de hussard, traînant au côté un sabre et une sabretache démesurés. On les voit flottant derrière le héros lorsque celui-ci chevauche un boulet de canon pour survoler le camp turc, avant d’effectuer le voyage de retour vers ses propres lignes en sautant sur un projectile turc. Les planches à pleine page expriment toute la poésie propre aux compositions de Doré qui, à la manière noire, livre cette représentation du bateau du baron emporté à «mille lieues» dans les airs par un ouragan et qui finit par aborder les rivages argentés de la Lune.

Photo 6: Le baron chevauchant un boulet au-dessus du camp turc (illustration de G. Doré)

Photo 7: La tempête emporte le bateau du baron vers la Lune (illustration de G. Doré)
L’intervention de l’illustrateur ne se limita pas à l’intérieur du livre : à la demande de l’éditeur Charles Furne, il blasonna des armes fantaisistes attribuées au baron. Couronnées du tortil de baron (accompagné d’une perruque), encombrées de tenants animaliers (le maigre lévrier et le cheval coupé en deux) et de faisceaux d’armes en sautoir, ces armoiries se retrouvent dorées sur le premier plat de la reliure-éditeur de percaline rouge.

Photo 8: Premier plat de la reliure-éditeur, avec les armes fantaisistes des Münchhausen (d’après G. Doré)
Nicolas Ducimetière, Fondation Martin Bodmer
Les Métamorphoses d’Ovide, en latin, traduites en françois avec des remarques et des explications historiques par l’abbé Banier (Amsterdam, Wetstein & Smith, 1732, 2 vol. in-folio) est un des plus beaux livres en français imprimés du XVIIIe siècle.
Cent-vingt-quatre magnifiques figures en taille-douce de neuf artistes, gravées par huit graveurs, illustrent les récits fabuleux des amours et métamorphoses des héros de la mythologie contés par Ovide.

Texte latin en regard, frontispice. Les 124 figures, dans le cours du texte, de Lebrun, Leclerc, Maas, Bernard Picart (1673-1733), Punt, J. Romain, Tosca, de Wit et Wandelaar, sont gravées par Martin, Pierre-Paul Bouche, Bouttats, Folkema, V. Gunst, Jungmann, Schenk et Vandelaa. Trois grandes planches de Lebrun tirées à part dans le 2e volume, sont gravées par Folkema. La traduction française des Métamorphoses d’Ovide d'Antoine Banier (1673-1741) fit référence. Suivant une tendance d’interprétation réaliste (évhémérisme), ce spécialiste de la mythologie suggérait que les héros des Métamorphoses aient pu être au départ des êtres humains historiques admirés, dont on embellit et transfigura le souvenir sous forme de légendes merveilleuses. Pour prendre un seul exemple : quatre gravures se rapportent à l’histoire d’Orphée: «Orphée assistant à la mort d’Eurydice»; «Aux Enfers, le chant et la musique d'Orphée enchantent la reine Proserpine»; «Orphée attire au son de sa voix les arbres et les animaux»; «La mort d'Orphée, et les dames de Thrace changées en arbres». La mort d’Orphée est racontée avec des variantes. Pour certains, Zeus le foudroie, le punissant d’avoir révélé aux hommes les secrets découverts aux Enfers (mystères des initiés d’Eleusis); selon d’autres, il se suicide pour retrouver Eurydice. Selon la variante prédominante (Eschyle), il est tué par les Ménades-Bacchantes de Thrace sur le mont Pangée. Collection Fondation Martin Bodmer.
Jacques Berchtold, Cologny
Am Tag nach seinem Geburtstag 1827 präsentierte Johann Wolfgang von Goethe den Gästen im Haus am Frauenplan, dem Buchhändler Gustav Parthey und dem Juristen Eduard Gans, die für ihn ein Jahr zuvor ausgestellte Urkunde des preußischen Königs Friedrich Wilhelm III. „Sehen Sie, das ist der beste Orden!“, schwärmte Goethe. Das prächtige Siegel beglaubigte das preußische Privileg „zum Schutz wider den Nachdruck“ von Goethes „Ausgabe letzter Hand“. Der am 12. Februar 1826 in Weimar eingetroffene Schutzbrief bildet den erfolgreichen Abschluss der mehrjährigen Bemühungen Goethes um einen deutschlandweiten Urheberschutz für sein Werk.

Privileg Preußens gegen den Nachdruck von Goethes „Ausgabe letzter Hand“, unterzeichnet von König Friedrich Wilhelm III., Berlin, 23. Januar 1826. (Klassik Stiftung Weimar, Goethe- und Schiller-Archiv, 30/331a)
Befördert durch die deutsche Kleinstaaterei und das Fehlen eines allgemeinen Urheberrechts waren Nach- und Raubdrucke in der zweiten Hälfte des 18. und zu Beginn des 19. Jahrhunderts gängige Praxis – auch Goethe bekam dies zu spüren. Von seinen Erstlingswerken „Götz von Berlichingen“ (1773) und „Die Leiden des jungen Werthers“ (1774) kursierten bereits kurz nach ihrer Erstveröffentlichung mehrere Raubdrucke. Besonders verärgert war Goethe über den unautorisierten Nachdruck seiner zweiten und zwischen 1815 und 1819 von Johann Friedrich von Cotta verlegten Werkausgabe, von dessen Existenz er während seines letzten Kuraufenthaltes in den böhmischen Bädern im Sommer 1823 erfuhr. In einer Karlsbader Buchhandlung wurde Goethe von einigen „Freunden und Fremden“ nach seiner Meinung über die in Wien und Stuttgart erschienene und zum Kauf angebotene Ausgabe seiner Werke gefragt: „Ich antwortete, vielleicht zu naiv: daß ich gar nichts davon wisse!“, so Goethe. „Und bey näherer Betrachtung mußte es doch bedencklich scheinen, eine Original Ausgabe, wovon der Verfasser keine Kenntniß hat und der Verleger sich nicht nennt, vor Augen zu sehen.“
Da sich sein Verleger Cotta nicht genügend für den Schutz geistigen Eigentums einsetzte, reichte Goethe im Januar 1825 beim Deutschen Bund ein Privilegierungsgesuch „für die neue vollständige Ausgabe“ seiner Werke ein, an der er seit 1822 arbeitete. Die Frankfurter Bundesversammlung konnte sich jedoch nicht dazu entschließen, gemeinschaftlich den Schutz „in allen Bundesstaaten“ zu garantieren. Sie empfahl aber den einzelnen Regierungen, landesherrliche Privilegien auszustellen. Ab Mai 1825 erhielt Goethe die Schutzbriefe fast aller Staaten und freien Städte. Ende des Jahres fehlte nur noch das Privileg Preußens, obwohl sich ausgerechnet ein preußischer Gesandter – Karl Ferdinand Friedrich von Nagler – beim Bundestag besonders stark für den Dichter eingesetzt hatte. Goethes Gesuch war zum Zankapfel der Innenpolitik Preußens geworden. Aufgrund des im Preußischen Allgemeinen Landrecht geregelten Urheberschutzes hielt das Ministerium des Innern die Ausfertigung eines Privilegs für überflüssig. Dagegen befürwortete das Außenministerium einen Schutzbrief, um den Nachdruck auch in den preußischen Rheinprovinzen zu verhindern, in denen teilweise noch der Code Napoléon galt und – gestützt durch die höchstrichterliche Rechtsprechung der 1820er Jahre – weiterhin Nach- und Raubdrucke florierten. Schließlich unterzeichnete der preußische König am 23. Januar 1826 das Privileg zum Schutz für Goethes „Ausgabe letzter Hand“ in sämtlichen Provinzen Preußens, „auch in denjenigen Landestheilen, wo das französische Recht oder andere Gesetzgebungen noch in Gültigkeit bestehen“. Den von Goethe angestrebten allgemeinen Urheberrechtsschutz gewährte die Bundesversammlung erst 1837 mit einer zehnjährigen Schutzfrist nach Ersterscheinung eines Werkes.
Christian Hain, Weimar
Am 9. November 2019 jährt sich der Fall der Berliner Mauer zum 30. Mal. Das "Buch des Monats November" möchte an dieses Ereignis erinnern mit einem Buch, das im Jahr 1990 erschienen ist.
Es enthält die Arbeiten von 27 Fotografinnen und Fotografen, die ihre Fotos alle an einem einzigen Tag geschossen haben, am 13. August 1990, an dem Tag also, an dem im Jahr 1961 die Mauer gebaut wurde, die 28 Jahre und 3 Monate Berlin teilte. Dieser Tag war in der Bundesrepublik ein bedeutender Gedenktag - bis 1989, bis die Friedliche Revolution die Mauer zu Fall brachte. Das Buch ist eine Bestandsaufnahme Berlins zwischen dem Ende der Teilung Berlins und der Vereinigung der beiden deutschen Staaten am 3. Oktober 1990 - einer Zeit somit des Nicht-mehr und Noch-nicht, festgehalten in beeindruckenden Fotos.


Beeindruckend und besonders an diesem Buch ist aber auch seine Aufmachung: Es hat die Form eines stehenden besprühten Mauerstücks, das man öffnen muss, um es zu lesen.


Die Fotos werden ergänzt durch Texte von Walter Momper, Lea Rosh, Wolfgang Ullmann, Heinz Galinski, Wolf Biermann, Heiner Müller, Lotti Huber und Jens Reich.
Berlin, 13. August 1990. Herausgegeben von Viola Sandberg und Ulrich Herold. Gestaltet von Jochen Friedrich. Verlag CONSTRUCTIV Berlin 1990. ISBN 3-86154-001-0
Wolfram Schneider-Lastin, Zürich
François de Salignac, La Mothe Fénelon, Les Avantures de Télémaque, fils d’Ulysse, Amsterdam, J. Wetstein & G. Smith – Rotterdam, Jean Hofhout, 1734, 424 pages, 25 planches gravées et vignettes gravées d’après Picart, Dubourg et Debrie. Exemplaire Collection Fondation Martin Bodmer.
Archevêque de Cambrai, Fénelon (1651–1715) fut précepteur du duc de Bourgogne, fils du dauphin. Les Aventures de Télémaque relève du genre de l’Instruction de Prince et présente de façon divertissante un épisode qui s’insère dans la trame de l’Odyssée : le fils du roi d’Ithaque est à la recherche de son père. Le prince Télémaque est accompagné de son maître de sagesse, le vieillard Mentor, qui formule des conseils et les leçons des épreuves traversées. L’ouvrage en dix-huit livres se révèle le plus beau poème épique français en prose, certes homérique par le sujet, mais ressortissant à un classicisme virgilien-racinien par son phrasé et son style. Fénelon a voulu transmettre des valeurs de morale chrétienne. Là où les sujets des poèmes épiques modernes sont chrétiens (de Dante à Klopstock), le Télémaque a choqué les esprits pieux. Haut prélat de l’Église, Fénelon a fait de ses personnages de faux-païens évoluant (sans le savoir) au sein de valeurs chrétiennes de vices et de vertus (« adoucissez les cœurs farouches ; montrez-leur l’aimable vertu », est-il enseigné). Le Télémaque adressait de biais de vifs reproches à Louis XIV et à sa politique d’absolutisme. Dès 1699 Les Aventures de Télémaque paraissent en Hollande, chez Moetjens à La Haye Les éditions en français se multiplient tout au long du XVIIIe siècle, et notamment l’édition dite de Rotterdam publiée en 1719 chez Jan Hofhout et les frères Wetstein (Amsterdam). L’édition Amsterdam (J. Wetstein & G. Smith) & Rotterdam (Jean Hofhout), 1734) se remarque pour ses vingt-cinq gravures, figures en taille-douce, 25 planches gravées d’après Bernard Picart (1673–1733), Louis-Fabricius Dubourg (1693-1775) et Guillaume-François-Laurent Debrie (dates inconnues) que l’on peut lire comme des interprétations du Télémaque. Frontispice de Picart gravé par Folkema, portrait de Fénelon gravé par Drevet d'après Vivien, et 24 figures par Debrie, Dubourg, et Picart gravées par Bernaerts, Folkema, Gunst et Surugue, 24 vignettes et 21 culs de lampe gravés par Duflos, Schenk, Folkema et Tanjé. L’ouvrage est considéré comme l’un des plus beaux livres du XVIIIe siècle. L’éditeur est soucieux de rappeler les éloges formulés par de Sacy dans son approbation du Télémaque le 1 juin 1716. Le propos est cité dans l’édition Wetstein de 1734:
…j’ai cru qu’il [Avantures de Télémaque] ne méritait pas seulement d’être imprimé, mais encore d’être traduit dans toutes les langues que parlent ou qu’entendent les Peuples qui aspirent à être heureux. […] Avec Télémaque on apprend à s’attacher inviolablement à la Religion, dans la mauvaise comme dans la bonne fortune ; à aimer son Père, et sa Patrie ; à être Roi, citoyen, Ami, Esclave même si le sort le veut. Avec Mentor on devient bientôt juste, humain, patient, sincère, discret, et modeste… (p.19).
Dans Dichtung und Wahrheit, Goethe souligne à deux reprises «l’effet bienfaisant de douceur» de cet ouvrage présent dans la bibliothèque paternelle. Une scène significative à cet égard est l’épisode illustré de la première gravure. Ce roman d’éducation comme un «roman de formation», trait d’union entre le roman homérique et Les Années d’apprentissage de Wilhelm Meister (1796).
Jacques Berchtold, Fondation Bodmer, Coligny
Mit der Erzählung Ursula setzte Gottfried Keller seiner Heimatstadt Zürich und der Zürcher Reformation ein literarisches Denkmal. Passend zum 200. Geburtstag des großen Schweizer Schriftstellers am 19. Juli und 500 Jahre nach Beginn der Reformation hat Hannes Binder die Novelle spektakulär illustriert.

»Wenn die Religionen sich wenden, so ist es, wie wenn die Berge sich auftun …«
Das 16. Jahrhundert steht in der Schweiz im Zeichen der Reformation. Mittendrin: Der Söldner Hansli Gyr und die Nachbarstochter Ursula, deren Heirat eigentlich schon ausgemachte Sache war. Doch als Hansli aus dem Krieg in die Heimat zurückkehrt, steht auf einmal der Glaube zwischen den beiden.
Denn Ursula hat sich den Täufern angeschlossen, die neben Glaubensfreiheit auch die strikte Trennung von Kirche und Staat fordern. Hansli selbst begeistert sich dagegen für die Lehren des Reformators Huldrych Zwingli, auf dessen Drängen hin die Anhänger der Täuferbewegung verfolgt werden – viele von ihnen wurden in der Limmat ertränkt.
Ursula, erstmals 1877 als Teil der Züricher Novellen erschienen, erzählt eine tragische Liebesgeschichte vor dem historischen Hintergrund einer Zeit, die für die heutige Schweiz von größter Bedeutung ist. Die einzigartigen Illustrationen des Züricher Künstlers Hannes Binder verleihen Kellers Erzählung eine neue Tiefe und ziehen die Leser mitten hinein in die mal grotesken, mal berauschenden Wirren des 16. Jahrhunderts.

Hannes Binder, 1947 in Zürich geboren, ist Comiczeichner, Maler und Illustrator. Mit der für ihn typischen Schabkartontechnik illustrierte er zwischen 1988 und 2005 sieben Comics zu den Werken Friedrich Glausers, außerdem "Der Wegwerfer" von Heinrich Böll, diverse Kinderbücher u.a. Hannes Binder lebt in Zürich und im Tessin.
Galiani Verlag Berlin, Juni 2019
128 Seiten, Pappband
Farbschnitt, Lesebändchen
ISBN 978-3-86971-199-7
Nach der Verlagsankündigung zusammengestellt von Wolfram Schneider-Lastin, Zürich
Joachim Johann Nepomuk Anton Spalowsky, Fünfter Beytrag zur Naturgeschichte der Vögel, mit 46 Kupfertafeln, gestochen von Benedikt Piringer, Samuel Czetter und Joseph Schmidt in prachtvollem Originalkolorit. Zeitgenössischer dunkelgrüner Maroquinband mit reicher Vergoldung und den Allianzwappen der Familien Paar und Liechtenstein, dreiseitigem Goldschnitt, gross 4°; in Wien «gedruckt bey Franz Schrämbl», 1795.
Bei Privatdrucken haben die Kosten manchmal nicht die erste Priorität, was ermöglicht, besonders schöne und reiche Bücher entstehen zu lassen. Die aufwendig gestalteten Vogelbücher des ersten Stabsmedikus im Wiener Bürgerregiment, Joachim Spalowsky (1752-1797), sind solche besonders reich gestaltete Beispiele. Spalowsky legte Wert darauf, überschwängliche, mit Wappen verzierte Widmungen und Danksagungen an seine fürstlichen Förderer in seine Werke einzubinden.
Seine Vogelforschung verglich er oft mit früheren Autoren wie Linné, Buffon, Brisson, Meriani oder Lantham und wies darauf hin, dass er im Gegensatz zu den oben Genannten, alle Vögel selber gesehen und gezeichnet habe, während z.B. Buffon kaum einen Drittel seiner von ihm beschriebenen Vögel je gesichtet habe. Daher sind Spalowskys Beobachtungen oftmals exakter und zutreffender für die moderne Vogelforschung, denn er zeichnete anhand seiner großen Sammlung von ausgestopften Vögeln, also wie er sagt: nach der Natur. Manchmal verschönert Spalowsky seine Kupferdarstellungen mit gehöhtem Silber- und Golddruck.

In der «Vorerinnerung» schreibt Spalowsky, dass er seine «Werke der gelehrten Welt» empfehle, «und bitte, solche gegen jeden schadenfrohen Neider zu verteidigen … Ich habe diese Bitte zu wagen, um so viel mehr Ursache, als mir bereits einige schmutzige Zotenreisser die Abnehmer zu verleiden, meine Beyträge zur Naturgeschichte und die Sammlung, wovon solche copirt worden, durch Unwahrheiten bloss aus dem Grunde zu verleumden suchen».
Aglaja und Ulrich Huber-Toedtli, Erlenbach
Robert Walsers letztes Buch
Die Rose entstand 1924 in Bern. Der Autor hatte vor mehr als vier Jahren das letzte Mal ein Buch publiziert, die Textsammlung Seeland (1920). Mit der Übersiedlung von Biel nach Bern 1921 begann für Walser allmählich eine neue Schaffensperiode. Einen entscheidenden Impuls dazu erhielt er 1923 durch die Anfrage zur Mitarbeit an Franz Hessels Zeitschriftenprojekt Vers und Prosa, zu dem er auch elf Texte beisteuerte, die im Verlauf des Jahres 1924 in mehreren Heften der Zeitschrift erschienen sind. Sie bildeten den Grundstock für Die Rose, die Anfang 1925 in Berlin im Ernst Rowohlt Verlag erscheinen konnte. Es ist ein bibliophiles Buch, gesetzt in der eleganten Jean-Paul-Fraktur und gedruckt bei Jakob Hegner in Hellerau. Die Lithographie auf dem Umschlag wurde vom Bruder Karl Walser gestaltet (Abbildung 1). Das schöne, schlanke Buch erhielt eine beachtliche Aufmerksamkeit in der zeitgenössischen Literaturkritik, aber buchhändlerisch war es (wie übrigens die meisten Bücher Robert Walsers) ein Flop. Daher konnte Walser nach Die Rose kein weiteres Buch mehr publizieren, obwohl er sich verschiedentlich darum bemüht hatte. Doch er entwickelte ab 1925 eine deutlich gesteigerte Publikationstätigkeit in den Feuilletons internationaler Zeitungen und Zeitschriften in Berlin, Frankfurt, Prag und anderen Orten.
Man kann sagen, mit Die Rose beginnt Walsers Spätwerk. Dazu gehören auch die erst nach seinem Tod bekannt und dann berühmt gewordenen Mikrogramme, die Walser ab 1924 bis 1933 gesammelt hat und die als das schriftstellerische Archiv seines Spätwerks bezeichnet werden können; denn zu fast allen Veröffentlichungen nach 1924 findet man die Vorentwürfe in diesem Konvolut der Mikrogramme. Zu etwa der Hälfte der von Walser verfassten Texte kennen wir nur diese Bleistiftentwürfe in einer sehr kleinen Konzeptschrift (daher die Bezeichnung Mikrogramme), darunter auch der berühmte, lange nach Walsers Tod erstmals veröffentlichte sogenannte Räuber-Roman. Nur zu den über drei Dutzend Einzeltexten, die in Die Rose versammelt sind, hat sich kein einziger Vorentwurf erhalten; denn erst nach der Fertigstellung von Die Rose begann Walser seine mikrografischen Entwürfe aufzubewahren.
Die Rose exponiert in den einzelnen Texten und in deren spürbarer, aber schwer zu beschreibender Komposition die Signatur von Walsers Spätwerk. Auffällig ist die große stilistische Diversität: Neben erzählerisch kohärenten Kurzgeschichten, wie etwa die vielleicht bekannteste mit dem Titel „Die Keller’sche Novelle“ finden sich knappe szenische Dialoge, surrealistisch wirkende Erzählexperimente oder biografisch anmutende Travestien („Der Affe“), kleine Traktate und vieles mehr. Fast allen Stücken ist ein ausgeprägter metapoetischer Charakter gemein, der das Schreiben, aber auch das Misslingen des Schreibens thematisiert. Immer wieder wenden sich die Texte gegen das Diktat des Literaturmarkts, der von einem Autor damals „Novellen“ und „Romane“ verlangte. Der nur zwei Seiten umfassende Text „Das seltsame Mädchen“ stellt sich als Parodie auf eine „Novelle“ dar. Die explizit als „Prunkstück von Novelle“ konzipierte Erzählung hat zu ihrem eigentlichen Inhalt das komische Scheitern des Schreibprojektes selbst. Das Erzählexperiment schließt mit dem Satz: „Mag aus dieser Geschichte klug werden, wer Lust dazu hat.“
Tatsächlich mutet der Autor seinen Lesern im scheinbar vor sich hin plaudernden Erzählen eine radikale Poetik zu. Doch diese Poetik hat durchaus Bezüge zur zeitgenössischen Avantgarde; allerdings will sie sich gerade nicht als solche zu erkennen geben. Manche Prosastücke sind aus vordergründig unzusammenhängenden Sätzen kombiniert, die es verunmöglichen, den Text inhaltlich zusammenzufassen. So im Prosastück „Zückerchen“; hier findet sich der Satz: „Ein Knödli mit Senf schmeckte mir herrlich, was mich nicht hindert, anzumerken, in einem Ichbuch sei womöglich das Ich bescheiden-figürlich, nicht autorlich.“ Unversehens wird dabei ein poetologisch entscheidender Sachverhalt zur Sprache gebracht: die Trennlinie von autobiografischem und literarischem Schreiben.
Das scheinbar naive Spiel mit der Verwirrung der Leserinnen und Leser reicht bis zu einzelnen Wörtern. Neben zahllosen Wortspielen und Neologismen finden sich auch reichlich schweizerdeutsche Wörter, die im norddeutschen Sprachraum – Walsers Buch erschien in Berlin – kaum verstanden werden, z.B.: „Höseler“, „Täsche“, „Glust, „Knödli“, „Toggeln“ und viele weitere. Daraus entstehen subtile Verfremdungseffekte, die die Lektüre irritieren und die Aufmerksamkeit von der Referenz der Texte auf ihre Signifikanz, ihre Buchstäblichkeit lenken. Ein reizvolles Beispiel dafür gibt eine überschriftslose Erzählskizze (vgl. Abbildung 2), in welcher der Erzähler beobachtet, wie ein „Herr“ zu einem „Fräulein“ spricht und dabei eine Beleidigung äußert, die er selbst nicht einmal bemerkt. Es handelt sich dabei um ein einziges Wort, das im Text auf einer eigenen Zeile steht und in lateinischen Majuskeln gesetzt ist: „BEGRIFSCH?“ Um die Pointe der kleinen Szene zu verstehen, muss man genau dieses Wort ‚begreifen‘.

Die Rose enthält ganz verschiedene Arten von Leser-Provokationen – nicht selten mittels demonstrativer Banalität. So etwa dieser, ebenfalls im Prosastück „Zückerchen“ stehende Satz: „Wie süß war ein Bänkli im vorfrühlingshaft-blutten Wäldchen! Wär’s aus Marzipan gewesen, ich hätt’ es aufgegessen. Ich war so begeistert.“ Es ist schwer zu erklären, weshalb einen solche Formulierungen unmittelbar berühren können, aber es ist das Ergebnis einer konsequenten Spracharbeit Walsers. In einem nur als Manuskript überlieferten Prosastück von 1928, das die Überschrift „Meine Bemühungen“ trägt, bemerkt Robert Walser: „doch ich experimentierte auf sprachlichem Gebiet in der Hoffnung, in der Sprache sei irgendwelche unbekannte Lebendigkeit vorhanden, die es eine Freude sei zu wecken.“
Robert Walser: Kritische Ausgabe sämtlicher Drucke und Manuskripte, hg. Wolfram Groddeck und Barbara von Reibnitz. Band I, 12: Die Rose, hg. von Wolfram Groddeck, Hans-Joachim Heerde, Caroline Socha. Schwabe/Stroemfeld: Basel und Frankfurt am Main 2016.
https://kritische-walser-ausgabe.ch/
Wolfram Groddeck, Basel
Der 63jährige Südafrikaner William Kentridge gilt als einer der renommiertesten zeitgenössischen Künstler. Bekannt geworden ist er durch die Inszenierung von Mozarts Zauberflöte und der Gegenoper „Black Box“, die er im gleichen Stil aufgebaut hat wie die Zauberflöte, die sich aber mit der kolonialistischen Ausrottung der Herrero in Sudafrika befasst. Seit seiner Jugend ist Kentridge politisch von Themen wie Apartheid und Unterdrückung geprägt, sein Vater war der Verteidiger von Nelson Mandela.
Seine Kunst geht aus von Kohlezeichnungen und Skulpturen, die er zu Filmen zusammensetzt, in denen er oft selbst auftritt und mit denen er die Bühnenbilder seiner Inszenierungen (Shostakovichs The Nose; Schuberts Winterreise oder Alban Bergs Wozzeck) gestaltet, die Figuren bestimmt und auch gleich selbst Regie führt.
Seine Kunst sprengt alle Grenzen. Und auch das Buch spielt in seinem Werk eine grosse Rolle. Er sieht es als eigenständiges Kunstwerk, wie das zu einem Bild aufklappbare Buch „Remembering the treason trial“ zeigt, das auf seinen Jugenderfahrungen mit seinem Vater basiert. Seine Kreativität schlägt sich auch in seinen weiteren Büchern nieder. In „No, it is“ finden wir nicht nur seine Zeichnungen, sondern können diese über eine App gleich zum Leben erwecken und auf seine Videoinstallationen aus dem Buch zugreifen. „No, it is“ bezieht sich auf eine Ausstellung im Martin-Gropius Bau in Berlin, die verschiedene seiner Werke zeigte.
Kentridge ist einer der vielseitigsten, wichtigsten Künstler der Gegenwart. Es lohnt, einmal einen Blick in sein Werk, sei es nun ein Buch oder ein anderes Kunstwerk, zu werfen. Am 8. Juni öffnet übrigens eine Ausstellung dieses Künstlers im Kunstmuseum Basel.
ISBN 978-3-86335-930-0 Verlag der Buchhandlung Walter König, Köln 2016, 323 Seiten mit vielen Abbildungen.
Alex Rübel, Zürich
Das 1624 erstmals erschienene Werk von Hermann (auch Herman) Hugo S.J. (1588–1629) ist eines der erfolgreichsten Erbauungsbücher. Es strahlte bis ins 18. Jahrhundert auch weit über den Kreis der Jesuiten hinaus aus.
Das Werk enthält drei Abteilungen, die dem mystischen Modell der sogenannten ›Via triplex‹ entsprechen (Läuterungs-, Erleuchtungs- und Einungsweg: via purgativa, illuminativa, unitiva – dies ist nicht ein speziell jesuitisches Schema). In der deutschen Übersetzung von Hainzmann (1683) lautet das so:
Erstes Buch Der Gottseligen Begirden: Das Klagen der Büessenden Seel (H. Hugo: Gemitus animæ pœnitentis)
Zweytes Buch Der Gottseligen Begirden: Das Verlangen der Heiligen Seel (Vota Animæ Sanctæ)
Drittes Buch Der Gottseligen Begirden: Das Seuffzen der Verliebten Seel (Suspiria Animæ amantis)
Jedes Buch enthält 15 Embleme. Deren Mikrostruktur:
- Bild
- Bibelzitat häufig aus dem Hohenlied oder den Psalmen.
- Elegie in Distichen
-
Prosa-Kompilation von (in Fußnoten nachgewiesenen) Zitaten aus der Bibel, aus Kirchenvätern, aus Bernhard von Clairvaux u.a.
Die Bilder sind nicht etwa eine hübsche Zugabe. Die Anschauung als Ausgangspunkt der Meditation ist in den Exerzitien des Ordensgründers Ignatius von Loyola (1491–1556) von großer Bedeutung. Eine Maxime lautet bei ihm: El primer preámbulo es composición viendo el lugar. (Die erste Vorübung besteht in der Zurichtung des Schauplatzes, ¶ 47). Das Bild erscheint in den Emblembüchern auf den ersten Blick meist etwas rätselhaft, wird dann aber durch die Lektüre des Texts erklärt.
Die Bilder basieren im Gegensatz zu anderen Emblembüchern hier nicht auf Bedeutungsträgern aus der Natur (Tiere, Pflanzen), der Technik, (z.B. Mühle, Waage), der Mythologie, sondern es reden und handeln in der Regel zwei Figuren in Kindergestalt: ein geflügeltes Engelchen mit Nimbus und ein kleines Mädchen.
Diese beiden Gestalten hat bereits Otto Vaenius (van Veen, 1556–1629) in seinem Emblembuch »Amoris divini emblemata« 1615 kreiert; bei ihm sind sie angeschrieben mit AMOR DIVINUS und ANIMA.
Der Illustrator der »Pia desideria«, Boëtius a Bolswert (ca. 1580–1633), übernimmt diese Personifikationen der göttlichen Liebe und der Seele offensichtlich. Er hat damals bereits das Buch eines anderen Jesuiten, Antoine Sucquet S.J. (1574–1627), mit 32 komplexen Illustrationen versehen: »Via vitae aeternae«, Antwerpen 1620; in deutscher Übersetzung: »Weeg deß ewigen Lebens«, Augspurg 1626. Dieses Werk ist für H. Hugo ein Vorbild gewesen. Man muss annehmen, dass H. Hugo keinen Einfluss auf die Bebilderung der »Pia desideria« hatte.
Ausgaben und Übersetzungen
Erster Druck: Pia Desideria, Emblematis, Elegiis, et affectibus SS. Patrum Illvstrata authore HERMANNO HVGONE Societatis Iesu. Vulgavit [hier zu verstehen als: bebildert durch] Boëtius a Bolswert, Antverpiæ: Hendrick Aertssens 1624. — Web-Edition hier: http://emblems.let.uu.nl/hu1624.html
Es sind etwa 55 lateinische Ausgaben und 63 volkssprachliche Übersetzungen überliefert.
Die Kupferstiche der Erstausgabe wurden mehr oder weniger gut kopiert.
Die deutschen Übersetzer haben den Text z.T. eingekürzt. Hier nur eine kurze Liste:
Die erste deutsche Übersetzung stammt von Karl Stengel OSB (1581–1663), Augsburg 1627. Er verzichtet auf die Verse.
Wenzel Scherffer von Scherffenstein (*ca. 1603–1674) übersetzt 1644 die lateinischen Distichen Zeile für Zeile in deutsche Alexandriner; die Prosa und die Bilder lässt er weg.
Der lutherische Übersetzer und Bearbeiter Erasmus Francisci (1627–1694) verändert die Struktur in seiner Ausgabe »Die geistliche Gold-Kammer« (1668): Nach dem Bibelzitat bringt er eine predigtartige Auslegung wie Hugo, dann aber ein Gebet und dann ein Lied, zu dem er die Singweise angibt. (Michael Schilling stellte fest, dass dieser Aufbau dem evangelischen Gottesdienst entspricht.)
Johann Christoph Heinzmann überträgt 1683 die Elegien in verschiedene deutsche Metren und schließt sie mit einer kurzen Schluß-Red ab. – Die Kupfer sind gestochen (sc.) von Melchior Küsel (1626–1683).
Andreas Presson (1637–1701) hat das zweite Buch nicht nur übersetzt, sondern auch mit Melodien versehen: Das Klagen der büssenden Seel, oder die sogenannte Pia desideria. Mit grossem Fleiß und Mühe auff das vertreulichste, nicht allein in hochteutsche Poësin, sondern auch sambt betrückung der Lateinischen Carminum mit schönen anmühtigen Melodeyen neuen Kupfferstichen und annotationen gezieret, Bamberg 1676.
Interessant ist die in Sultzbach 1669 erschienene Ausgabe. Der Text ist der von K. Stengel, die Bilder stammen aus der Ausgabe von E. Francisci:
R. P. Hermanni Hugonis, Societatis Jesu, Gottseelige Begierden Der Büssenden/ Heiligen und in GOTT verliebten Seelen. Jetzo zum ersten mal in Teutscher Sprach in dieses Format eingerichtet/ und mit dergleichen Kupfern gezieret. Sultzbach/ Geruckt bey Abraham Lichtenthaler/ anno M.DC.LXIX.
Ob das Buch nur zwecks Abschöpfung eines konfessionell geteilten Marktes diente, oder ob es ein ökumenisches Projekt des Pfalzgrafen Christian August war, der 1652 das Simultaneum eingeführt hatte, die damals in Deutschland fast einzigartige Gleichstellung von Katholiken und Lutheranern?
Erstes Beispiel
Zweites Buch, 2. Kapitel: Der Mensch im Labyrinth
Pia Desideria : Tribus Libris Comprehensa, I. Gemitus Animae poenitentis. II. Vota Animae sanctae; III. Suspiria Animae amantis, Auctore R.P. Herm. Hugone, Coloniæ, Es Officina Metternichiana, Anno M.DCC.XLI. — Bildgröße 4,5 x 8 cm.
Das Motto ist: Wolte GOtt/ daß meine Weg gerichtet würden deine Rechte zu bewahren. Psalm 118. V.6
Das Gedicht beginnt:
Quo ferar? ambiguos aperit mihi semita calles;
Semita non vno tramite secta vias.
Die erste Strophe (von 23) in der Übersetzung von A. Presson:
Wo werd ich doch gerathen hin?
Bey so viel Fehlen-Strassen?
Worinnen ich begriffen bin/
Da in verschiedne Gassen
So mancher Weg/ Und mancher Steg/
Zertheilt vor Augen lieget/
Der alle Tritt Und müde Schritt
Durch falschen Gang betrieget.
Aus der Schluß-Red von Hainzmann 1699: Der Gottlosen Weg seynd allezeit verwicklet/ also/ daß die jenige/ so den bösen Begirden ergeben seynd/ entweders nichts guts begehren zu thun/ oder so sie diß etwan begehren mit schwachem Lust oder Begirden/ sie doch darzu gar nicht mit freyen Schritten deß Gemüths gereichen: dann was recht und gut ist/ fangen sie entweder nicht an/ oder sie erligen auf dem Weg/ daß sie dazu gar nicht gelangen. […] Was ist das Umlauffen der Gottlosen? daß sie herum gehen und nicht still stehen! daß sie herum gehen im Würbel des Irrthums/ also der Weg ist ohne End. Dann der den langen Weg hergehet/ hebt an einem Ort an/ und endet seinen Weg an einem andern; wer aber im Würbel herumgehet/ endet seinen Weg nirgends. Diß ist der gottlosen Arbeit/ von welchem gesagt wirdt: die Gottlosen wandlen rund herum im Umkraiß.
Die Texte kreisen um die Wegmetaphorik, erwähnen aber die Symbolik des Labyrinths nicht explizit. Diese Idee scheint vom Illustrator Boëtius a Bolswert zu stammen. Dessen Bild zeigt die göttliche Liebe auf einem Turm; sie leitet die Seele von dort aus an einem Seil. Auf dem Bild der Ausgabe Pia Desideria Coloniæ, Es Officina Metternichiana, Anno M.DCC.XLI schwebt die Anima Divina im Himmel, führt die Seele an einem Seil und ›leuchtet ihr heim‹.
Zweites Beispiel
Erstes Buch, 9. Kapitel: Der Mensch in der Falle
Gottselige Begirde. Aus lautter sprüchen der Heÿligen Vättern Zusamen gezogen Vnd mitt schönen figuren gezieret / durch R. P. Hermannum Hugonem ... Verteütscht Durch R. P. F. Carolum Stengelium, Augspurg: Schönig, 1627. — Bildgröße 5,5 x 8,3 cm.
Das Bild zeigt die ihren irdischen Gütern verhaftete Seele, die ins Netz eines Vogelfängers (hier: der Tod) geraten ist, sowie weitere von teuflischen Gestalten Gejagte. (Die Technik der Vogelfalle war den Lesern bekannt: Der Jäger versteckt sich in einem Gesträuch und lässt die Netze zuklappen, wenn Vögel darin Futter picken.)
Das Motto ist Psalm 17,6: Die Schmertz der Höll haben mich umbfangen; und die Strick des Todts haben mich übereilet.
Hier eine Auswahl von begleitenden Texten aus: G. Stengel (1627):
Sihe o HErr mein GOTT/ die ganze Welt ist voller Stricken der Begierlichkeiten/ welche sie für meine Füß haben bereitet/ vnd wer kan disen Stricken entfliehen? Augustin. Soliloq. cap. 12.
Meine Feinde haben mich gejaget vnd gefangen wie ein Vogel/ vnd das ohn vrsach. Hier. Thren. 3. [Klagelieder Jeremiae 3,52]
Merck vnd verstehe/ daß du mitten vnder den Stricken wandlest vnnd vnder den obligenden Nachstellungen hergehest. Alles ist voller Netzen/ der Teuffel hat alles mit stricken angefüllt. Orig. hom. 2. in cant.
Nimm wahr/ er hat vor vnsern Füßen vnzehliche vil Strick anßgespannt/ vnnd alle vnsere Weeg mit vilen Fallstricken angefüllt/ vnsere Seelen damit zufangen/ Vnd wer willentrinnen? Er hat Strick gelegt in Reichthumb/ Strick hat er gelegt in Armuot/ Strick hat er außgespannt in der Speiß/ im Tranck/ in Wollust/ im Schlaff vnd im Wachen; Strick hat er gelegt in Worten/ vnd in Wercken vnd auff allen vnseren Weegen. Augustin Soliloq. cap. 16.
Die Gnad der Ehren/ die Höhe des Gewalts/ die süsse vnd lieblichkeit der Speysen/ die schöne gestalt der Metzen/ seynd lauter strick des Teuffels. Ambrosius lib. 4. in c. 4 Lucam.
Du aber/ o HERR/ errette vns vom strick der der Jäger/ vnd von dem starcken Wort/ auff daß wir dich loben/ sprechende: Gelobet sey der HERR/ daß er vmns nicht hat geben zum Raub inn ihre Zähne: Vnser Seel ist entrunnen wie ein Spätzlin auß dem strick des Voglers/ der strick ist zerrissen/ vnd wir seynd erlöset. Augustin Soliloq. cap. 16.
Drittes Beispiel
Zweites Buch, 3. Kapitel: Die Seele im Baby-Laufwagen
Himmlische Nachtigall, singend gottseelige Begirden, der büssend- heilig- und verliebten Seel, nach denen drey Weegen der Reinigung, Erleuchtung, und Vereinigung mit Gott. In Hoch-Teutscher Sprach verfaßt/ und mit anmuthigen Kupffern gezieret Durch Johann Christoph Hainzmann, Augsburg: Kroniger u. Göbel 1699. — Bildgröße 4,5 x 7 cm (Stich von Melchior Küsel)
Das Motto ist Psalm 16 [17], 5 : Bestätige meine Gäng auff deinen Wegen: damit meine Fußstapfen nicht beweget werden. (Ausgabe Sultzbach 1669; Luther-Übersetzung 1545: Erhalte meinen Gang auff deinen Fussteigen/ Das meine Tritt nicht gleitten.)
Der Herausgeber der Ausgabe Augsburg 1699 doppelt gleich nach mit einem weiteren Psalmzitat 118[119],9: Wodurch wird ein Jüngling seinen Weg bessern. (Luther 1545: Wie wird ein Jüngling seinen Weg vnstrefflich gehen? Vulgata: In quo corrigit adolescentior viam suam?). Denkbar, dass er die Aussage des Bilds unterstützen wollte, indem er mit diesem Zitat die Vorstellung des Heranwachsenden einbrachte; denn diese kommt in den begleitenden Texten von H. Hugo konkret nicht vor.
Am nächsten kommt eine Textstelle aus Augustinus (Soliloquia) : Ich verließ mich bißweilen auf meine Stärcke/ welches doch keine war/ und hab also wöllen lauffen/ aber da ich mir am allermeisten zu stehen vertraute/ da bin ich mehr hindersich/ als fürsich kommen/ und das was ich verhoffte zu erlangen/ ist je länger je ferner von mir worden.
Viertes Beispiel
Zweites Buch, 5. Kapitel: Die Eitelkeit (Vanitas) mit ihren Attributen
R.P. Hermanni Hugonis, Societatis Jesu, Gottseelige Begierden Der Büssenden, Heiligen und in Gott verliebten Seelen. Jetzo zum ersten mal in Teutscher Sprach in dieses Format eingerichtet/ und mit dergleichen Kupfern gezieret, Sultzbach: Abraham Lichtenthaler 1669. — Bildgröße 7,5 x 11,4 cm.
Das Motto ist Psalm 118[119],37: Wende meine Augen ab, daß sie die Eitelkeit nicht sehen.
Die göttliche Liebe hält der Seele die Augen zu. Die Eitelkeit ist dargestellt als eine Dame in prunkvollem Gewand. In der einen Hand hält sie einen Fächer aus Pfauenfedern; in der anderen ein Gefäß, aus dem Seifenblasen auffliegen. Der stolz sein Rad schlagende Pfau ist im Spätmittelalter und dann in der barocken Emblematik Attribut der Eitelkeit und Hoffart (Superbia). Seifenblasen stehen für die Vergänglichkeit (Vanitas) des Ruhms.
Fünftes Beispiel
Drittes Buch, 8. Kapitel: Der Kerker der Seele
Das Gleichnis, wonach die Seele im Körper wie in einem Gefängnis lebe, zieht sich seit Platon durch die Jahrhunderte.
In der Bibel kommt die Vorstellung auch vor: Ich unglücklicher Mensch, wer wird mich aus dem Körper des Todes retten? (Infelix homo, quis me liberabit de corpore mortis huius? Römerbrief 7,24; dieser Satz wird im Emblem als Motto benutzt.) – Führe meine Seele aus dem Kerker, damit ich Deinen Namen preise! (Educ de carcere animam meam ad confitendum nomini tuo. Psalm 141 [142],8)
Der als Mystiker bekannte Heinrich Seuse (um 1295–1366) schreibt: Fröwe dich, daz din schönú sele, dú da ist ein luter, vernúnftiger, gotförmiger geist, daz dú uss dem engen jemerlichen kercher sol erlöset werden … (Kleines Briefbüchlein, 6. Brief).
Gottselige Begirde. Aus lautter sprüchen der Heÿligen Vättern Zusamen gezogen Vnd mitt schönen figuren gezieret / durch R. P. Hermannum Hugonem ... Verteütscht Durch R. P. F. Carolum Stengelium, Augspurg: Schönig, 1627. — Bildgröße 5,5 x 8,3 cm.
Das Gefängnis des Leibes wird durch die wie Gitterstäbe wirkenden Rippen des Brustkorbs eines Skeletts dargestellt.
Literaturhinweise:
Michael Schilling, Der rechte Teutsche Hugo. Deutschsprachige Übersetzungen und Bearbeitungen der Pia Desideria Hermann Hugos SJ. In: Germanisch-Romanische Monatsschrift 70 (1989), S. 283–300.
Gabriele Dorothea Rödter, Via piæ animæ. Grundlagenuntersuchung zur emblematischen Verknüpfung von Bild und Wort in den »Pia Desideria« des Hermann Hugo, (Mikrokosmos 32), Frankfurt/M. usw.: Lang 1992. — Detaillierte Studien mit Text-Nachweisen und Übersetzungen zu Kapitel III,4 (Sonnenblume); II,14 (Baum-Kreuz); I,1 (Laterne/Milchstraße); III,11 (Hirsch/Quelle); Einleitung (Pfeile auf Gott).
Paul Michel, Zürich
Gottfried Keller, Alte Weisen, Bilder von Ernst Kreidolf, hrsg. von Anna Lehninger, Barbara Stark und Sibylle Walther, Bern: Verein Ernst Kreidolf, 2019.
Aus Anlass von Gottfried Kellers 200. Geburtstag am 19. Juli 2019 ist im Verein Ernst Kreidolf eine besondere Jahresgabe erschienen: Die Alten Weisen von Gottfried Keller mit Illustrationen Ernst Kreidolfs. Vermutlich in den 1930er-Jahren bebilderte Kreidolf, der ein großer Verehrer des Autors und Kenner seiner Gedichte war, jenen Gedichtzyklus, jedoch sind die Illustrationen nie erschienen. In den 1846 erstmals publizierten zwölf Gedichten verhandelte Keller verschiedene Aspekte von Weiblichkeit und Liebe, vom Gefühl der verschmähten über die verlorene bis zur nie erfahrenen Zuneigung.
In oft mehreren Fassungen hat Ernst Kreidolf als kongenialer Illustrator das Wesentliche der Texte Kellers in bildliche Form gebracht. Vorgestellt werden ganz unterschiedliche Frauenfiguren (in der ersten Fassung hatten die einzelnen Gedichte statt Titeln Frauennamen) – dämonische oder liebliche, unschuldige, schrullige oder verlebte. Wir erleben hier einen ganz anderen Illustrator, als man ihn aus seinen Bilderbuchillustrationen kennt – das Figurenensemble präsentiert sich erotisch aufgeladen, heiter-frivol, kämpferisch oder vom Leben enttäuscht. Im Spiel mit der Textvorlage, die Kreidolf als Illustrator – zum Teil in zwei oder gar drei verschiedenen Fassungen – nicht nur als Beiwerk untermalt, sondern ihr vielmehr eine bildliche Deutung gegenüberstellt, erweist er sich als feinfühliger Ausleger der Keller’schen Verse. Als «Wortmaler» fügt er den Alten Weisen neue Sichtweisen hinzu und erweitert damit auch die Lektüre der Texte um weitere Facetten, spielt mit Geschlechts- und Alterszuschreibungen und erweckt die Figuren Kellers somit zu eigenem, neuen Leben.
Anna Lehninger, Zürich
Thomas Murner (Hg.), Die disputacion vor den xij orten einer loblichen eidtgnoschafft, Luzern 1527
Das Buch ist der offizielle Druck der Akten der Badener Disputation von 1526, die im Rahmen der Eidgenössischen Tagsatzung vom 19. Mai bis 8. Juni im aargauischen Baden in deutscher Sprache abgehalten wurde. Drei Wochen lang stritten in der dortigen Stadtkirche in einem von ca. 200 namentlich bekannten Teilnehmern besuchten öffentlichen Streitgespräch Vertreter der altgläubigen Kirche mit Anhängern der Reformation um die kontroversen Themen Realpräsenz und Altarsakrament, Messopfer, Fürbitte Marias und der Heiligen, Bilder und andere. Vertreter der altgläubigen Seite war Johannes Eck aus Ingolstadt, für die neugläubige Partei disputierte neben anderen vor allem Johannes Oekolampadius aus Basel und der Berner Berchtold Haller; Zwingli blieb der Disputation fern.
Die Badener Disputation war ein Grossereignis der Reformationszeit, vergleichbar der Leipziger Disputation 1519 und dem Reichstag zu Worms 1521, und war die erste Disputation der zwinglianischen Reformation ausserhalb von Zürich. Neun Stände der Tagsatzung entschieden sich am Ende für den alten Glauben, vier für den neuen. Damit verfestigte die Badener Disputation die konfessionelle Trennung in der Alten Eidgenossenschaft und war von entscheidender Bedeutung für die konfessionellen Auseinandersetzungen der Reformationszeit und den weiteren Fortgang der Schweizer Geschichte.
Bei der Badener Disputation handelt es sich um die am besten rekonstruierbare Disputation, da sie von fünf Schreibern protokolliert wurde und alle fünf Originalprotokolle (heute in der Zentralbibliothek Zürich) erhalten sind.

Beginn des Protokolls von Johannes Huber (ZBZ F2, fol. 7r).
Auch die weitere Überlieferung ist einzigartig lückenlos. Alle Glieder der Überlieferungskette sind erhalten: Neben den fünf Protokollen, die simultan als Mitschriften bei der Disputation entstanden sind, sind dies
1. eine mit dem Ziel des offiziellen Drucks entstandene erste Reinschrift, die zwar zunächst nur von einem der Protokolle genommen, anschliessend jedoch mit den übrigen vier verglichen wurde,
2. eine davon abgeschriebene zweite Reinschrift, die unmittelbare Vorlage für den offiziellen Druck der Akten,
3. der offizielle deutsche Druck (unser Buch des Monats),
4. eine Übertragung ins Lateinische und deren Publikation 1528 in gedruckter Form.
Letzte Reinschrift und unmittelbare Vorlage für den offiziellen Druck der Akten (StA Luzern, KA 25, fol. 28v).
Titelblatt des lateinischen Drucks, hg. von Thomas Murner 1528 (ZBZ Re 390).
Mit der Drucklegung des deutschen Drucks beauftragt wurde der franziskanische Dichter und Kontroverstheologe Thomas Murner (1475–1537). Am 1. Dezember 1526, also erst Monate nach Abschluss der Disputation, begann er im Luzerner Franziskanerkloster mit den Strassburger Setzern Thomas Troger, Georg Christian und Nikolaus Christian mit der Arbeit, die Fertigstellung erfolgte in der zweiten Aprilhälfte 1527. Die Drucklegung war zwischen den Ständen ausgesprochen umstritten, weswegen die altgläubigen Stände alles taten, um dem Unternehmen der Druckausgabe des Disputationsprotokolls Authentizität und Autorität zu verleihen. So beschloss die Luzerner Tagsatzung gleich nach Fertigstellung des Druckes, nochmals einen Vergleich mit einem der Protokolle durchzuführen - demjenigen des Luzerner Stadtschreibers Johannes Huber - und damit die Richtigkeit des Drucks zu beglaubigen. Alle Druckexemplare wurden daher von Huber auf der Titelseite einzeln und einheitlich handschriftlich signiert.
Ausser dem Protokoll enthält das Werk mehrere Beigaben, darunter den für Zwingli gedachten Geleitbrief, die Disputationsordnung, Ecks Disputationsthesen und die offizielle Verurteilung Zwinglis.
Es war eines der ersten in Luzern gedruckten Bücher. Auf dem Titelblatt wurden allen Protesten zum Trotz auch Basel und Bern als Teilnehmer der Disputation genannt, die sich dieser Druckausgabe bis zuletzt widersetzt hatten. Trotz der alles andere als überstürzten Drucklegung war der Druck, was auch Murner später beklagte, voller Lese- und Druckfehler. Einen besonderen Streich spielte der Druckfehlerteufel dem Herausgeber in der Einleitung zur beigefügten Corrigenda-Liste, wo Murner versichert, er habe sich bemüht, das Protokoll trüglich – er meinte wohl: trülich – herauszugeben. Der Verdacht steht im Raum, einer der Setzer könnte evangelischen Glaubens gewesen sein und diesen Fehler absichtlich lanciert haben. Zu einer zweiten, berichtigten Auflage sollte es aber nicht kommen.
Wolfram Schneider-Lastin, Zürich
Zur Edition der Akten der Badener Disputation von 1526 siehe auch die Rezension von Alex Rübel auf dieser Website (März 2019).
1579 erscheint die erste Auflage von Laurentius van Goidtsenhovens (Laurentius Haechtanus, 1527–1603) «Mikrokosmos. Parvus Mundus» mit Kupferstichen von Gerard de Jode (1509–1591) in Antwerpen. Die Anlage entspricht den Emblembüchern der Epoche: Ein Motto – ein Bild – ein erklärender Text (hier in elegischen Distichen).
Das Buch wurde mehrmals neu aufgelegt; für die späteren Ausgaben (1618 und später) wurden die Stiche von Jacob de Zetter (?–1616?) (wie üblich seitenverkehrt) nachgestochen.
Wir greifen heraus Nr. 41: Sphinx. Die Sphinx gibt den Thebanern bekanntlich folgendes Rätsel auf: »Welches Wesen, das eine einzige Stimme hat, geht morgens auf vier Füßen, mittags auf zweien und abends auf dreien?« Oedipus vermag es zu lösen: Es ist der Mensch, der als Kleinkind auf allen Vieren krabbelt, als Mann zweibeinig marschiert und als Greis am Stock geht. Die antike Quelle der Geschichte ist Apollodor, »Bibliothek«, III,v,8 (Apollodor: Bibliotheke. Götter- und Heldensagen. Griechisch und Deutsch. Herausgegeben, übersetzt und kommentiert von Paul Dräger, Düsseldorf/Zürich 2005; hier 3. Buch, §§ 52–55). Apollodor beschreibt die Sphinx so: Sie hatte das Gesicht einer Frau, die Brust, die Füße und den Schwanz eines Löwen und die Flügel eines Vogels.

Abb. 1: Ausgabe von 1579
Hier nach dem Digitalisat von > Hathi Trust. Vgl. auch > hier.
Sphinx und der sinnierende Ödipus bilden die zentrale Szene; die drei Gestalten des aufgelösten Rätsels sind konkretisiert im Hintergrund sichtbar. Wenn Sphinx als männliches Wesen dargestellt ist, so könnte eine Stelle wie Heliodor, Historien II,175 im Hintergrund stehen; gemeint ist dort aber die ägyptische Skulptur der Sphinx.

Abb. 2: Ausgabe von 1618
Hier das Bild aus der Ausgabe Mikrokosmos = Parvus Mundus. Frankfurt a. M.: Jennis, 1618. (Privatbesitz). Der Kopist hat offensichtlich den lateinischen Text genau gelesen, wo die Sphinx weiblich ist: Callida Sphinx cuius longus pars vltima serpens | Ætheream facies indicat esse deam.
1644 erscheint auch eine deutsche Fassung mit den Kupfern von 1618: Jacob Zetter, Speculum virtutum & vitiorum. Darinnen nicht allein Tugend und Erbarkeit/ Zucht und gute Sitten/ Wie auch Laster/ und Untugend/ sondern auch der Welt mores, artig und anmühtig/ Beydes durch Kunstreiche Kupffer/ als auch artige Teutsche Historische und Moralische Reimen werden abgemahlet und fürgebildet. Francofurti: Zetter 1644. (>Digitalisat)
Hier wird die Sphinx – nicht zum Bild passend – so beschrieben: Das Wunderthier […] war formiret wünderlich: Das Antlitz einem Mägdlein gleich: Der Leib eim Hund: die Nägl eim Löwn; Die Stirn die war eim Menschen ebn: Der Schwantz wie ein Fisch oder Drach. Zitiert wird dazu Plinius; als Vorbild gedient haben könnte allenfalls die Stelle in der »Naturalis historia« VIII,xxx,72, wo er monströse Affen aus Äthiopien unter den Begriff sphingae beschreibt.
Paul Michel, Zürich
Das hond zwen schweyzer bauren gemacht. Fürwar sy hond es wol betracht. [Martin Seger, Hans Füssli, Zürich: Christoph Froschauer], 1521.
Am 1. Januar 1519, vor genau 500 Jahren, trat Zwingli seine Stelle als Leutpriester im Grossmünster in Zürich an. Die reformatorischen Ideen Luthers waren auch in Zürich angekommen und Zwingli erhält vom lateinunkundigen, aber wohlgebildeten Stadtvogt von Maienfeld, Martin Seger, den Entwurf zu einer Schrift, die er leicht von Luther weg zu Gott und Christus hin umformt, betitelt und die der schwerhörige Giesser und Zeugherr Hans Füssli 1521 mit seiner Hilfe für diese frühe Froschauer-Flugschrift in Verse giesst.
Der Holzschnitt des Titelblatts, eine reformatorische Umformung der früher bekannten Hostienmühle, zeigt als Eigentümer der Mühle Gott in den Wolken. Christus schüttet das Korn, das göttliche Wort, dargestellt als Apostel Paulus und die vier Evangelisten, selbst in den Mahlkasten. Erasmus von Rotterdam schöpft das Mehl, dargestellt als Stärke, Glaube Hoffnung, Liebe, in einen Mehlsack. Dies zeigt schön die damalige Bedeutung von Erasmus als Katalysator für die Reformation, nicht zuletzt durch sein 1516 in Basel bei Froben publiziertes Neues Testament in Griechisch. Martin Luther, der Bäcker, knetet den Teig. Hinter Luther übergibt ein Mann – man geht heute davon aus, dass dies Zwingli ist – die Heilige Schrift dem Papst und den Klerikern. Im Hintergrund holt Karsthans aus, um den Drachen, den verhassten Kirchenbann, zu erschlagen und so die göttliche Mühle zu verteidigen.
Alex Rübel. Quelle: Zwingliana 1910, Nr. 2, 363-370.
- zwingliana_2-12_1910_363-370.pdf (580.2 KB)